Liebe Konzerne, unser Gemüse gehört uns allen!
Internationale Großkonzerne beherrschen 75% des weltweiten Saatgutmarktes. Eine deutsche Initiative will ihre Macht brechen.
Meine ersten Gärtnerversuche waren nicht von Erfolg gekrönt. Im Kasten auf der Fensterbank keimte oft gar nichts. Einige Sämlinge verwelkten nach kurzer Zeit und andere wuchsen zwar heran, bildeten aber keine oder nur mickrige Fruchtansätze. Hatte ich etwas falsch gemacht? Oder stimmte etwas nicht mit den Samen, die ich fein säuberlich aus dem Supermarktgemüse herausgepult hatte?
Viele andere werden auf dem Weg zum eigenen Gemüsegarten ähnliche Enttäuschungen erlebt haben. Denn was vor 100 Jahren noch selbstverständlich gewesen wäre, nämlich Gemüse aus gesammelten Samen nachzuziehen, ist heute meist nicht mehr möglich. Der kommerzielle Gemüseanbau macht der Selbstversorgerromantik einen Strich durch die Rechnung. Warum?
- Erstens werden Obst und Gemüse oft unreif geerntet, damit sie lange Transportwege überstehen. Die Samen sind dann noch nicht ausgereift und somit auch nicht keimfähig.
- Zweitens werden häufig sogenannte Hybride angebaut. Durch die Kreuzung zweier verschiedener Sorten werden bei den Nachkommen besonders
Das ist nicht nur ärgerlich für ahnungslose Hobbygärtner, sondern auch für die Landwirte, die jede Saison neues Saatgut kaufen müssen. Gut ist es dagegen für diejenigen, die von Vermehrung und Verkauf des Saatguts leben – und sich auf diese Weise ihre Kundschaft erhalten. In der Regel sind das die großen Agrarkonzerne.
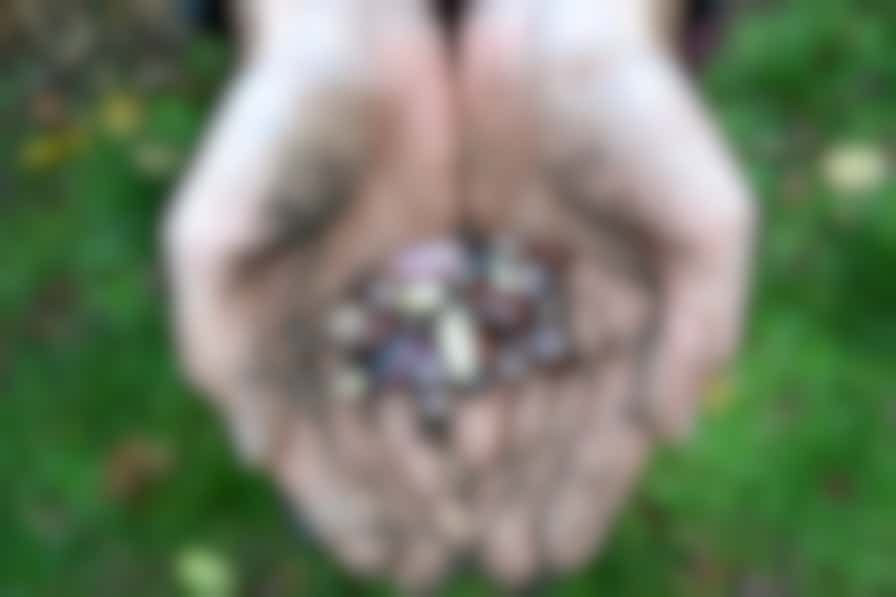
Dadurch entstehen Abhängigkeiten, aus denen Landwirte nicht so einfach ausbrechen können. Denn wenn einer von ihnen es schafft, aus gekauftem Saatgut etwas Brauchbares nachzuzüchten, drohen ihm deftige Geldstrafen. Das kommerziell vertriebene Saatgut unterliegt immer häufiger Sortenschutz- und Patentregeln, die eine Nachzucht einschränken oder verbieten.
Die Initiative
Johannes Kotschi

Johannes Kotschi ist seit über 30 Jahren Berater für Entwicklungsarbeit in Afrika und Asien. Sein Fokus liegt auf dem Gleichgewicht zwischen Intensivierung und Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft. Er findet, dass leistungsfähiges, standortgerechtes Saatgut nur mit den Menschen vor Ort entwickelt werden kann – das will er auch mit der Initiative »OpenSourceSeeds« unterstützen.
Bildquelle: Johannes KotschiIch habe dann nach Mitstreitern gesucht und schließlich zusammen mit Juristen, Commons-Aktivisten, Züchtern und Saatgutfachleuten eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe gebildet. Wir haben mit ersten Studien angefangen und bald zeigte sich, dass vor uns bereits andere Leute über das Thema nachgedacht hatten. In den USA gab es eine Initiative von einem Pflanzenzüchter, der hatte das »Public License« genannt. Dann kam eines zum anderen, bis wir
So funktioniert »OpenSourceSeeds«
Titelbild: Kristina Paukshtite - CC0 1.0



