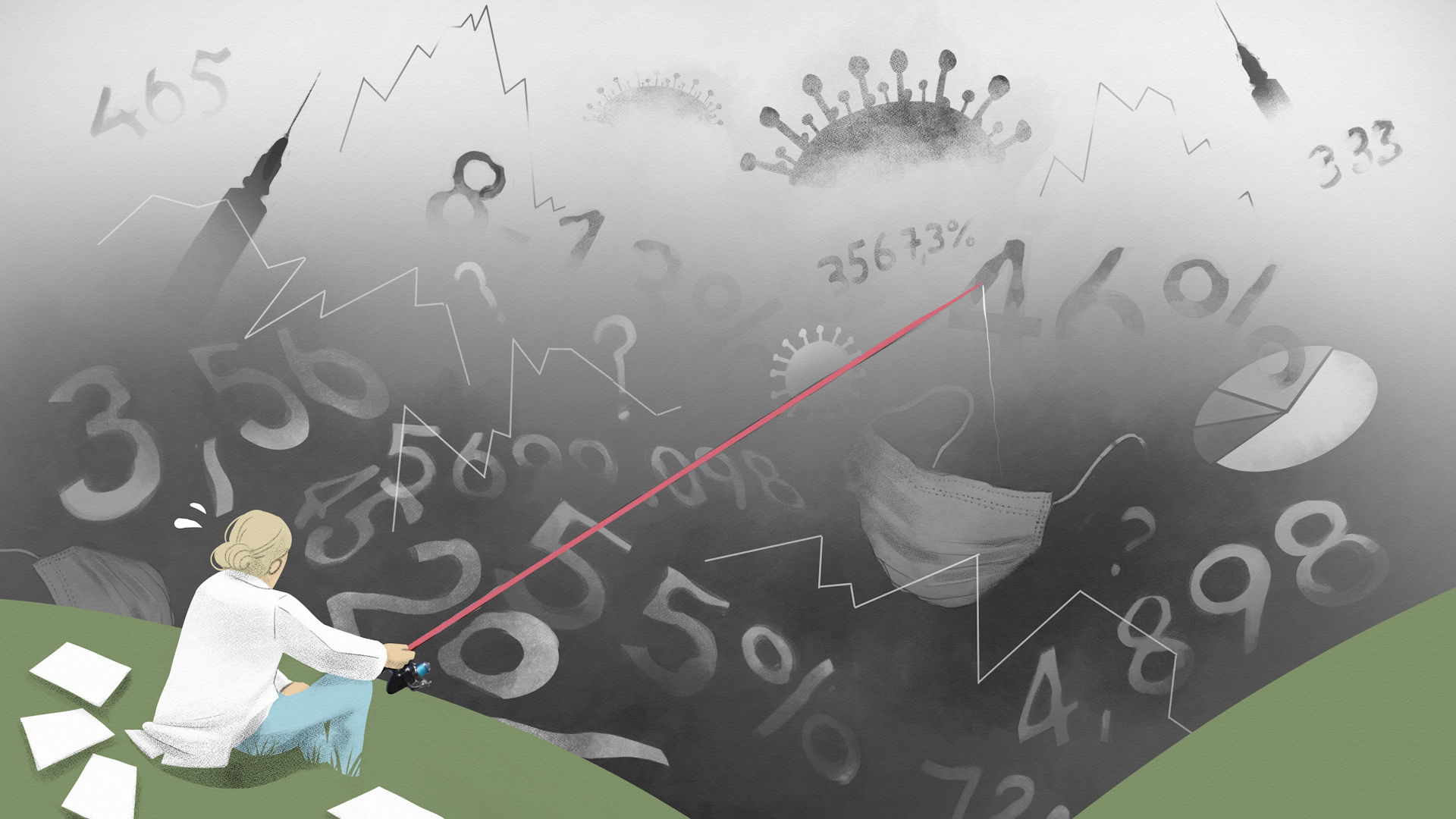Warum der Corona-Bericht nur scheitern konnte
Die Bewertung der Coronamaßnahmen hat mehr Unruhe als Klarheit gebracht – und das mit Ansage. Der Bericht enthält kaum fundierte Aussagen. Wie das kam und was hätte besser laufen müssen.
Vielleicht
Die Evaluation im Infektionsschutzgesetz
Im Gesetz hatte die alte Regierung im März 2021 festgelegt, dass das Bundesministerium für Gesundheit eine externe Evaluation der Coronamaßnahmen in Auftrag geben muss. Die Evaluation sollte interdisziplinär, auf Basis epidemiologischer und medizinischer Erkenntnisse und durch unabhängige Sachverständige erfolgen, die jeweils zur Hälfte von der Bundesregierung und vom Deutschen Bundestag benannt wurden. Der Bericht wurde am 1. Juli veröffentlicht, bis zum 30. September soll die Regierung nun Stellung beziehen und ihre Ergebnisse an den Bundestag übermitteln.
Tatsächlich streikte einer der Sachverständigen letztendlich doch: Virologe Christian Drosten. Er verließ den Kreis der Expert:innen im April, bemängelte die schlechte Ausstattung des Rates. Heute bezeichnet er seinen Austritt als Fehler – und kritisiert den Bericht harsch.
Um es ganz klarzustellen: Mein Rückzug aus dem Sachverständigenausschuss war nicht deswegen ein Fehler, weil ich mich dadurch irgendeiner Verantwortung entzogen hätte. Ein Fehler war es deswegen, weil ich als Mitglied weiter hätte versuchen können, auf Qualität zu bestehen.
Auch die verbliebenen Ausschussmitglieder hatten wohl schon vor der Veröffentlichung mit dem Thema Qualität abgeschlossen. Anfang Mai kündigte etwa der Vorsitzende des Sachverständigenausschusses, der Jurist Stefan Huster, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung an, dass man sich im Ausschuss eigentlich einig sei, bis Ende Juni keine vollständige wissenschaftliche Evaluation aller Maßnahmen leisten zu können. »Zum einen wegen fehlendem Personal, aber auch weil dies
5 Punkte, die den Bericht problematisch machen
Wer trotzdem Erwartungen an das Dokument stellte, konnte nur enttäuscht werden. Gleich mehrere Punkte sind problematisch:
- Es fehlten Daten: Das betonen die Mitglieder der Kommission im Bericht und in öffentlichen Statements immer wieder. Mit den vorhandenen Daten sei es kaum möglich, richtige Aussagen über viele der getroffenen Maßnahmen zu treffen.
- Es fehlte Zeit: Die 18
- Es fehlten Ressourcen: Alle Beteiligten arbeiteten ehrenamtlich. Für externe Mitarbeiter:innen, etwa wissenschaftliche Hilfskräfte, die bei der Literaturrecherche helfen könnten, gab es keine Mittel. So sei es kaum möglich gewesen, alle Studien zu sichten.
- Es fehlte Expertise: Laut Gesetz sollte das Gremium »insbesondere auf Basis epidemiologischer und medizinischer Erkenntnisse die Wirksamkeit der […] getroffenen Maßnahmen untersuchen«. Letztendlich saßen aber nur 4 Mediziner:innen, davon 3 Virolog:innen in der Kommission. Demgegenüber standen 6
- Es fehlte Transparenz: Zwar ist der Bericht für alle einsehbar, doch das macht ihn nicht automatisch transparent. So fehlt ein Methodenteil, der die Auswahl der für die Bewertung zu Rate gezogenen Studien begründet. Auch eine Erklärung zur Zusammensetzung der Sachverständigen ist nicht vorhanden. Öffentlich wurde außerdem kritisiert, dass nicht vollständig transparent gemacht wurde, welche weiteren Akteur:innen der Sachverständigenrat zur Beratung herangezogen hat.
Kurzum: Mit den Mitteln, die zur Verfügung standen, war es kaum möglich, einen umfassenden Bericht zu verfassen, der durchgehend wissenschaftlichen Standards genügt. Doch warum wurde er überhaupt verfasst, wenn selbst der Kommission klar war,
»Wir sagen nicht, was richtig oder falsch ist«
Über viele der Maßnahmen wollen die Sachverständigen kein Urteil fällen, insbesondere Maßnahmenbündel seien schwer voneinander zu trennen und dementsprechend kaum zu bewerten, sagte
Trotzdem: »Wir legen keine Tabelle vor, was richtig oder falsch ist, wir sagen auch nicht, was gut oder schlecht ist«, erklärte Streeck. Aber was genau macht ein Bericht dann, der per Gesetz die
Ob uns das wirklich weiterhilft?
Warum gerade ein schlechter Zeitpunkt für Grautöne ist
Dass unsere Gesellschaft aktuell nicht besonders empfänglich für Grautöne ist, hat sich im Verlauf der Pandemie mehr als einmal gezeigt. So sollte es niemanden überraschen, dass einige Medien aus dem Bekenntnis zum Nichtwissen bereits eine Absage an die Coronapolitik konstruieren:
Viele Maßnahmen hatten kaum Wirkung: Corona-Klatsche für Team Vorsicht
So titelte etwa die »Bild«. Dass »viele Maßnahmen kaum Wirkung zeigten« steht so natürlich nicht im Bericht. Der Vorsitzende des Ausschusses Stefan Huster betont: »Nur weil der Nutzen einzelner Maßnahmen vielleicht noch nicht nachgewiesen ist, heißt es nicht,
Doch das Fehlen von Daten wird in verschiedene Richtungen interpretiert. So lesen Stimmen, die den Coronamaßnahmen gegenüber eher kritisch eingestellt sind, das Bekenntnis genau umgekehrt: Die fehlenden Daten seien nicht zwangsläufig ein Zeichen dafür, dass die Maßnahmen wirken würden.
Die Schlussfolgerung, die die »Bild« zieht, wird sich deshalb wohl oder übel im Gedächtnis einiger Menschen festsetzen. Das könnte besonders schwerwiegende Folgen haben, wenn Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Maskentragen und Impfungen (letztere werden im Bericht gar nicht beleuchtet) wieder nötig werden, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.
Gleichzeitig landen wieder mehr Menschen mit einer
Fazit: Scheitern mit Ansage
Der Sachverständigen-Bericht wird unterm Strich wohl keine große Hilfe für die Pandemiebekämpfung sein. Das liegt nicht nur an den Sachverständigen, die ihre Arbeit unter denkbar ungünstigen Bedingungen machen mussten.
Die politisch Verantwortlichen haben es versäumt, eine wissenschaftlich fundierte Evaluation seit Beginn der Pandemie mitzudenken. Statt Hals über Kopf einen Sachverständigenrat zu beauftragen, wäre es das Mindeste gewesen, das Gremium ausgewogen zu besetzen und es mit ausreichend Personal und Geld auszustatten. Ein wissenschaftlich aussagekräftiger Bericht hätte schließlich noch in einem Peer-Review-Verfahren durch andere
Nur so funktioniert gewissenhafte, durch Fakten gestützte Evaluation, schließlich geht es hier nicht um irgendeine Erkältungswelle. Tausende Studien von zwar kompetenten, aber ohnehin schon sehr beschäftigten Ehrenamtlichen nach Feierabend sichten zu lassen, wirkt da angesichts der Pandemiefolgen beinahe lächerlich.
Bei aller Kritik hat der Bericht aber vor allem eines gezeigt: Wissenschaft braucht Zeit, Geld – und Daten. Zumindest auf die letzte dieser Forderungen hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach reagiert und angekündigt, dass im Herbst eine bessere Datengrundlage geschaffen werden soll. Ein kleiner Erfolg, auch ohne Streik – den zukünftige Teams von Gutachter:innen vielleicht trotzdem in Erwägung ziehen sollten.
Mit Illustrationen von Frauke Berger für Perspective Daily