+++Eilmeldung: Bei dir ist der Groschen gefallen+++
Noch sind die meisten Medien unsicher, wie sie im Internet Geld verdienen können. Experimentiert wird viel. Wie aussichtsreich ist das Modell, auf das du setzt?
»Information will frei sein.« Diesen Satz
Früher konnten Medien weitestgehend bestimmen, welche Informationen frei verfügbar waren. Journalisten galten als »Gatekeeper«, also Torwächter, die entscheiden, was reinkommt und was draußen bleibt. Heute sind Journalisten eher »Gatewatcher«, sie beobachten, wer durchs Tor geht, und bieten Lesern, Hörern und Zuschauern ihre Zusammenfassung und Einordnung an. Klar, dass an diesem Informationstor möglichst unbestechliche Sicherheitsleute positioniert sein sollten. Dafür brauchen sie eine fachliche Ausbildung und vor allem eines: Zeit.
Mit anderen Worten: Es ist an der Zeit, zu fragen, wie Journalismus finanziert werden kann und soll.

Wie das Internet ein Geschäftsmodell sprengte
Als Mitte der 1990er-Jahre in immer mehr Privathaushalten die Modems zu fiepen begannen, erkannten die
Dass dieser Anteil überhaupt auf 6% angestiegen ist, liegt an
Frage: Sollten wir also versuchen, Journalismus vor den Fängen des Kapitalismus zu schützen?
Öffentlich-rechtlich, praktisch, gut?
»Ich habe den freien Markt fürs Erste aufgegeben«, sagt Marcus von Jordan. Der Gründer des Portals
Bei der Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Medien handelt es sich nicht um direkte Staatsfinanzierung, wie es bei der
Nun stehen die Anstalten nicht gerade im Ruf, die Gebühren, die im Jahr
Eine relativ offensichtliche Idee wäre, dass das Öffentlich-Rechtliche aufhört, seine 8 Milliarden Euro nur nach innen zu investieren, sondern nach und nach agiler nach außen. Das heißt nicht, dass sie gar nichts mehr selbst investieren sollen, sondern die neuen Dinge, die sie anfangen, dezentral zu investieren.
Das passiert derzeit beim neuen gemeinsamen Jugendkanal von ARD und ZDF, Funk. Dabei profitieren vor allem kleine, freie Akteure, die auf Honorarbasis Inhalte liefern, vom üppigen Etat. »Funk«, sagt Jordan, »schafft nicht neue, unagile Strukturen, sondern versucht, agil zu bleiben.«
Für neue Formate hat Marcus von Jordan eine eigene Idee: Seit der
Im öffentlich-rechtlichen Modell lassen sich viele Vorteile finden, die dem besonderen Wert von Journalismus für die Gesellschaft gerecht werden. Allerdings wird dieses Modell immer nur für einen Teil der Medien taugen, weil eine Einstiegshürde bleibt: Wer bestimmt, welche Medien in den Genuss dieser Finanzierungsquelle kommen? In einer freiheitlichen Gesellschaft muss es möglich sein, abseits dieses Konzepts Journalismus zu betreiben.

Ist gemeinnütziger Journalismus für alle nützlich?
Bleiben wir noch kurz beim Gedanken, Journalismus sollte vor den Gesetzen des Marktes geschützt werden – und das ohne einen öffentlich-rechtlichen Apparat.
Gemeinnützigkeit hätte den Vorteil, dass auf Abos und Verkäufe keine Mehrwertsteuer fällig wäre und dass Spenden attraktiv wären, weil sie zu Steuerersparnissen führen würden. Der Geschäftsführer der taz, Karl-Heinz-Ruch,
Freilich, diese Konkurrenz würde entfallen, wenn alle Medien über Nacht gemeinnützig wären. Allerdings lässt sich nicht jedes publizistische Erzeugnis mit dem Gemeinwohl rechtfertigen – es dürfte mitunter schwierig werden, die Grenze zu ziehen: Dient die Freizeitwoche dem Allgemeinwohl? Die Landlust? Die Bild-Zeitung? Der Stern?
Gemeinnützigkeit kann für einen Teil der Branche tatsächlich eine vielversprechende Option sein – für die gesamte Branche muss es noch andere Lösungen geben.
Um einen Schlussstrich unter diesen Exkurs zu ziehen: Das öffentlich-rechtliche und das gemeinnützige Modell funktioniert für manche Medien. Aber nicht für alle. Es muss weiterhin auch die Möglichkeit geben, als freies und unabhängiges Unternehmen Journalismus zu betreiben und so zu einer wirklichen Medien-Vielfalt beizutragen. Diesen Gedanken sollten wir nicht begraben, nur weil es seit etwa 20 Jahren mit dem Internet einen neuen Vertriebsweg und
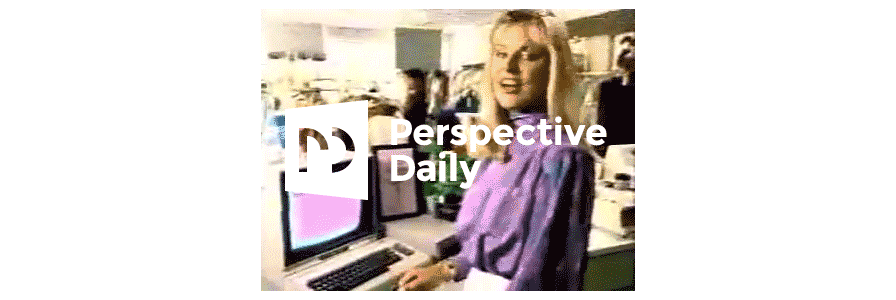
Journalismus zwischen Werbebannern und im Schafspelz
Die meisten privaten Medienunternehmen finanzieren sich nicht rein über das eine oder das andere Modell, sondern mischen verschiedene Konzepte. Beginnen wir unsere Betrachtungen beim Nervigsten: der Werbung.
Die Zeitungsbranche war schon immer gewohnt, neben ihren Inhalten Platz für Werbekunden zu schaffen. Nicht zufällig landete die Anzeige einer Bank im Wirtschaftsteil, die eines Autobauers auf der Auto-Seite. Das bringt dem Werbekunden noch nicht automatisch Einfluss auf das Redaktionsgeschehen, aber manchmal bieten Verlage treuen Kunden ein besonders gutes Anzeigenumfeld in Sonderbeilagen an.
Eine empirische Studie, die 2008 im Branchenmagazin Fachjournalist
Dieses Spannungsfeld wurde bald auch ins Digitale übertragen: Für reichweitenstarke Nachrichtenportale war es anfangs relativ leicht, im Netz Geld zu verdienen, indem man den Lesern neben dem eigentlichen Inhalt auch bezahlte Werbung vorlegt. Allerdings waren dort die Erlöse schon immer schlechter als im Print – weil extrem viele Websites als potenzielle Werbefläche infrage kommen und weil die Aufmerksamkeit der Nutzer hier geringer ist. Heute wankt dieses Geschäftsmodell, weil viele Besucher gar nicht mehr über die Startseite zu Artikeln kommen, sondern über soziale Medien. Oder dort nur noch die Überschrift lesen und gleich weiterscrollen. Zudem benutzen viele User
Deshalb wird für einige Portale das sogenannte »Native Advertising« immer attraktiver: Statt aufdringlich blinkender Banner tauchen in der Artikelübersicht gesponsorte Inhalte auf, die zwar als solche gekennzeichnet sind, in ihrer Aufmachung jedoch genauso aussehen wie redaktionelle Inhalte. Die früher hochgehaltene Trennung von Werbung und Redaktion ist damit komplett hinfällig,
Neben dem Einfluss der Werbekunden – unabhängig davon, wie groß er tatsächlich ist – kann man dem werbefinanzierten Journalismus vor allem vorwerfen, dass er stärker als andere auf Reichweite schielen muss, um angemessene Erlöse zu erzielen. Und je unzuverlässiger die Werbeeinnahmen künftig werden, desto eher steht dieses Finanzierungsmodell in Zukunft ganz auf der Kippe.

Wenn du nicht zahlst, zahlt jemand anderes
Das klingt erst einmal wie ein Lichtblick: Nicht alle Medien sind darauf angewiesen, eigenständig schwarze Zahlen zu erwirtschaften. Die
The Guardian, eines der wichtigsten Qualitätsmedien Großbritanniens, schreibt seit Jahren tiefrote Zahlen und überlebt aktuell nur dank einer Stiftung namens »Scott Trust«, in der das Blatt in besseren Zeiten seine
Einerseits klingt es für die Redaktionen komfortabel, unpopuläre Themen aufbereiten zu können, während jemand anderes am Ende die Gehälter zahlt. Andererseits sind sie so den Geldgebern – egal ob unter dem eigenen Konzerndach oder von außen – auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Was, wenn sich der Betreiber von Job- und Immobilienportalen eines Tages überlegt, die Bilanz aufzuhübschen, indem er nicht lukrative Konzernbereiche abstößt?
Querfinanzierung ist das Eingeständnis des Scheiterns und führt uns zurück zur Überlegung, ob Journalismus in der privaten Wirtschaft wirklich chancenlos ist.
Die gute Nachricht: Wir haben eine Erlösquelle bislang ausgelassen. Nämlich diejenigen, die vom Journalismus direkt profitieren. Die Leser selbst.
Tausende Leser sind die sicherste Bank
Seitdem es gedruckte Zeitungen gibt, ist selbstverständlich, als Leser einen Preis dafür zu zahlen. (Von Ausnahmen wie Bordexemplaren und kostenlosen Wochenblättern einmal abgesehen.) Dass viele Verleger unter dem Fiepen der heimischen Modems die Büchse der Pandora öffneten und ihre Inhalte online kostenlos anboten – in der Hoffnung, dass das Internet als verlängertes Schaufenster für kostenpflichtige gedruckte Ausgaben dient – ist nicht mehr umkehrbar.
Vor einem ähnlichen Problem stand auch die Musikbranche, als Plattformen wie Napster zu mp3-Tauschbörsen wurden und immer mehr Hörer sich abgewöhnten, für Musik zu zahlen. Dieser Trend ist mittlerweile umgekehrt: Heute zahlen mehr als
Nachrichten hingegen werden vermutlich auch weiterhin kostenlos bleiben. Parallel entwickelt sich aber langsam die Bereitschaft, für ausführliche Hintergründe und aufwendige Erzählformen zu zahlen. Den digitalen Leser zur Kasse zu bitten, »wird immer mehr zur Branchenlösung«, sagt Holger Kansky, Digital-Referent des BDZV.
Wie diese Bezahlweise gestaltet ist, ist von Medium zu Medium unterschiedlich: Einige Anbieter, dazu zählt auch
Ein Sonderfall bei der

Allerdings ist es gerade zu Beginn sehr mühsam, sich einen Leserstamm aufzubauen – statt weniger Werbekunden oder Financiers müssen sehr viele Menschen überzeugt werden, Geld – und damit Vertrauen – in ein Produkt zu stecken.
Wir Journalisten sind bereit – ihr Leser auch?
Es scheint, als müssten wir Journalisten uns diese Bereitschaft gerade ein bisschen neu verdienen. Es ist eine Polarisierung zu beobachten: Online, TV, Radio, Boulevard- und Qualitätszeitungen gelten als unterschiedlich seriös. Ein Teil der Gesellschaft vertraut Medien immer weniger,
Fassen wir also zusammen:
Ein Medium, das von seinen Lesern getragen wird,
- hat agilere Strukturen als öffentlich-rechtliche,
- ist kompetitiver als gemeinnützige,
- ist unabhängiger als werbefinanzierte,
- steht auf stabileren Füßen als querfinanzierte Medien.
Das einzige, was der Leser dafür in Kauf nehmen muss, ist der Preis. Vielleicht kommt es bei der Aussage aus dem Silicon Valley also am Ende wie so oft auf die Perspektive an: »Information will frei sein.« Zumindest, wenn es darum geht, Information möglichst frei von Einflüssen zu halten. Das fällt nicht vom Himmel, sondern ist ein aktiver Prozess, für den eine Gesellschaft sich Informations-Befreier leisten sollte. Wenn jeder ein bisschen gibt, ist der Preis dafür gar nicht hoch.
Mit Illustrationen von Robin Schüttert für Perspective Daily

