Zusammen schaffen wir es: Diese 7 Genossenschaften machen die Welt ein bisschen besser
Du willst den Mietwahnsinn stoppen, bestimmen, was dein Supermarkt verkauft, und die Verkehrswende voranbringen? Dann bist du hier richtig.
Du willst dir endlich den Traum vom eigenen Café erfüllen, aber es fehlt dir an Startkapital? Die Miete frisst den Großteil deines Einkommens und du hast keine Lust mehr, Investoren die Taschen zu füllen? Statt der faden Tomaten im Großstadt-Supermarkt hättest du gern regelmäßig frisches Gemüse direkt von fair bezahlten Landwirten, weißt aber nicht, woher du das bekommen sollst?
»Was dem Einzelnen nicht möglich ist, vermögen viele«, dachte sich Ende des 19. Jahrhunderts schon Als Bürgermeister der Bürgermeisterei Flammersfeld mit insgesamt 33 Ortschaften stand er vor der Herausforderung, die vielen kleinen Landwirte an den Fortschritten der Industrialisierung teilhaben zu lassen. Ein Problem ärgerte ihn besonders: Die Bauern ließen sich von Viehhändlern zu oft über den Tisch ziehen und kauften zu überteuerten Preisen – auf Kredit mit überhöhten Zinsen.
Was ist eine Genossenschaft?
In Genossenschaften schließen sich Menschen zusammen, um gemeinsam zu wirtschaften. Sie sind zugleich Eigentümer und Kunden ihrer Genossenschaft – mit garantierten Mitspracherechten. Im Vordergrund des Zusammenschlusses steht nicht Gewinnstreben, sondern die Förderung der Mitglieder und das solidarische Miteinander.
Raiffeisen gründete den Flammersfelder Hilfsverein zur Unterstützung unbemittelter Landwirte, der auf dem Prinzip beruhte, nach dem Genossenschaften noch heute funktionieren. Die Mitglieder legten in dem Verein ihr Geld zusammen, konnten es sich zum Kauf von Vieh und modernen Geräten dafür aber auch günstig von der Gemeinschaft leihen. Dadurch übernahm jeder für den anderen Verantwortung. Aus Einzelkämpfern wurde eine solidarische Gemeinschaft.
Knapp 2 Jahrhunderte später ist seit dem Jahr 2016 ist die Genossenschaftsidee sogar immaterielles
Und heute ist sie aktuell wie nie: viele Menschen wünschen sich mehr Teilhabe und Gestaltungsmöglichkeiten. Wir stellen dir 7 Genossenschaftsideen vor, die den Problemen unserer Zeit mit mehr Gemeinschaft entgegentreten.
Solidarität im Supermarkt
von Katharina WiegmannDer beste Einkauf ist der, der schnell erledigt ist und wenig kostet. So denke nicht nur ich: Im Jahr 2017 erwirtschafteten allein die Lebensmitteldiscounter in Deutschland laut In deutschen Städten kann ich an jeder Ecke günstig einkaufen.
Aus dieser Perspektive scheint es erst mal etwas wunderlich, dass sich die 17.000 Kunden eines Supermarkts im New Yorker Stadtteil Brooklyn sogar selbst hinter die Kasse stellen und Regale einräumen, Du ahnst es schon: Sie sind nicht nur Kunden. Sie sind gleichzeitig auch die Besitzer der
Sie bestimmen, was in den Regalen landet, ob Umweltschutz, Nachhaltigkeit und kurze Lieferwege dabei eine Rolle spielen – und welche Preise am Ende für die Produkte und an ihre Produzenten bezahlt werden. Wenn Verbraucherinnen die Macht übernehmen, können sie über all das selbst entscheiden.
ähnliche Projekte, die auf Mitgliedschaften beruhen, aber nicht zwingend genossenschaftlich organisiert sind, wie zum Beispiel die LPG BioMärkte, gibt es schon seit Jahren. Und aktuell ist ein Supermarkt mit DDR-Geschichte wieder auf Expansionskurs: die Konsumgenossenschaft Leipzig,
Potenzial haben Konsumgenossenschaften übrigens vor allem auch dort, wo nicht an jeder Ecke ein Discounter steht – in ländlichen Regionen.
Wieder lernen, woher das Essen kommt: Solidarische Landwirtschaft
von Lara MalbergerDa es noch nicht genügend genossenschaftlich organisierte Supermärkte gibt, bleiben Dumpingpreise bei Obst und Gemüse ein großes Problem für Landwirte: Denn der Druck, möglichst günstig zu produzieren, wirkt sich auf die Produktionsbedingungen aus.
will das ändern: Private Haushalte tragen gemeinsam die Kosten eines landwirtschaftlichen Betriebs – und erhalten im Gegenzug die Ernteerträge. Die Solawis sind dabei auf verschiedene Weise organisiert, je nachdem, wie groß die Gruppe und der Betrieb sind. Die erste Genossenschaft gründeten Simon Scholl und sein Kollege Daniel Überall im Jahr 2012 mit dem in München.

Für die Mitgliedschaft in der Genossenschaft und ihren Anteil an der Ernte – – beteiligen sich die Mitglieder des Kartoffelkombinats Die Mitarbeit ist freiwillig, wer will, kann sich etwa als Erntehelfer oder Kistenverteiler einbringen, wer keine Zeit dafür hat, ist zu nichts verpflichtet. »Wir denken das Konzept etwas betriebswirtschaftlicher«, sagt Scholl, der mittlerweile andere bei der Gründung ihrer Solawigenossenschaft berät. Während kleinere Solawis oft nur einen Teil der Einnahmen eines landwirtschaftlichen Betriebs abdecken, finanzieren die Genossenschaften oft ganze Höfe. »Damit eine Solawigenossenschaft wirtschaftlich ist, braucht sie, je nach Konzept und Region, mindestens 300–350 Mitglieder«, sagt Scholl. Sonst würde es für den Einzelnen zu teuer – oder es könnten keine fairen Löhne mehr an die Mitarbeiter der Höfe gezahlt werden.
Die Mitglieder teilen sich die Kosten: vom Personal über die Logistik bis hin zum Saatgut und zur Wasserversorgung. Gleiches gilt für die Erträge. Das heißt: Fällt ein Teil der Ernte aus, bekommen die Mitglieder auch weniger Obst und Gemüse. »Wir tragen das Risiko auf allen Schultern«, sagt Scholl. Die Motivation der Mitglieder rühre vor allem daher, dass sie nicht mehr auf Kosten anderer leben wollen, weder auf Kosten schlecht bezahlter Landwirte noch auf Kosten der Natur.
Damit die Worte nicht fehlen
von Juliane MetzkerSich einen Weg durch das Bürokratieland Deutschland zu bahnen, kann schon anstrengend genug sein. Wie sollen aber Menschen hier am öffentlichen Leben teilhaben, die der deutschen Sprache (noch) nicht mächtig sind? Die Antwort auf die Frage hat die sich im Jahr 2015 aus einem Projekt Wuppertal gründete.
Die Genossenschaft unterstützt Geflüchtete und Migranten mit sogenannten Sprachmittlern, die unter anderem beim Gang zum Arzt, ins Jobcenter, beim Elterngespräch oder in der Ausländerbehörde vermitteln sollen. 18 Monate dauert der Qualifizierungskurs, an dem nur Menschen mit Migrationshintergrund teilnehmen können, die eine ausländische Muttersprache mitbringen. »Die sind bei uns Genossenschaftsmitglieder und können mitentscheiden«, erklärt der bundesweite Netzwerkkoordinator Matthias Schug am Telefon.
SprInt ist aus einer Not geboren. In Deutschland fehlen qualifizierte Sprachmittler in allen Bereichen, vor allem in der Flüchtlingsvermittlung. Letztes Jahr wurde beispielsweise bekannt, dass das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge (kurz: BAMF) Dabei komme es bei der Vermittlung nicht allein auf die Sprache an, meint Schug: »Professionelle Sprachmittelnde wahren ihre Distanz und schlagen sich nicht auf eine Seite.« Das müssen sie aber erst einmal lernen.
Der Beruf der Sprachmittlerin ist in Deutschland im Gegensatz zur Schweiz nicht anerkannt. Deshalb fehlt die professionelle Infrastruktur, die auch Ehrenamtliche nicht auffangen können. Nach Wuppertal will SprInt nun einen zweiten Standort in Berlin eröffnen.
Hier entscheidest du, wie viele Autos in der Stadt fahren
von Benjamin FuchsMit Genossinnen und Genossen gegen die überfüllten Innenstädte kämpfen und zugleich die Umwelt schonen: Das möchte in Lübeck und Kiel. Das Carsharing-Unternehmen besitzt 185 Autos, die an festen Stationen in den Stadtgebieten ausgeliehen werden können. Stattauto gibt es schon seit dem Jahr 1991. »Die Genossenschaft will keine Rendite erwirtschaften, wir sind eine solidarische Nutzergemeinschaft«, sagt mir Vorstand Hinrich Kähler am Telefon. Die Überschüsse flössen wieder in die Flotte.
Das Besondere an Stattauto ist: Jede Kundin und jeder Kunde kann auch Teilhaberin bzw. Teilhaber sein und mitentscheiden, wie es mit dem Unternehmen weitergeht.
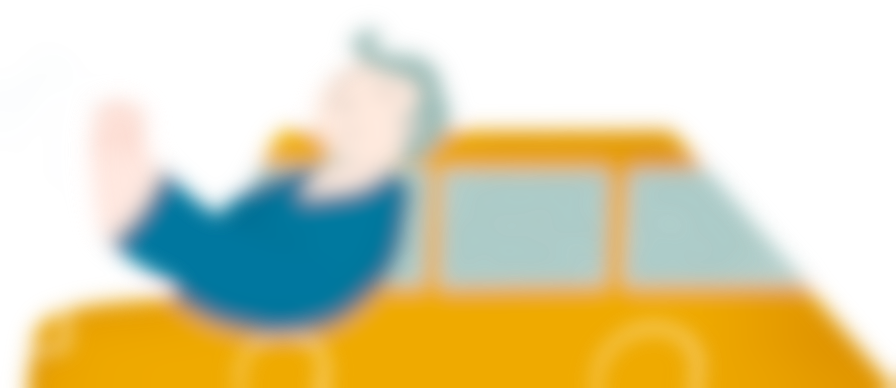
Gestritten wird immer wieder darüber, ob Carsharing nun die Umwelt entlastet oder nicht. Die Antwort hängt mit dem Geschäftsmodell zusammen. Die Wagen von Stattauto stehen auf festen Stellplätzen und müssen auch wieder dorthin zurück, ein stationäres Modell. Ein anderer Ansatz heißt »Free-Floating«. Dabei finden Nutzerinnen die Autos per App und stellen sie anschließend wieder auf irgendeinem Parkplatz ab. Größter Anbieter ist Share Now, ein Joint-Venture von BMW und Daimler.
Die Überraschung: Laut einer Studie hat nur jeder vierte Nutzer eines stationären Anbieters zusätzlich ein eigenes Auto, bei Free-Floatern ist es jeder zweite – Stationäres Carsharing entlastet also Innenstädte und Umwelt, Laut Stattauto ist das Verhältnis unter den eigenen Nutzerinnen sogar noch besser: »80% haben kein eigenes Auto«, sagt Hinrich Kähler. Um Umweltschutz bewusst zu fördern, ist die Mitgliedschaft günstiger für diejenigen, die eine Monatskarte für den öffentlichen Nahverkehr besitzen.
Genossenschaft macht Schule
von Chris VielhausVor 10 Jahren habe ich mein Abitur gemacht. Im Gegensatz zu manch anderen erinnere ich mich gern an meine Schulzeit zurück – Mathestunden einmal ausgenommen. Mein besonderes Highlight war der Sozialkundeunterricht. Der Stoff: Klimawandel, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Kein anderes Fach hat mich rückblickend so sehr beeinflusst wie diese 2 Wochenstunden.
Nicht auf dem Lehrplan stand, wie ökologisches und arbeitnehmerfreundliches Wirtschaften ganz praktisch in Unternehmen aussehen kann. Eine Schülergenossenschaft wäre da wahrscheinlich genau das Richtige gewesen. »Eine Schülergenossenschaft funktioniert wie ein echtes wirtschaftliches Unternehmen.
In der Genossenschaft lernen die Schülerinnen und Schüler, ihr Unternehmen demokratisch zu organisieren und das Mitbestimmungsrecht jedes Mitglieds zu berücksichtigen. Die konkreten Projekte der bundesweit 160 Schülergewerkschaften sind vielfältig: bis hin zu Berufsschülern für Chemielaboranten, die Wasseranalysen durchführen. Was alle gemein haben, ist, dass »moderne Werte« hochgehalten werden sollen, wie Asmus Schütt betont: »Nachhaltigkeit im ökologischen und sozialen Sinne spielt hier eine große Rolle. Wenn eine Schülergenossenschaft zum Beispiel einen Pausenkiosk betreibt, achten die Schüler darauf, dass sie fair gehandelte oder Bio-Produkte anbieten und sich über deren Herkunft Gedanken machen.« Was die Schülerinnen und Schüler dann mit ihren Umsätzen anstellen, ist übrigens ihnen selbst überlassen.
Musik für alle
von Dirk WalbrühlDie älteren Damen vom Gesangsverein aus Fahrdorf staunten nicht schlecht, Sie sollten zahlen, Dazu aufgefordert hatte sie die Die verwaltet seit dem Jahr 1933 den Großteil aller Musikstücke in Deutschland – von Popsongs über Opern bis hin zu Werbejingles – und kann für ihre öffentliche Nutzung zur Kasse bitten. Deshalb wurde der Damenchor aus Fahrdorf zur Kasse gebeten, da ihre Singstunden in einem Café als Auftritt gewertet wurden – bis die GEMA einen Rückzieher in letzter Sekunde machte.

20 Musikrebellen wollen nun das Monopol der GEMA brechen und haben dazu die Cultural Commons Collecting Society (kurz: C3S) gegründet, eine Genossenschaft für Musiker im digitalen Zeitalter. Ihr Herzstück ist eine Software, die mithilfe künstlicher Intelligenz lizenzierte Musik automatisch erkennt. Wird sie an Orten, die Musik abspielen, installiert, könnte die Genossenschaft mit minimalem Verwaltungsaufwand minutengenau zugunsten der Musikerinnen und Musiker abrechnen –
Dazu geht es der Cultural Commons Collecting Society vor allem um die Freiheit der Kunstschaffenden. Diese sollen – ganz anders als bei dem »Ein Modell für alle«-Ansatz der GEMA – frei entscheiden dürfen, wie ihre Musik vermarktet wird, etwa auch unter einer freien Creative-Commons-Lizenz, die Und wer als Fan einzelne Musikerinnen und Musiker unterstützen will, kann das über ein
Aktuell ringt die C3S noch mit dem Deutschen Patent- und Markenamt um die Details der Zulassung – Währenddessen sammelt die Genossenschaft schon Künstler, die sich dieser Art der Verwertung anschließen wollen, und arbeitet an einem Finanzierungskonzept. Bisher arbeiten die Musikrebellen nämlich alle ehrenamtlich.
Neuer Wohnraum: Bezahlbar, nachhaltig, sozial
von Paulina KretschmarZahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigen: Um den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland zu decken, hätten Vergangenes Jahr wurden deutschlandweit gerade einmal

In Münster arbeitet die im Jahr 2016 gegründete an einem Lösungsansatz, der sich schon vielfach bewährt hat: Sie will einfach selbst bauen – und zwar ein Mehrgenerationenhaus mit Platz für 250 Menschen. sagt der Sprecher der Genossenschaft, Thorsten Liebold. Entstehen soll zum Beispiel ein großer Speiseraum – die Lobby soll als gemeinsames Wohnzimmer fungieren.
sind sie verpflichtet, in kleinere Räumlichkeiten innerhalb des Mehrfamilienhauses umzuziehen. So wollen die Genossinnen und Genossen dafür sorgen, dass der begrenzte Platz optimal genutzt wird. Ein weiteres Anliegen der Genossenschaft Grüner Weiler ist das Thema Nachhaltigkeit. Das Gebäude soll so ökologisch werden,
Noch hat die Genossenschaft kein Grundstück, beworben hat sie sich aber schon. Thorsten Liebold hofft, im kommenden Jahr die Zusage der Stadt zu erhalten. Damit würde das Projekt in die Fußstapfen bereits So hat sich auch der Grüne Weiler maßgeblich in Zürich inspirieren lassen.
Mit Illustrationen von Mirella Kahnert für Perspective Daily


