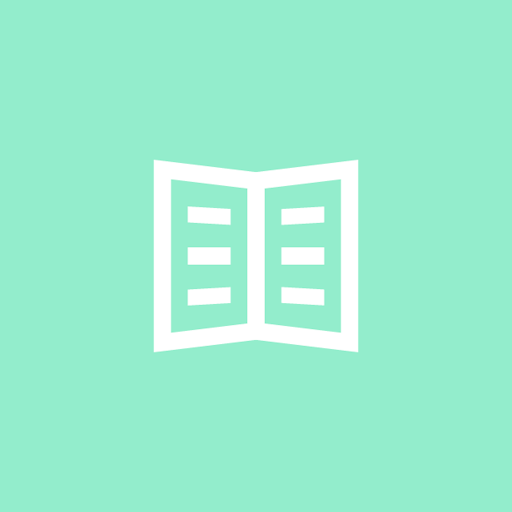Wohin mit dem deutschen Atommüll?
Bis 2031 soll er gefunden sein: der Ort, an dem Deutschlands Atommüll für Millionen Jahre sicher lagern kann. Doch obwohl alle mitbestimmen dürfen, interessiert sich heute kaum noch jemand dafür. Woran liegt das?
Tausende Behälter mit Atommüll unter deiner Stadt. Klingt nach Science-Fiction? Könnte aber wahr werden. Denn derzeit wird in Deutschland der Ort gesucht, an dem unser hochradioaktiver Müll am sichersten aufgehoben ist. Und theoretisch könnte das eben auch in 500 Meter Tiefe unter deinem Haus sein.
1.900 Behälter mit
Du willst wissen, was genau in diesen Behältern ist, das so gefährlich ist?
Dann klicke hier!
Atommüll ist besonderer Müll, weil er strahlt. Wir können diese Strahlung nicht sehen oder fühlen, aber sie kann sehr schädlich sein. Je nachdem, wie stark die Strahlenbelastung ist, unterscheidet man in schwach-, mittel- und hochradioaktive Abfälle. Hochradioaktive Abfälle, meist verbrauchte Brennelemente aus Kernkraftwerken, machen nur einen geringen Anteil des deutschen Atommülls aus. Dafür sind sie besonders »aktiv«, das heißt, beim Zerfall der Stoffe entsteht besonders viel Strahlung und auch Wärme. Sie werden daher in speziellen Behältern, den Castoren, aufbewahrt, die die Strahlung abschirmen. Das Krasse ist: Einige der hochradioaktiven Stoffe bleiben für mehr als eine Million Jahre aktiv. So lange soll daher auch das Endlager halten.
Eine Mammut-Aufgabe für Deutschland
Die Suche nach einem Atommüll-Endlager ist eine beispiellose Aufgabe, die über politische Lager und das Denken in Legislaturperioden hinausgeht. Die Entscheidung, die wir treffen, wird möglicherweise unsere Demokratie überdauern. In jedem Fall wird sie viele nachfolgende Generationen betreffen. Wie genau die Suche ablaufen soll, wurde 2013 im
Mit dem Standortauswahlverfahren soll in einem partizipativen, wissenschaftsbasierten, transparenten, selbsthinterfragenden und lernenden Verfahren für die im Inland verursachten hochradioaktiven Abfälle ein Standort mit der bestmöglichen Sicherheit für eine Anlage zur Endlagerung nach Paragraf 9a Absatz 3 Satz 1 des Atomgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland ermittelt werden.
Ob das Verfahren diesen Ansprüchen gerecht wird, wird sich im Laufe der kommenden Jahre zeigen. Fest steht: Es wird Betroffene geben. Irgendeine Kommune wird es treffen.
Um am Ende eine möglichst große Akzeptanz für die Entscheidung zu erlangen, muss das Verfahren die Bevölkerung von vornherein mit einbeziehen. Und darin liegt momentan die größte Herausforderung.
Solange niemand betroffen ist, interessiert sich auch niemand
Oktober 2019. Die Nachrichten sind voll von der Klimakrise. Fridays for Future fordert den Kohleausstieg. Und so wird auch die Debatte um den Atomausstieg wieder aufgewärmt. Stimmen werden wieder lauter, die sagen, dass wir uns zu früh von der vergleichsweise klimafreundlichen Kernkraft verabschiedet hätten. Das Thema Atommüll wird in den meisten dieser Beiträge ausgespart. Derweil versucht eine kleine Ausstellung im Berliner Hauptbahnhof, über die Endlagersuche aufzuklären. Auf einem riesigen schwarz-gelben Strahlenwarnzeichen stehen leuchtende Schautafeln mit Fotos und Infotexten zur Endlagersuche. Eine der Schautafeln zeigt eine quietschgelbe Deutschlandkarte. Darauf verstreut, ein paar schwarze Kegel. Sie sollen mögliche Standorte für ein Endlager symbolisieren. »Ene mene muh …« steht darüber – es kann jeden treffen.
Die mobile Ausstellung ist der Versuch, die mit ratternden Rollkoffern vorbeihastenden Passanten für eine Problematik zu interessieren, von der sie sich wahrscheinlich nicht betroffen fühlen: den deutschen Atommüll und seinen Verbleib. Ein paar Menschen bleiben stehen, schauen sich die Ausstellung kurz an. Doch die meisten eilen einfach vorbei.
Organisiert hat die Ausstellung das Bundesamt für die Sicherheit nuklearer Entsorgung (BASE).
Wenn du dir erst mal einen Überblick über die wichtigsten Akteure und ihre Aufgaben verschaffen möchtest,
klicke hier!


Das Who-is-who der Endlagersuche
- Das Bundesumweltministerium (BMU) trägt die politische Gesamtverantwortung für das
- Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ist die Vorhabenträgerin. Das öffentliche Unternehmen ist für das operative Geschäft des Verfahrens zuständig. Momentan sind dort unter anderem etwa 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Auswertung der geologischen Daten beschäftigt.
- Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) beaufsichtigt und kontrolliert das Verfahren. Es bewertet die Ergebnisse der BGE und
- Das Nationale Begleitgremium (NBG) ist sozusagen der eingeplante kritische Begleiter. Das Gremium setzt sich aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und zufällig ausgewählten Bürgervertretern zusammen und soll das Verfahren unabhängig begleiten – mit Blick auf das Gemeinwohl. Eine absolute Neuheit in der deutschen Gesetzgebung.
- Es gibt auch noch einen Partizipationsbeauftragten.

Wo soll das Endlager nur hin? Eine Ausstellung des BASE zur Endlagersuche mitte Oktober am Berliner Hauptbahnhof. – Quelle: Leonie Sontheimer
Was im vergangenen Herbst im Kleinen im Berliner Hauptbahnhof zu beobachten war, lässt sich verallgemeinern: Die Menschen sind zu beschäftigt, um sich für etwas zu interessieren, von dem sie sich nicht angesprochen fühlen. Das Paradoxe: Eine Region in Deutschland wird betroffen sein und den Atommüll lagern müssen. Und ziemlich sicher wird sie nicht begeistert sein.
»Es ist auch eine ethische Frage. Wir haben uns um diesen Müll zu kümmern.« – Wolfram König, Leiter des Bundesamts für kerntechnische Entsorgungssicherheit
Kein Mensch möchte hochradioaktiven Atommüll unter seinem Garten haben, vermutlich wird sich keine Gemeinde freiwillig melden. Auch wenn die Sicherheit aller Beteiligten die oberste Priorität des Verfahrens ist – es bleibt eine diffuse Angst davor, dass irgendwas schiefgeht,
NIMBY – Not in my Backyard
Der Bundestag hat sich 2013 – in den Nachwehen der Atomkatastrophe in Fukushima – dafür entschieden, das ungeklärte Atommüll-Problem nicht weiter aufzuschieben. Natürlich hätte eine Kommission einfach einen Standort festlegen können, um schnellstmöglich mit der Einlagerung beginnen zu können. Doch diese Vorgehensweise ist in Deutschland schon einmal gehörig gescheitert: Als in den 70er-Jahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden wurde, den Salzstock im niedersächsischen Gorleben zu einem Endlager auszubauen, formierte sich in der Region

Aus den Fehlern, die in Gorleben gemacht wurden, hat die Politik gelernt: Wenn die Entscheidung für einen Standort akzeptiert werden soll, muss die Bevölkerung von Anfang an beteiligt sein. Deswegen sind im Standortauswahlgesetz einige Beteiligungsmöglichkeiten vorgesehen. Die Frage ist, ob diese ausreichen werden, um Akzeptanz für die finale Entscheidung zu schaffen.
Wie genau wird die Beteiligung aussehen? Wer darf sich beteiligen? Und inwiefern fließt diese Beteiligung in die Entscheidung für einen Standort ein? Hier ein Überblick:
Die Beteiligungsmöglichkeiten
Folgende Beteiligungsmöglichkeiten sieht das Gesetz vor:
- Die Beteiligung der Bevölkerung wurde durch das Standortauswahlgesetz bereits in die DNA eines zentralen Akteurs geschrieben: Im Nationalen Begleitgremium sollen stets
- Sobald im Herbst 2020 der Zwischenbericht vorliegt, der Gebiete festlegt, die theoretisch für ein Endlager infrage kämen, ruft das BASE die Fachkonferenz Teilgebiete ein. Eingeladen sind Kommunalpolitiker, Wissenschaftler, NGOs – und Bürgerinnen und Bürger. In 3 Terminen innerhalb von 6 Monaten sollen die Teilnehmer der Fachkonferenz zunächst informiert werden und dann einen gemeinsamen Bericht verfassen, der in das weitere Verfahren
- Noch intensiver sind die Regionalkonferenzen, die in den Regionen eingerichtet werden, die übertägig erkundet werden sollen. Die Idee ist es, dort in einer Vollversammlung alle Menschen einzubinden, die in der Region leben. Ein Vertretungskreis von 30 Menschen soll dann wiederum deren Interessen vertreten. Unter anderem darf die Regionalkonferenz eine Nachprüfung beim BASE beantragen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch die Möglichkeit vorgesehen, dass Betroffene vor dem Bundesverwaltungsgericht gegen die Auswahl ihrer Region klagen können.
- Der Rat der Regionen soll die Prozesse der Regionalkonferenzen aus überregionaler Sicht begleiten. Er besteht aus Vertretern der einzelnen Regionen des Verfahrens sowie Regionen, in denen radioaktive Abfälle zurzeit zwischengelagert werden.
- Was für alle Bürgerinnen und Bürger jederzeit und schon jetzt zugänglich ist, sind Informationen. Das BASE veröffentlicht sämtliche Gutachten, Stellungnahmen und Berichte
Atommüll auf Social Media und Jutebeuteln
Das weiß auch Ina Stelljes. Sie leitet die Öffentlichkeitsarbeit des BASE. »Wir sind gerade erst im Aufbau, auch personell. Für Social Media haben wir kürzlich neue Leute eingestellt.» Grundsätzlich möchte Stelljes in der Öffentlichkeitsarbeit nicht nur das machen, »was man immer schon gemacht hat«, sondern auch Neues ausprobieren. Zum Beispiel Slogans wie »Schatz, bringst du bitte mal den Müll runter?«, mit dem Jutebeutel und Billboards bedruckt wurden.
»Wir haben gemerkt, dass man den Menschen bei dem Thema Atommüll durchaus auch ein bisschen Ironie oder Augenzwinkern zumuten kann.« – Ina Stelljes, Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des BASE
Aber die breite Öffentlichkeit bekommt kaum etwas davon mit. Es ist ein Dilemma: Solange der Standort nicht feststeht, interessieren sich die Bürger kaum für das Verfahren. Sobald allerdings Regionen feststehen, die infrage kommen, werden sich die Menschen aus diesen Regionen plötzlich interessieren. Und vor vollendeten Tatsachen stehen. Proteste sind quasi vorprogrammiert. Jochen Stay glaubt, dass das Verfahren aus diesem Dilemma nicht mehr rauskommt und gegen die Wand fahren wird.
Atomkraftgegner äußern fundamentale Kritik

Jochen Stay ist der Sprecher von Ausgestrahlt und vielleicht Deutschlands bekanntester Atomkraft-Gegner. Er ist jahrzehntelang mit der Anti-AKW-Bewegung auf die Straße gegangen und hat auf das ungeklärte Müllproblem hingewiesen. Ihm war immer klar, dass es ein Endlager braucht, und so begrüßte er 2013 den neuen Anlauf. Aber sehr bald stellte sich Enttäuschung ein: Das Verfahren sei top-down beschlossen worden statt bottom-up. Heute sagt er: »Wenn man Konflikte lösen möchte, ist eine wesentliche Regel, dass die Konfliktparteien am Anfang gemeinsam Spielregeln festlegen. Die Spielregeln für das Verfahren hat jedoch die Politik festgelegt. Deswegen befürchte ich, dass der Konflikt neu eskalieren wird, sobald es auf konkrete Orte zugeht.«
Die Bürgerbeteiligung komme zu spät und sei damit obsolet. Deshalb fordert Ausgestrahlt von der Politik einen erneuten Neustart: Erst solle die Bevölkerung beteiligt, dann ein neues Gesetz geschrieben werden. Rücksprünge sind zwar im Standortauswahlgesetz vorgesehen: Gleich Paragraf 1 sieht wie bereits oben erwähnt vor, dass das Verfahren auch selbsthinterfragend und lernend sein soll. Ein Sprung zurück vor das Gesetz, wie Ausgestrahlt ihn fordert, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Schließlich haben 2013 alle Parteien dem Gesetz zugestimmt.
2 Missionen, ein Problem
Das BASE und Ausgestrahlt sind sich einig, dass es ein Endlager für den deutschen Atommüll braucht und dass der sicherste Standort schnellstmöglich gefunden werden sollte. Während das BASE für das gesetzlich vorgeschriebene Standortverfahren wirbt, versucht Ausgestrahlt, Menschen für ein neues Verfahren zu mobilisieren. Beide sind im vergangenen Jahr mit ihrer Mission durch die Lande gereist und sahen sich mit dem gleichen Problem konfrontiert: Kaum jemand interessiert sich für die Endlagersuche.

September 2019, Bremen. Das BASE hat zu einem Info-Abend in den schicken Konferenzsaal des Radisson-Hotels eingeladen. Etwa 30 Interessierte sind gekommen, viele der rot-goldenen Stühle sind leer geblieben. »Wir wissen nicht, welche Räume wir mieten sollen, denn wir wissen nie, wie viele Menschen kommen werden«, erzählt Wolfram König, Leiter des BASE. Der 61-Jährige war zuvor bereits knapp 20 Jahre Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz; die Suche nach einem Endlager scheint seine Lebensaufgabe zu sein.
Durch 15 Landeshauptstädte ist König mit seinem Team getourt, um das Verfahren in die Öffentlichkeit zu bringen. Denn nur wer informiert sei, könne sich beteiligen. 2 Tage vorher, 2 Kilometer entfernt. Helge Bauer verbreitet in einem Kulturzentrum Skepsis. Bauer, ein Ausgestrahlt-Kollege von Jochen Stay, ist ebenfalls nach Bremen gekommen, um interessierte Bürgerinnen und Bürger über das Standortauswahlverfahren aufzuklären. »Wenn das Verfahren so transparent und partizipativ wäre, wie es Paragraf 1 vorsieht«, sagt Bauer, »müsste ich heute nicht hier sein.« Alle wesentlichen Entscheidungen seien bereits gefallen, die Beteiligungsmöglichkeiten ein Feigenblatt. Immer wieder erntet Bauer laute Schnauber aus den Stuhlreihen. Empörung liegt im Raum. 17 Zuhörer sind gekommen, auch hier sind viele Stühle leer geblieben.
»Wir sind auf Partizipation angewiesen.« – Wolfram König, Leiter des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung
Der Konflikt um die Karte
Der Konflikt zwischen dem BASE und Ausgestrahlt kristallisiert sich in einer fleckigen Deutschlandkarte heraus, die Bauer zu seinem Vortrag mitgebracht hat. Sie soll zeigen, auf welche Regionen sich die Endlagersuche wahrscheinlich konzentrieren wird. Basis für die Einschätzungen sind Daten über den geologischen Untergrund. Salz, Ton und Granit kommen laut Gesetz als Wirtsgesteine infrage. Regionen mit entsprechenden Vorkommen sind farblich hervorgehoben. Ausgestrahlt will mithilfe der Karte ermöglichen, dass sich Menschen aus diesen Regionen jetzt schon darauf einstellen können.
»Was Ausgestrahlt macht, ist ein einfaches Geschäftsmodell: Sie versetzen Leute in Unruhe«, sagt Wolfram König 2 Tage später im Saal des Hotels. »Wir machen das nicht.« Ein ziemlich herber Vorwurf an eine NGO, die sich über Spenden finanziert. Er zeigt, wie verhärtet die Fronten sind, auch wenn das niemand so recht zugeben möchte.
Während Bauer und seine Kollegen mit ihrer Deutschlandkarte durch die Lande reisen, betonen die Behörden immer wieder, dass sie von einer weißen Landkarte ausgehen, bis die Bundesgesellschaft für Endlagerung im kommenden Herbst den Zwischenbericht Teilgebiete herausgibt. Der wird Auskunft darüber geben, welche Regionen ausgeschlossen werden, weil sie
Wie fair die Standortsuche ablaufen wird und ob die einzelnen Schritte der nächsten Jahre auf Akzeptanz stoßen werden, hängt wesentlich davon ab, wie viele Menschen sich schon jetzt informieren und einbringen. Es ist natürlich zeitaufwendig, sich in die Materie einzuarbeiten. Nicht jeder wird dazu in der Lage sein. Aber wenn die Teilgebiete eingegrenzt sind, werden Menschen betroffen sein. Es wird dann an ihnen liegen, sich zu beteiligen. Doch wir sollten diese Menschen nicht allein lassen. Wir alle sollten schon jetzt die Endlagersuche mitverfolgen und über das Verfahren diskutieren. Aus Solidarität mit den Betroffenen, die heute schon leben. Und aus Solidarität mit den nachfolgenden Generationen. Lasst uns hier, in der Kommentarspalte, damit beginnen.
Mit Illustrationen von Mirella Kahnert für Perspective Daily