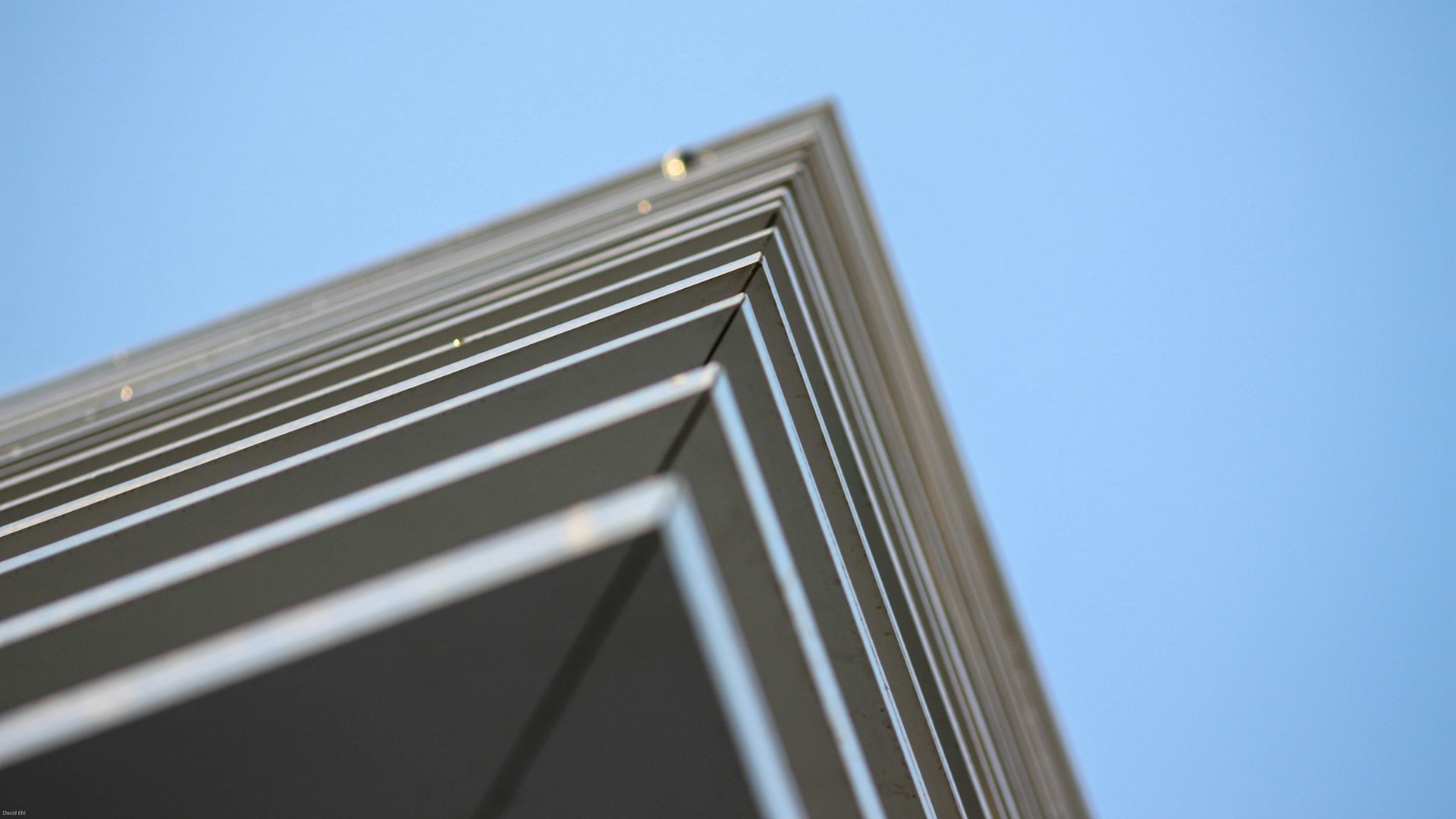City-Lofts für alle!
In deutschen Städten sind Wohnungen knapp. Dabei haben Architekten Lösungen parat – zu Land, zu Wasser und in der Luft. Sie gehen deutlich über »Zwei-Zimmer-Küche-Bad« hinaus.
Die Wohnungssuche führt hinaus aus dem Stadtzentrum, vorbei an einem Getreidefeld, raus aus dem Bus, 17 Minuten Fußweg. Ein Neubaugebiet voller Mehrfamilienhäuser aus dunkelbraunen Klinkern, die manche bestimmt schön finden. Ein giftgrünes Gymnasium, Aldi, Bäcker, Grünstreifen, Pflaster und Asphalt. Und zwei L-förmige Blöcke, Baujahr 2013, Niedrigenergiehäuser mit insgesamt 197 Wohnungen. »Hier hängt eine Kamera, alles videoüberwacht«, deutet der Hausverwalter über die Eingangstür. Treppenhaus, erster Stock, ein langer, kahler Flur, der Hall verschluckt die routiniert vorgetragenen Erläuterungen: Holländischer Investor, lebt in der Karibik, deshalb der Hausverwalter, der zur Demonstration die vierte Wohnung links aufsperrt.
Die Wohnung besteht aus einem einzigen stickigen Raum. Sofort beginnt die Vorführung, elektrische Rollläden zum Balkon, Küchenzeile, Bad, »alles da, nur den Duschvorhang müssen Sie mitbringen«. 488 Euro warm, jede Info kommt wie aus der Pistole geschossen. »Welche Klientel wohnt hier sonst so?« – »Wissen Sie, wir haben ja Kameras überall… aber vor allem Studenten, Krankenschwestern, Ärzte, Anwälte.« Die Wohnung, die wir gerade besichtigt haben, ist schon vermietet, »aber die sind ja eh alle gleich.« Von der Straße aus zeigt der Hausverwalter, welche Wohnungen zum Monatswechsel frei sind. Insgesamt dauert die Besichtigung 11 Minuten.
Man sieht also: Wohnungssuche in einer attraktiven Stadt kann so einfach sein! Es sei denn, man will in guter Lage wohnen, vielleicht sogar schön und idealerweise nicht völlig überteuert. Eine solche Wohnung zu finden, ist schwer; in attraktiven Gegenden ist gerade der bezahlbare Wohnraum längst knapp. Wo Geflüchtete dezentral untergebracht werden sollen, wird er noch knapper. Dabei treibt die Nachfrage die Preise weiter in die Höhe. War früher häufig von Wohnungsmangel die Rede, sprechen wir heute oft von Wohnungsnot – das Problem ist alt, die Brisanz ist neu.
Kein Platz zum Wohnen: Unsere Städte sind doch voll
Der Bedarf ist groß: Die Bundesregierung schätzt, dass in Deutschland bis 2020 jährlich 350.000–400.000 Wohnungen entstehen müssen, um die Schere zwischen Angebot und Nachfrage wieder zu schließen. Im vergangenen Jahr sind gerade einmal
Dass es die Gesellschaft immer stärker
Ganz Berlin und Köln unterbringen – auf Flächen, die eh schon bebaut sind

Tatsächlich gibt es auch in vielen dicht besiedelten Wohnsiedlungen Freiflächen –nur halt einige Meter über der Straße. Auf den Dächern Deutschlands ließen sich gut 1,5 Millionen neue Wohnungen bauen, berechneten die Technische Universität Darmstadt und das Pestel-Institut Hannover. In ihrer
Und die Macher der Studie betonen: Weil die neuen Etagen nach heutigen energetischen Standards aufgesetzt werden, geht weniger Heizenergie verloren – im Stockwerk direkt darunter sogar bis zu 50%, die bisher oft durch schlecht gedämmte Dächer verpufft.
Neue Etagen, neue Probleme?
Hat die neue Höhe der Wohnhäuser einen negativen Einfluss auf die Wohnqualität? Das kann passieren, wird aber mit guter individueller Planung unwahrscheinlicher. Die klassische
Jedoch müsste eine
»Wohncontainer sind hässlich.« Containerwohnungen können auch anders
»Liebe Bürgermeister, gebt einfach mal die Erlaubnis, dass Flachdächer in euren Innenstädten um 2 Geschosse erhöht werden!« – Jörg Friedrich
Wenn Rohre und Leitungen im Inneren entsprechend verlegt werden, können Containerhäuser aus mehreren Modulen sogar beliebig ab- und aufgebaut werden. Und genau wie auf einem Ozeanriesen können die Seecontainer auch an Land gestapelt werden, technisch sind 8 oder 9 Etagen möglich. »In Berlin muss man unter 22 Metern bleiben, da sind 4–6 Etagen ökonomisch machbar«, sagt Peter Weber. Im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick ist bereits ein
Architektonisch ansprechende, aber bezahlbare Containerwohnungen sind nur dann eine schnelle Lösung, wenn der Platz dazu bereitsteht. Und was, wenn nicht?

Mit mehr Flexibilität ins Stadtzentrum
Darüber hat sich Jörg Friedrich Gedanken gemacht. Er ist Professor für Entwerfen und Architekturtheorie an der Leibniz Universität Hannover. Vor einem Jahr hat er gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Studenten das Buch
Bei einer schnellen Lösung hilft auch ein wenig Pragmatismus: So können Häuser zunächst mit einem reduzierten Ausbaustandard gebaut werden und später Aufzüge, Balkone und Solarpanels nachgerüstet werden. Jörg Friedrich betont die Nachhaltigkeit der Vorschläge seines Teams: »Wir wehren uns strikt gegen Provisorien. Ein Haus soll für 30 Jahre Wohngebäude sein, muss sich anpassen und energietechnisch für die Zukunft gerüstet sein.«
Die Intention bei allen Entwürfen sei gewesen, Ärmere aus der Peripherie zurück in die Zentren zu bringen. Dafür verlangt der Professor den Städten Flexibilität ab: »Liebe Bürgermeister, gebt einfach mal die Erlaubnis, dass Flachdächer in euren Innenstädten um 2 Geschosse erhöht werden!« Er fordert, die Aufstockung nicht nur auf Wohnhäusern, sondern etwa auch auf Sparkassen und Universitäten in Betracht zu ziehen. Dieser Vorschlag geht also noch über die gut 1,5 Millionen Wohnungen der TU Darmstadt und des Pestel-Instituts hinaus. Dazu müsste es lediglich möglich sein, die Gebäude gleichermaßen für die Nutzung zum Wohnen und Arbeiten freizugeben.
Neues Wohnen im Hausboot oder Parkhaus
Die Ideen des Hannoveraner Professors gehen noch weiter: »Wir haben herausgefunden: Im Ruhrgebiet liegen tausende Schlepper, die man umrüsten kann und deutschlandweit an jedes Flussufer bringen kann.« Einst als Kohle- und Erztransporter im Dauereinsatz, werden die Kähne seit dem Niedergang der Montanindustrie nicht mehr gebraucht. Jörg Friedrich will sie am Flussufer deutscher Städte vertäuen und Wohnungen darauf bauen. Hausboote als Nutznießer des Strukturwandels in der ehemaligen Bergbauregion also, die in bester Innenstadtlage doch kein Grundstück wegnehmen.

Wir bauen bessere Siedlungen, wenn wir die Bedürfnisse der späteren Bewohner kennen.
Auch für tausende »City-Lofts« in den Stadtzentren sei der Platz bereits da: Die Rede ist nicht von alten Industriebauten und Speicherbauten, sondern: Parkhäusern. Übers Jahr gerechnet seien die mehrgeschossigen Parkhäuser in deutschen Innenstädten nur zu 60% ausgelastet, sagt Jörg Friedrich. Sein Vorschlag: »Bauen wir 20% der Parkplätze um!« Die erste Reaktion war nicht besonders positiv, das Konzept sei menschenverachtend. Auch hier wusste sich Jörg Friedrich zu helfen und gab den Parkhauswohnungen einen neuen Namen. Die
Im Kern geht es bei Suche nach neuen Wohnkonzepten vor allem um die Bereitschaft, unkonventionelle Lösungsansätze anzuerkennen. Das einzige Argument, das in der Diskussion nicht zählt, lautet: »Das haben wir ja schon immer so gemacht.« Dabei bedeutet eine neue Flexibilität nicht, alle sinnvollen Regeln, wie zum Beispiel Brandschutzverordnungen, zu übergehen. Sondern vielmehr, situationsangemessen darauf zu reagieren.
Die Lösungssuche beginnt mit dem Bebauungsplan

»Man übernimmt nichts ungefragt, was man an Lösungen vorfindet«, sagt auch Lefteris Roussos. Er berät hauptsächlich andere Architekten von einem soziologischen Standpunkt heraus; zwischen 1993 und 1995 hat er außerdem das ökologische Neubaugebiet im westfälischen Laer entwickelt, in dem er seitdem wohnt.
Um die Unterschiede hervorzuheben, lenkt Lefteris Roussos seinen Kombi zu Beginn unseres Treffens durch ein später erschlossenes, konventionelles Neubaugebiet. Auf rechteckigen Grundstücken stehen Einfamilienhäuser, die sich allesamt stark ähneln: Gleich hoch, gleiche Dachschräge, ähnliche Formen, ähnliches Sichtmauerwerk, gleicher Abstand zur Straße. Wir fahren einmal über die U-förmige Straße, vorbei an den neuen Häusern, dann steuert Lefteris Roussos seine Siedlung an.
Die Unterschiede springen sofort ins Auge: Hier gibt es zu Beginn einen gemeinsamen Parkplatz, sodass die immer wieder gebogene, schmale Straße fast autofrei bleibt. Die 15 Einzelfamilienhäuser sind zu großen Teilen identisch geplant und gleichzeitig gebaut, das brachte 30% Kostenersparnis. Die Gärten sind so angelegt, wie es Sinn ergibt und nicht unbedingt so, wie das Grundbuch es vorschreiben würde – davon abgesehen nutzen die Bewohner sie ohnehin gemeinsam. Und die Pflanzen, aber auch die Fenster sind so ausgerichtet, dass sich Nachbarn nicht gegenseitig in den Wohnbereich schauen.
Erfolg und Ersparnis durch gemeinsame Entscheidungen
Die Siedlung in Laer ist sehr durchdacht, aber als Impuls für den Wohnungsbau ist vor allem die Entstehung selbst interessant: »Wir haben zu Beginn die gegebene Situation analysiert: Wer baut, zu welchem Zeitpunkt seines Lebens, wie ist die finanzielle Situation?«, erklärt Lefteris Roussos. »Der entscheidende Punkt ist: Der Gemeinderat muss die Gesetze so abstrakt halten, dass man planerischen Spielraum hat.« Also hinterfragte der Architektursoziologe zu Beginn der Planungen, welches Ziel hinter jeder einzelnen technischen Bestimmung steckte, und suchte so gemeinsam mit seinen Mitstreitern nach der optimalen Bauform. Das brauchte Zeit und Energie: Lefteris Roussos und die anderen Bauherren haben mit der Gemeinde über jede Silbe
Irgendwann werden wir alle per App mitbestimmen können, was in unserer Stadt passiert.
Das Ergebnis: Sämtliche Bordsteinhöhen, Geschossvolumina, Materialien, Traufhöhen, Dachneigungen und so weiter entsprechen nun den Vorstellungen der Bewohner und erfüllten trotzdem die Wünsche der Gemeinde. »Die Leute wissen mit dem Instrument Politik nicht umzugehen«, sagt Lefteris Roussos, der für sein Neubaugebiet regelmäßig im Bauamt zu Gast war. Das hat am Ende sogar die Prozesse beschleunigt: »Vom ersten Bierchen und der Entscheidung, gemeinsam zu bauen, bis zu den letzten Pflanzen hat es 2 Jahre gedauert«, sagt Roussos. Davon 13 Monate für Bürokratie, 11 Monate für die Bauarbeiten. Dabei haben die Bauherren
Allein deshalb ließen sich seine Überlegungen nicht auf ein anderes Projekt übertragen, sagt Lefteris Roussos: »Eine konformistische Übernahme ist falsch. Der Schlüssel ist, etwas von Grund auf zu diskutieren.« Beim Bau von neuen Siedlungen spielen die Bedürfnisse der späteren Bewohner also entscheidende Rolle – im Optimalfall bilden sie die Diskussions- und Planungsgrundlage.

Per App bestimmen, wie gebaut wird
Idealerweise kommen Ideen für das Wohnen in der Stadt also direkt von den Menschen, die bereits darin wohnen. Das gilt nicht nur auf der Bauherrenebene, sondern auch auf der Ebene der Mitbestimmung, welche Flächen wie neu bebaut werden sollen. War Stadtplanung früher ein klassischer
Ohne App, aber trotzdem mit moderner digitaler Technik, ist das bereits in Hamburg möglich: In insgesamt 42 Bürgerworkshops, 6 pro Bezirk, sollen die Bürger gemeinsam überlegen, wo in ihrer Nachbarschaft Wohnungen für Geflüchtete entstehen könnten. Dabei hilft eine digitale Projektion des Bezirks, auf der die Bürger
Wenn die Städte sie konkret einbinden, können so auch Bürger dabei helfen, die Wohnungsnot zu lindern. Schließlich wissen die Einheimischen einer Stadt am besten, wo Platz für neue Mitbewohner ist. Vor Ort wird klar: Die Platznot ist nicht so gravierend, wie die Stadt glaubt. In den Innenstädten stecken teils verborgene Potenziale, die es individuell zu nutzen gilt. Tun wir dies, können mehr Menschen als bisher im Zentrum leben – und der Weg hinaus aus dem Stadtzentrum, inklusive 17 Minuten Fußweg, bleibt der Erholung vorbehalten.
Titelbild: David Ehl - copyright