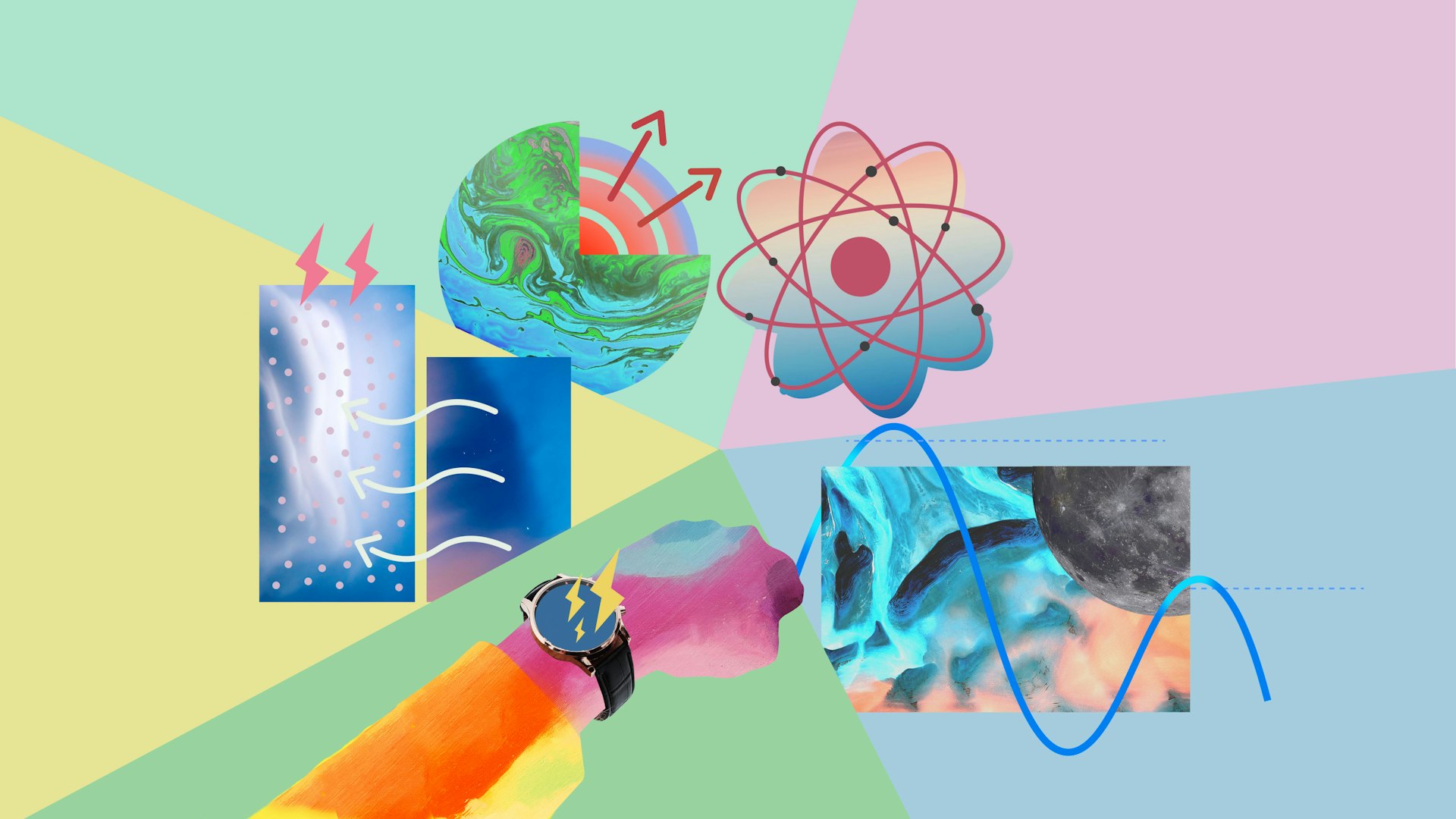5 Alternativen zu Wind und Sonne: Gehört diesen Energiequellen die Zukunft?
Ob Meeresgezeiten, heiße Erde oder Mini-Atomkraftwerke: Es gibt viele Möglichkeiten, sauberen Strom zu gewinnen. Welche wird sich durchsetzen?
Aus der Sicht der Physik ist unsere Erde voller Energie. Energie ist überall, in rauen Mengen, und sie hat viele Gesichter. Sie steckt in den Wasser- und Windmassen, die mit urgewaltiger Kraft durch Flüsse, Ozeane und die Atmosphäre treiben. Jede Stunde treffen fast
Uns mit Energie zu versorgen sollte also theoretisch kein Problem sein, denn es ist ja genug davon da. Doch wir müssen erst mal rankommen, also Ideen und Technik entwickeln, um sie zu erschließen und für uns nutzbar zu machen, sie in Strom zu wandeln. Bei Wind und Sonne funktioniert das schon gut. Aber was ist mit dem Rest?
Wind und Sonne dominieren bei den Erneuerbaren
Fast 3/4 des erneuerbaren Stroms in Deutschland stammt aus Wind und Sonne. Biomasse ist nah dran – doch es gibt noch viele weitere Energiequellen. (in Prozent)
Hier sind 5 Möglichkeiten, alternative Energiequellen zu nutzen:
Das Gezeitenkraftwerk: Den Mond nutzen
Wie funktioniert es?

In einigen Entwürfen für neue Kraftwerke dieser Art stecken die Turbinen in großen Staumauern, die Buchten oder Flussmündungen abschotten. Bei sogenannten »In-Flow-Gezeitenkraftwerken« hingegen stecken die Turbinen auf Pfosten im Meeresgrund – und sehen tatsächlich aus wie überflutete Windkrafträder.
Wo gibt es das schon?
Weitere Varianten für Meereskraftwerke
Weitere Varianten, die derzeit erforscht werden, sind schwimmende Gezeitenkraftwerke, bei denen Rotoren unterhalb eines Schiffes befestigt werden, und Wellenkraftwerke, die die Bewegung des Wellengangs in Strom umwandeln.
In Frankreich ist seit 1966, in Südkorea seit 2011 jeweils ein größeres Gezeitenkraftwerk in Betrieb. Beide Anlagen entsprechen der Staudammbauweise (in Frankreich ist die Staumauer insgesamt rund 750 Meter, in Südkorea 12,7 Kilometer lang) und leisten
Ist das die Zukunft?
Wie groß das Potenzial von Ebbe und Flut als Energiespender ist, zeigen die Pläne für
Denn die »Severn Barrage« in England zeigt auch, wie groß die Probleme noch sind: Geschätzte 34 Milliarden Pfund hätte das Kraftwerk gekostet, 30 Vogelarten hätten Teile ihres Lebensraums verloren, auch Fische (und mit ihnen Fischer, die von ihnen leben) wären bedroht gewesen. Konjunktiv deshalb, weil das Projekt seit 2010 auf Eis liegt – und der Abschlussbericht des britischen Energieministeriums zu dem Schluss kommt:
In den meisten Fällen zeigen andere erneuerbare Energien (zum Beispiel Wind) und Kernkraft ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Wesentlich vielversprechender für die Zukunft der Technik ist
»Small Modular Reactors«: Die Mini-AKWs
Wie funktioniert es?
Im Prinzip funktionieren die »Small Modular Reactors« (SMR) wie ein »normales« Kernkraftwerk: Radioaktives Uran zerfällt kontrolliert und erhitzt dabei Wasser. Der heiße Wasserdampf treibt eine Turbine an und generiert Strom.
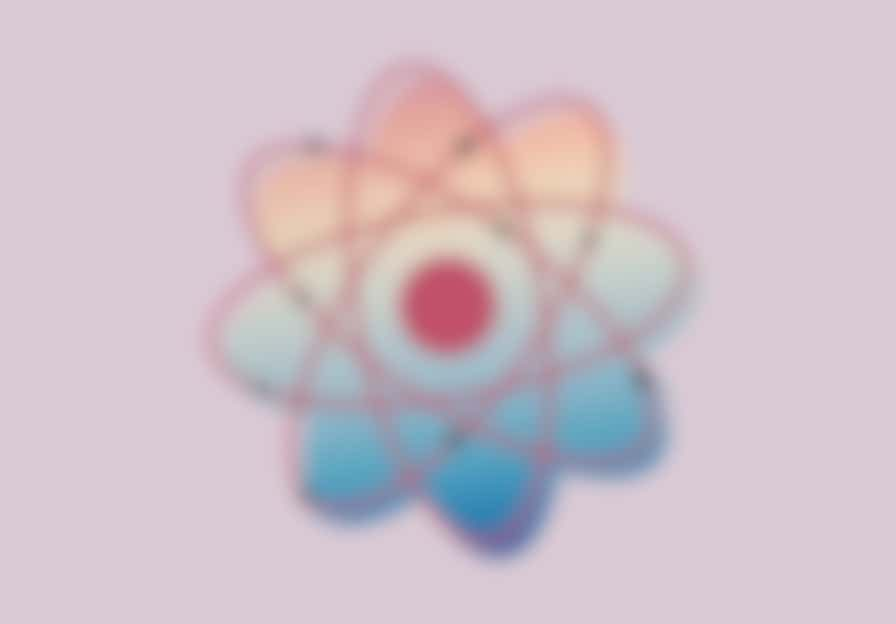
Der Unterschied zu herkömmlichen Kernkraftwerken: Die »Small Modular Reactors« sind – wie der Name schon vermuten lässt – wesentlich kleiner und technisch vereinfacht. Je nach Bauweise belegen sie nur 1% der Fläche im Vergleich zu einem großen Atomreaktor. Während der Kühlturm eines »normalen« Atomkraftwerks schnell mal über 150 Meter hoch ist,
Wo gibt es das schon?
In Russland ist
Die beiden amerikanischen Unternehmen GE Hitachi Nuclear Energy und NuScale Power entwickeln ebenfalls SMR und haben Pläne für den Bau unter anderem in Estland, Tschechien und dem US-Bundesstaat Idaho.
Ist das die Zukunft?
Aufgrund ihrer Größe entfallen in SMRs viele komplizierte Bauteile, und die Kraftwerke können wie Fertighäuser in Fabriken gebaut und an ihren Einsatzort geliefert werden. Das spart Kosten und könnte der Atomkraft, die aufgrund ihrer exorbitanten Kosten
Auch gelten die Mini-AKWs aufgrund mehrerer baulicher Unterschiede als sehr sicher. Katastrophen wie in Tschernobyl oder Fukushima wären mit der neuen Technologie nicht möglich gewesen – sagen zumindest die Entwickler. Dafür könnten sie flexibel an Industriestandorten zum Einsatz kommen und, weil sie flexibel ein- und ausgeschaltet werden können, die
Kritiker sagen allerdings: Die Entwicklung der Technologie dauert noch zu lange, der Umbau zu einer emissionsarmen Stromerzeugung muss viel schneller passieren. Bis die Reaktoren wirklich bereit für den großen Wurf sind, könnten Jahre vergehen – und Wind- und Sonnenkraft fällt in dieser Zeit ebenfalls weiter im Preis.
Geothermie: Wir stehen auf einem Schatz
Wie funktioniert es?
Unter unseren Füßen brodelt es: Heiße Lava fließt durch unterirdische Flüsse, es bilden sich heiße Dampfblasen und Wasserreservoirs. Die Geothermie macht sich die Erdwärme zunutze: In vielen Fällen wird die Wärme direkt als solche verwendet. Sie heizt über Fernwärmenetze Häuser und Wasser.

Es ist aber auch möglich, aus der Wärme im Erdinneren Strom zu erzeugen. Das geht aber nur mit Reservoiren im Erdreich, die sehr warm sind,
Wo gibt es das schon?
Die Technik wird seit Jahrzehnten überall auf der Welt verwendet, die meisten Geothermie-Anlagen gibt es in China, den USA und Schweden. Besonders viel Geothermie nutzen auch die Isländer, wo viele vulkanische Aktivitäten nah unter der Erdoberfläche stattfinden. Über 90% des Wärmebedarfs und rund 1/4 des Strombedarfs (der Rest stammt aus Wasserkraft) decken die Isländer mit Geothermie.
In Deutschland sind
Ist das die Zukunft?
Die Geothermie wächst langsam, aber stetig.
Heute beschränken sich die meisten Anlagen aus Kostengründen auf Gebiete, in denen man nicht tief bohren muss, um die Wärme anzuzapfen. Bessere Technik könnte aber dabei helfen, auch tiefere Bohrungen lohnend und weniger warme Reservoire nutzbar zu machen, schätzt die IEA.
Wie richtig sie mit dieser Prognose liegt, machte jüngst eine Meldung aus München deutlich:
Zum Vergleich: Was leisten verschiedene Kraftwerkstypen?
Die Grafik zeigt die Leistung des derzeit größten Gezeitenkraftwerks nach Fertigstellung 2021, des mittlerweile nicht mehr im Betrieb befindlichen, einzigen Osmosekraftwerks in Norwegen, des ersten schwimmenden Mini-Atomkraftwerks in Russland und des weltweit größten Geothermiekraftwerks in den USA. (in Megawatt)
Das Osmosekraftwerk: Die Kirsche im Strommix
Wie funktioniert es?
Wenn es im Spätsommer regnet und das Wasser auf reife Kirschen fällt, platzen diese auf. Grund dafür ist der unterschiedliche Zuckergehalt zwischen dem Kirschsaft im Innern (viel Zucker) und dem Regenwasser außen (kein Zucker).

Der Duden erklärt Osmose so:
Das Hindurchdringen eines Lösungsmittels (z. B. Wasser) durch eine durchlässige, feinporige Scheidewand in eine gleichartige, aber stärker konzentrierte Lösung
Die gleiche Kraft nutzt ein Osmosekraftwerk, um Strom zu erzeugen. Anstelle von Kirschsaft kommt Salzwasser aus dem Meer zum Einsatz, das über Rohre ins Kraftwerk und vorbei an einer großen Membran geleitet wird. Auf der anderen Seite fließt Süßwasser, das ebenfalls durch Rohe aus einem Fluss durchs Kraftwerk fließt. Das Süßwasser drängt nun durch die Membran ins Salzwasser und kann dabei eine Turbine antreiben.
Wo gibt es das schon?
Bisher gibt es das erst einmal, und zwar im Süden von Norwegen. 2009 ging
Ist das die Zukunft?
Grund für das Ende der Testläufe war – das Geld. Die Kunststoff-Membranen seien derzeit zu teuer und nicht effizient genug, sagte ein Mitarbeiter des norwegischen Energieversorgers Statkraft dem
Doch grundsätzlich hat diese Technik großes Potenzial. Sie kann überall dort zum Einsatz kommen, wo Süß- auf Salzwasser trifft. Also dort, wo Flüsse ins Meer münden – und wo viele Städte angesiedelt sind. Weltweit könnte es so Kraftwerke mit über 180 Gigawatt Leistung geben – fast so viel, wie es derzeit insgesamt in Deutschland gibt.
Noch effizienter wären die Kraftwerke, wenn der Salzgehalt noch höher läge. Dies trifft auf das Abwasser von Entsalzungsanlagen zu. Das ist deshalb praktisch, weil Wasserentsalzungsanlagen sehr viel Strom verbrauchen, der dann direkt vor Ort mit dem salzigen Abwasser erzeugt werden könnte. Und Entsalzungsanlagen werden in Zukunft durch den Klimawandel sehr viel häufiger benötigt werden. Ein weiterer Vorteil von Osmosekraftwerken: Anders als Windkraft- und Photovoltaikanlagen liefern sie kontinuierlich Strom, zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Wearables: Wir sind die Batterien
Wie funktioniert es?
Wer den Film
Dahinter stecken ganz unterschiedliche Technologien:
- Piezokristalle etwa sind Kristalle, die Strom erzeugen, sobald sie zusammengedrückt werden. Packt man sie zum Beispiel in eine Schuhsohle, wandeln sie bei jedem Auftritt die Energie aus unserem Schritt in Elektrizität.
- Andere Feinmechaniken mit Selbstaufzug erzeugen Energie, indem sie bewegt werden. Das wird bisher vor allem in Armbanduhren eingesetzt.
- Ein dünnes Gewebe mit Nanoröhren kann mithilfe des »thermoelektrischen Effekts« aus Temperaturunterschieden Strom erzeugen. Zum Beispiel wenn ein Mensch Sport treibt, und es unter seinem T-Shirt deutlich wärmer wird als in der Umgebung.

Wo gibt es das schon?
Piezokristalle kommen heute in zahllosen elektrischen und mechanischen Geräten zum Einsatz, allerdings weniger, um diese mit Energie zu versorgen, sondern vielmehr als Sensoren. Zum Beispiel in Mikrofonen oder Musikinstrumenten, die akustische Luftbewegungen in elektrische Signale wandeln. Druckfeuerzeuge sind eine weitere bekannte Anwendung; hier entfacht der elektrische Funkenschlag aus einem Piezokristall die Flamme.
Mechaniken mit Selbstaufzug kommen wie oben erwähnt vor allem in Armbanduhren zum Einsatz. Durch die Bewegung der Hände im Alltag bleiben diese stets mit Energie versorgt und laufen sehr präzise.
Ist das die Zukunft?
Die genannten Energiequellen sind sicher keine ernsthaften Kandidaten, große Mengen Strom in unsere Netze einzuspeisen, und tanzen im Vergleich zu den anderen ein wenig aus der Reihe. Doch wenn sich die Technik verbessert, könnten gerade Kleidungsstücke in Zukunft eine Quelle sein, die unterwegs Strom für unsere Elektronik bereitstellen. Jeder Schritt ein halber Prozentpunkt auf dem Ladebalken des Handys – das klingt doch nicht schlecht! Auch im Outdoor- oder Militärbereich könnten sie Verwendung finden.
Doch vor allem zeigen sie: Energie ist überall – wir müssen sie nur nutzbar machen!
Mit Illustrationen von Doğu Kaya für Perspective Daily