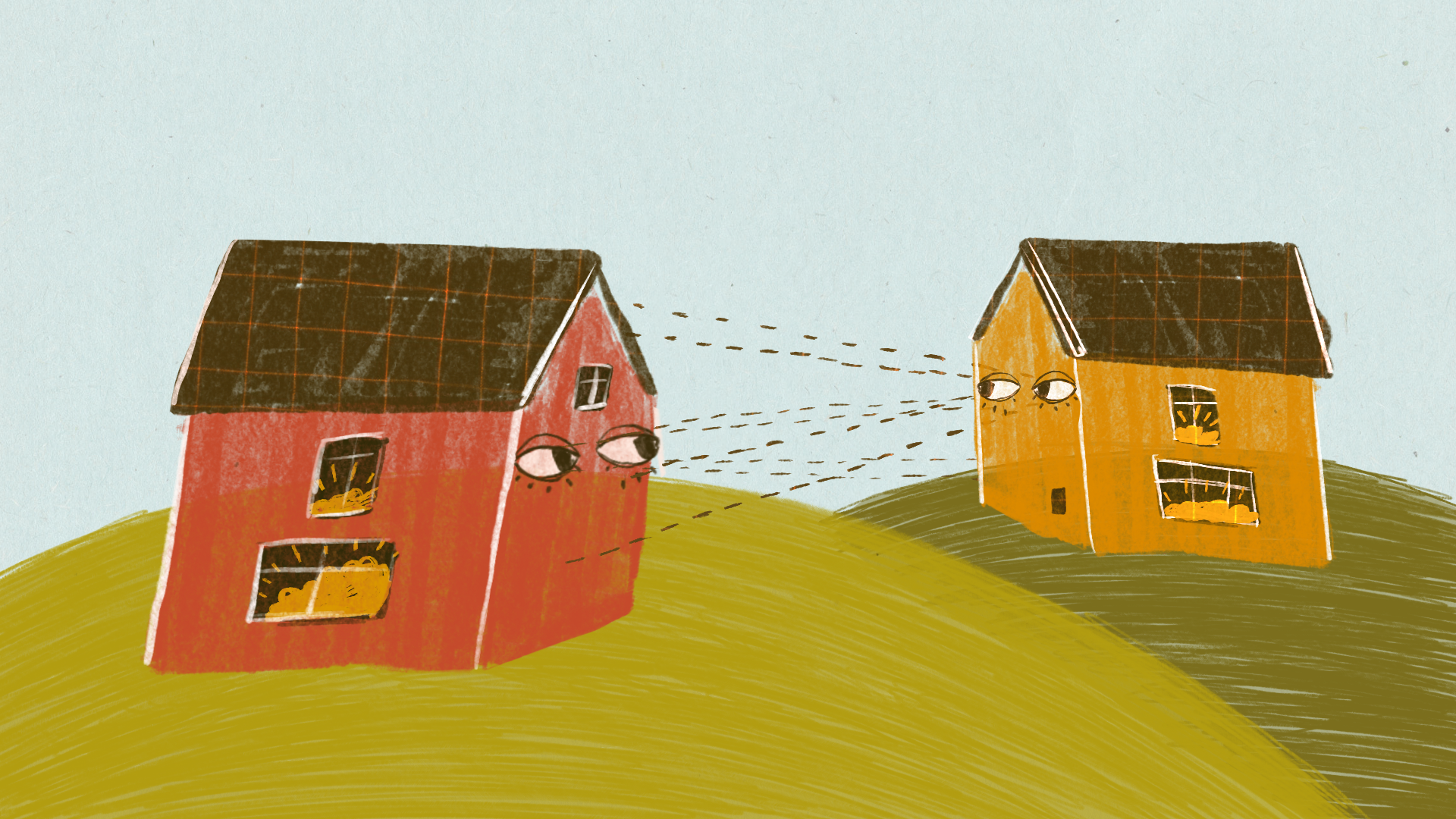Warum in Norwegen das Modell »Steuerporno« so gut funktioniert
Hier kann jede:r einsehen, wie viel Geld die anderen haben. Und das hat einige Vorteile.
Wem zeigst du deinen Steuerbescheid? Wem erzählst du, was du verdienst oder wie viel Erspartes auf deinem Konto liegt? Würdest du in Norwegen leben, wären alle diese Daten öffentlich. Gezahlte Steuern, Einkommen und Vermögen sind in Norwegen öffentliche Angaben, die im Netz zu finden sind, wenn auch nicht für jeden. Wer in Norwegen gemeldet ist und eine elektronische ID besitzt, kann sich auf der Website der Steuerbehörde Skatteetaten einloggen und
Das wichtigste Motiv hinter diesem System sei Transparenz, erklärt Hans Christian Holte, Direktor von Skatteetaten.

Die Steuerlisten tragen zu einer Offenheit im Steuersystem bei. Sie schaffen Vertrauen. Man weiß, wie das System funktioniert, und die Geheimnistuerei rund um Finanzen verschwindet. Außerdem sorgen sie für eine gute gesellschaftliche Debatte über Wirtschaft und Finanzen.
Um diese Debatte zu unterstützen, haben Medien in Norwegen einen besonderen Zugang zu den Steuerlisten. Während Privatpersonen nur nach den Angaben Einzelner suchen können, bekommen Medien eine elektronische Komplettversion der Listen zur Verfügung gestellt, mit der sie zum Beispiel auch statistische Auswertungen machen können. Die dürfen sie nicht in ihrer Gesamtheit veröffentlichen, aber als Grundlage für die Berichterstattung nutzen. Dabei kommt manchmal
Am allerreichsten ist Sofie Steen Isachsen. […] Die 23-Jährige hat sich über mehrere Jahre unter Norwegens größten Blogger:innen an die Spitze geschlagen. Sie ist auch erfolgreich als Autorin, Influencerin in sozialen Medien und zuletzt als frisch ausgeschiedene ›Let’s Dance‹-Teilnehmerin. Im vergangenen Jahr ergab das ein Einkommen von mehr als
Holte hält die umfangreicheren Medienlisten dennoch für wichtig: »Zum Beispiel werden Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen sichtbar. Oder man sieht, welche Menschen im Land die reichsten sind.«
Ob die Offenlegung der Daten auch zu weniger Steuerhinterziehung im kleinen und großen Stil führt, kann Holte allerdings nicht beantworten. »Das wissen wir nicht, aber ich glaube, dass die Listen einen Beitrag leisten. Die Steuermoral in Norwegen ist grundsätzlich hoch.«
Misstrauen wecken oder bekämpfen?
Als einen weiteren Vorteil der Listen nennt er Hinweise aus der Bevölkerung. Leute melden sich bei der Steuerbehörde, wenn der Lebensstandard eines Nachbarn oder einer Kollegin nicht mit den Angaben in den Listen zusammenpasst. Aber schürt das nicht Misstrauen zwischen den Menschen? »Das glaube ich nicht«, sagt Holte.
Ich denke, die Listen schaffen hauptsächlich Offenheit. Geheimnisse können auch zu Misstrauen führen, die Listen wirken dem eher entgegen.
Können sich die Norweger:innen also nach Lust und Laune ihrer Neugier hingeben, um ihren Kolleg:innen, Bekannten und Nachbar:innen hinterherzuspionieren? Ganz so einfach ist es nicht, jedenfalls nicht mehr. Seit 2014 sind nicht nur die Listen, sondern auch die Suchen darin öffentlich. Wenn du suchst, sehen das die Gesuchten. Seit Skatteetaten diese Änderung eingeführt hat, ist die Zahl der Suchanfragen dramatisch zurückgegangen, von ungefähr 16 Millionen auf 1,6 Millionen pro Jahr, schreibt Skatteetaten. Da also verläuft die Grenze der Neugier.
Auch die norwegische ID war nicht immer nötig. Zu analogen Zeiten lagen die Listen in Papierform zum Beispiel in Bibliotheken und auf Postämtern, doch in den Jahren 2001–2011 waren sie völlig frei im Internet zugänglich. Das führte zu sehr »kreativen Verwendungen«, wie Hans Christian Holte es ausdrückt. »Die Daten waren leicht für Kriminelle zugänglich und konnten missbraucht werden«, sagt er. Die Frage nach dem richtigen Maß an Offenheit sei deswegen eine ständige politische Diskussion. »Ich denke, wir haben da gerade eine ganz gute Balance«, findet Holte.
Die Brit:innen nennen es ›Tax Porn‹
Im internationalen Vergleich aber ist das norwegische System exotisch und sorgt, gelinde gesagt, für Verwunderung. Holte erzählt von einem Besuch im britischen Parlament, das ihn eingeladen hatte, um das norwegische Offenheitsprinzip zu erklären. »Das war für die meisten dort sehr ungewohnt. Sie nannten es ›Tax Porn‹«, erzählt er lachend. Die kulturellen Unterschiede seien offensichtlich. In Norwegen sei man eher verschwiegen bei anderen Themen wie Beziehungen oder Gesundheit. »Aber gerade beim Finanziellen haben wir die Kultur, dass Offenheit etwas Gutes ist.«
Es ist nicht so verwunderlich, dass kulturell ähnliche Länder auch ähnliche Systeme haben wie Norwegen. In Finnland stehen Steuerdaten zwar nicht im Internet, lassen sich aber telefonisch bei der Steuerbehörde erfragen. Auch in Schweden genügt ein Anruf bei der Steuerbehörde, kostenfreie Onlinelisten gibt es auch hier nicht. Einige Unternehmen veröffentlichen die Daten jedoch in aufbereiteter Form und stellen sie gegen Bezahlung zur Verfügung. Die berühmteste Variante ist der »Taxeringskalender«, der es sogar in einen schwedischen Weihnachtsklassiker aus den 70er-Jahren geschafft hat.

Der junge Zeichentrickheld der Geschichte, Karl-Bertil Jonsson, sucht darin im »Taxeringskalender« seines reichen Papas nach den wohlhabendsten Menschen der Stadt. Beim Ferienjob bei der Post lässt er dann gezielt an Reiche adressierte Weihnachtspäckchen mitgehen, um sie in bester Robin-Hood-Manier an die Armen zu verteilen. Die Sache fliegt auf, Karl-Bertil bekommt Ärger, doch dann finden es alle großartig, es ist ja Weihnachten.
Diese Geschichte fällt wohl streng genommen in die Rubrik »krimineller Missbrauch des Offenheitsprinzips«. Der Beliebtheit des Weihnachtsklassikers tut das keinen Abbruch: Er wird immer noch jedes Jahr am Heiligabend im Fernsehen gezeigt und von mehr als einer Million Schwed:innen verfolgt.
Hier findest du die beiden anderen aktuellen Dailys:
Mit Illustrationen von Mirella Kahnert für Perspective Daily