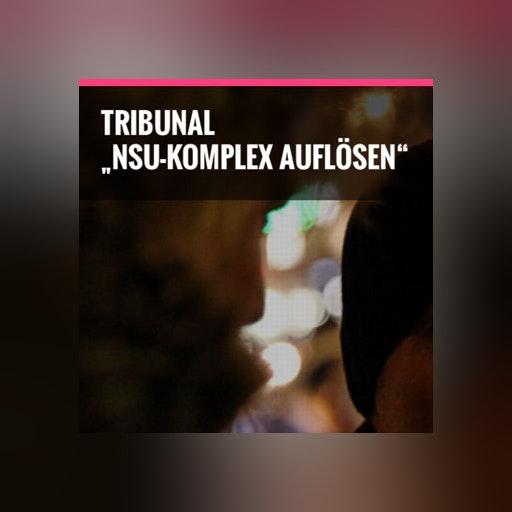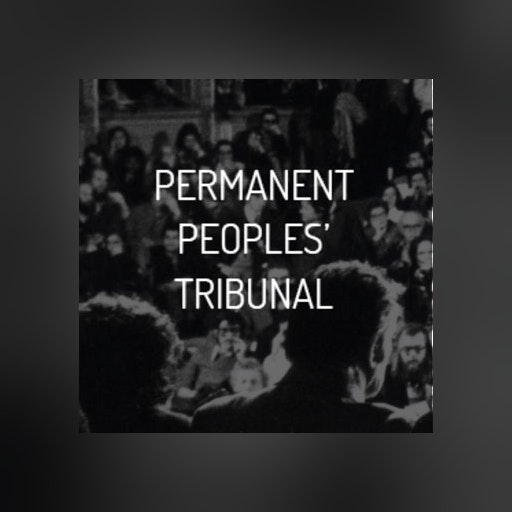Unechte Richter für echte Rechte
Ob Massaker im Kongo oder NSU-Komplex – als Kritik an der staatlichen Aufarbeitung der Fälle organisieren Aktivisten Bürgertribunale. Was können sie bewirken?
Auf den ersten Blick sieht es aus wie haufenweise bunte Kleider: verstreut auf dem mit frischem Laub bedeckten Boden, darüber ein provisorisches Zeltdach gegen die Sonne, die auch auf der Kinoleinwand hell leuchtet. Doch bei genauerem Hinsehen stecken Körper in den Kleidern, über 30 Menschen, die noch vor Stunden am Leben waren. Bis bewaffnete Männer sie massakrierten – in Mutarule, einem Dorf im Osten Kongos. Ein Dorfbewohner deckt das jüngste Opfer auf, einen Säugling, 2 Monate alt. »Was hat dieses Baby getan?«, fragt er zornig und sagt: »Dies ist die Situation, in der wir leben – Tag für Tag!«

Niemand rührt sich im großen Theatersaal der Universität der Künste in Berlin. Juristen, Künstler, Studierende starren betroffen auf die Leinwand, als erste Szenen aus dem Dokumentarfilm »Das Kongo-Tribunal« gezeigt werden, der im Frühjahr 2017 in die Kinos kommen soll. 3 Tage lang haben sie sich versammelt, um über
Ein Tribunal als Kunstprojekt?
Vertreibungen, Vergewaltigungen und Massaker gehören im Ostkongo seit Jahrzehnten zum traurigen Alltag.

»Beim Kongo-Tribunal haben wir Zusammenhänge hergestellt, die es bisher nicht gab«, sagt Milo Rau, der zusammen mit zwei Menschenrechts-Experten auf dem Podium sitzt, die am Tribunal mitgewirkt haben: dem Berliner Anwalt Wolfgang Kaleck und dem kongolesischen Anwalt Sylvestre Bisimwa, der beim Tribunal den Untersuchungsleiter spielte. Als weißer Künstler im Kongo will Milo Rau nicht in erster Linie anklagen, sondern
»Dass das Tribunal so stattgefunden hat, ist eigentlich unmöglich«, stellt er später am Telefon fest. »Dass es wirklich aufgeführt wurde, bis zur Urteilsverkündung, und dass wirklich alles funktioniert hat, ist mir selbst immer noch ein Rätsel.« Er erklärt es sich in erster Linie damit, dass sie es als Theaterprojekt deklarierten, was ihnen einen gewissen Freiraum gewährte.
Ein Kriegsverbrechertribunal als Theaterprojekt.
Auch in Deutschland wird es im kommenden Jahr wieder ein inszeniertes Tribunal geben, allerdings ohne Kriegsverbrechen. Thema: Der

Anstatt ein klassisches Gerichtsverfahren nachzustellen, wollen sie lieber die Betroffenen in den Mittelpunkt stellen. Diese sollen einen Raum erhalten, in dem sie »ihren Forderungen, ihrem Wissen, ihren Geschichten, aber auch ihrem Schmerz und ihrer Wut Ausdruck verleihen können«, so Massimo Perinelli, denn: »Dass andere die Richter und die Betroffenen nur Zeugen sind, ist genau die Anordnung, die überall vorherrscht und die wir durchbrechen wollen.«
Beim

Am Ende des NSU-Tribunals soll statt eines Urteils eine Anklage stehen. Andere können dann Urteile fällen, schreibt das Team auf seiner
Es ist ein ehrgeiziges Ziel, das die Organisatoren erreichen wollen. Kann ein inszeniertes Tribunal so etwas leisten? Was kann es überhaupt leisten?
Die Tribunale dokumentieren, klären auf und füllen Lücken im Rechtsschutzsystem
Blicken wir zurück auf das Kongo-Tribunal und auch auf andere, frühere Tribunale (siehe Infokasten). Befragt man Milo Rau im Nachhinein zu den Wirkungen, erzählt er von einer »großen Signalwirkung« und von zwei entlassenen Ministern. Trotzdem habe sich insgesamt das Leben vor Ort seit dem Tribunal kaum verändert –

Auf dem Podium in Berlin beschreibt auch Rechtsanwalt Sylvestre Bisimwa seine Eindrücke. Er stammt selbst aus dem Ostkongo und setzt sich dort für Opfer von sexueller Gewalt ein; beim Kongo-Tribunal war er der Untersuchungsleiter. Er sagt: »Die Menschen in Bukavu dachten, das Tribunal sei echt. Im Anschluss an das Tribunal haben sie mir von vielen weiteren Verbrechen erzählt, die wir aufklären sollten. Das macht mir Hoffnung.«
Das Tribunal hat es ermöglicht, dass die kongolesische Bevölkerung sieht, dass es eine solche Justiz geben kann und dass auch der Staat und die Politik sich dort rechtfertigen müssen.
Wissenschaftliche Forschung zu den Tribunalen und ihren Wirkungen gibt es kaum,
Sie stellen fest, dass die Tribunale Lücken im staatlichen Rechtsschutz- und Verantwortungssystem füllen können, etwa das Tribunal zu Sri Lanka 2010, das kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs ist. Dieser konnte deshalb nicht ohne Weiteres tätig werden.
Das Frauentribunal in Tokio im Jahr 2000 wiederum zeige Funktionen außerhalb des rechtlichen Bereichs auf: Es trug dazu bei, das System der sogenannten »Trostfrauen« der japanischen Armee im zweiten Weltkrieg zu dokumentieren und aufzuklären.

Das Solidaritätsnetzwerk spielt auch beim NSU-Tribunal eine große Rolle. Um das Tribunal zu planen, vernetzten sich bundesweit die verschiedenen lokalen Gedenkinitiativen. Sie wollen nach Ende des Tribunals weiter in Verbindung bleiben, sagt Massimo Perinelli. Auch ein Archiv möchten sie aufbauen – und wie das Frauentribunal die Geschichtsschreibung ergänzen. Das Tribunal ist also keine einzelne, alleinstehende Aktion, sondern steht in einem größeren Zusammenhang. Massimo Perinelli formuliert es so: »Das Tribunal ist eine Verdichtung von einem Protest, der schon vorher stattfand und auch nachher weitergehen soll«.
So scheint durch das geschaffene Solidaritätsnetzwerk das NSU-Tribunal schon jetzt einen positiven Effekt zu haben – bevor die Veranstaltung überhaupt angefangen hat. Wird es auch sein eigentliches Ziel erreichen, eine Debatte über institutionellen Rassismus anzustoßen?
Eine gesellschaftliche Debatte anregen
Eine breite gesellschaftliche Debatte lässt sich wohl vor allem durch eine öffentlichkeitswirksame und inhaltlich fundierte Aktion anregen. In puncto Öffentlichkeit ist das Organisationsteam gut aufgestellt und hat bereits eine Reihe prominenter Theater als Unterstützer auf seiner Seite. Dazu zählen etwa die Münchner Kammerspiele und das Residenztheater, das Berliner Maxim-Gorki-Theater und das Schauspiel Köln, in dessen Räumen das Tribunal stattfinden wird. Inhaltlich können sie auf über Jahre gesammeltes Wissen der einzelnen Initiativen und der Opfer-Angehörigen zurückgreifen, sowie auf die bereits existierende Dokumentation der Ereignisse durch Untersuchungsausschüsse und Journalisten. Insofern scheinen die Chancen ganz gut, eine Debatte anzustoßen.

Eines könnte allerdings zum Problem werden: Das Tribunal will sich auf die Perspektive derjenigen beschränken, die von Rassismus betroffen sind. Andere Blickwinkel haben keinen Platz. Der Standpunkt derjenigen, die die rassistische Spaltung der Gesellschaft vorantrieben, so Massimo Perinelli, werde ohnehin seit Jahren transportiert. »Da es kein Urteil gibt, geht es auch nicht um die Frage eines fairen Verfahrens«, fährt er fort. »Wir wollen vielmehr etwas benennen und stark machen, das nicht erzählt wird.«
Verständliche Gründe. Aber sind sie zielführend? Um wirklich eine gesellschaftliche Debatte über institutionellen Rassismus auszulösen, muss die Aktion doch auch und gerade die vermeintlich rassistischen Institutionen ansprechen. Sie auszuschließen wird ihre Gesprächsbereitschaft kaum fördern, sondern eher noch verringern. In dem beim Thema Rassismus derzeit ohnehin aufgeheizten gesellschaftlichen Klima ist aber vor allem eine gute Kommunikation unerlässlich, um Auseinandersetzung statt Abgrenzung zu bewirken.
Verständigung durch Auseinandersetzung
Milo Rau hat es beim Kongo-Tribunal erstaunlicherweise geschafft, Vertreter verschiedener Seiten zum Mitwirken zu bewegen. Da waren Betroffene der Gewalttaten ebenso wie ein Rebellenführer, der Innenminister und der Gouverneur der Provinz Kivu. »Wir haben von Anfang an alle Beteiligten offen eingeladen und immer wieder nachgehakt«, erzählt Milo Rau. »Auch, wenn ich persönlich meine Meinung zu einem Punkt habe, so habe ich doch versucht, keine zu starken Vorurteile einzubringen.«

Natürlich lassen sich die beiden Tribunale nur sehr bedingt miteinander vergleichen. Inhaltlich, aber auch beim Verfahren liegen Welten zwischen ihnen. Bei einer Zeugenvernehmung gibt es klare Rollen, in einem offenen Gesprächsraum hingegen weniger. In einer Gerichtssituation ist es daher einfacher, die Verantwortlichen zu Wort kommen zu lassen, ohne für die Betroffenen eine unangenehme Situation zu schaffen, als es das bei einer anderen Art der Inszenierung ist. Auf der anderen Seite ist ein offener Raum, wie ihn das NSU-Tribunal schaffen will, vielleicht mehr noch als ein strenges Gerichtsverfahren eine Chance für die Verständigung – und damit auch für die Bereitschaft, etwas zu verändern.
Wie auch immer sie aber aufgebaut sind: Beide Tribunale bieten jedenfalls eines, was auf dem Podium Rechtsanwalt Wolfgang Kaleck als die Funktion eines Gerichtsverfahrens beschreibt: Sie sind ein Stück weit »eine Autorität, die erklärt: ›Das hat stattgefunden.‹«
Titelbild: Daniel Seiffert - copyright