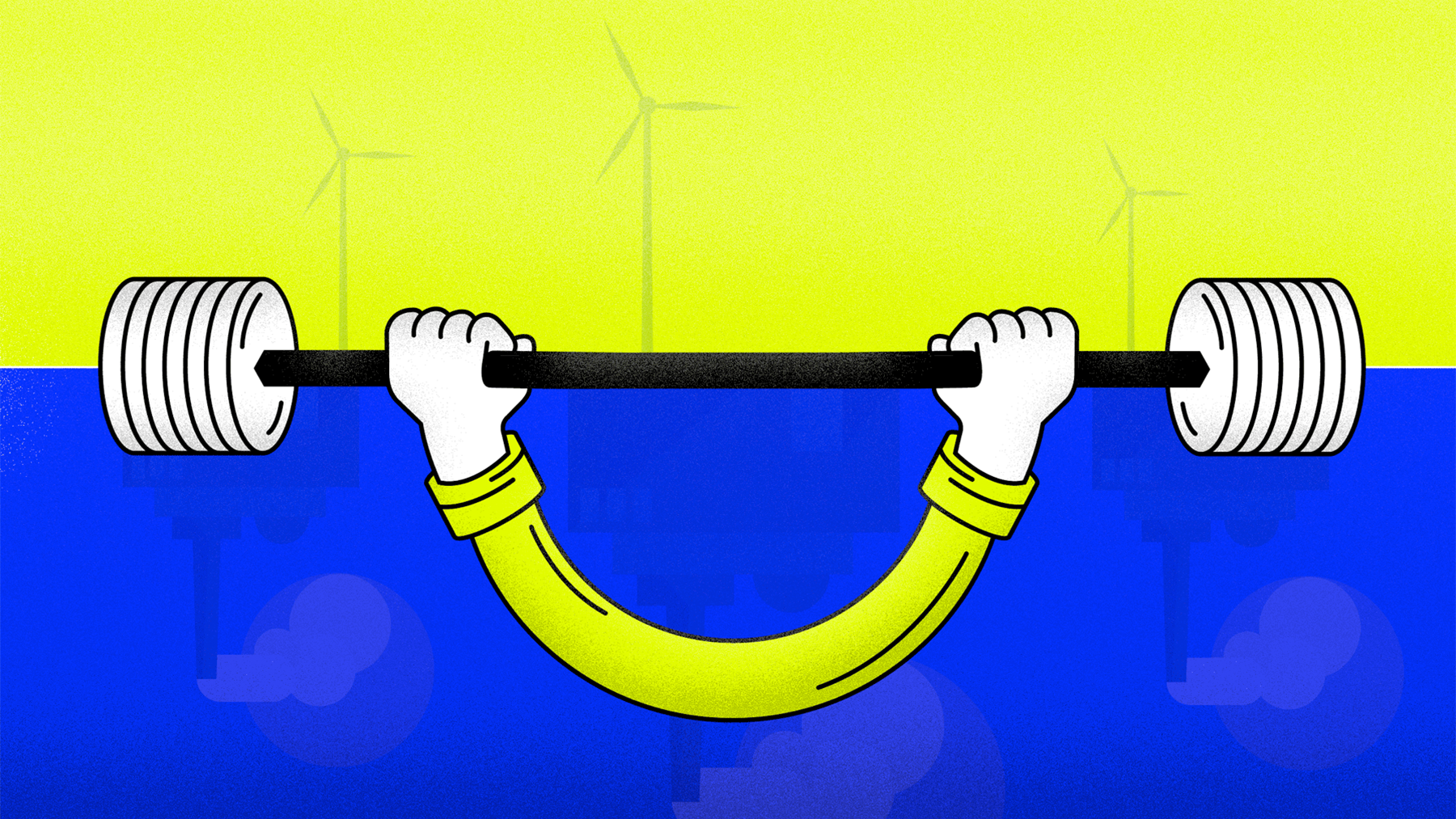Wie ich auf eine »Sekte« reinfiel, ohne es zu merken
Ein »Prophet«, instrumentalisierter Sex und ein Haftbefehl – nichts davon ahnte ich, als ich meine Hochzeit in einem abgeschiedenen Kloster gefeiert habe. Worauf es ankommt, um problematische Gruppen besser erkennen zu können.
Wie hätte ich wissen sollen, dass der schönste Tag in meinem Leben Geld in die Kassen eines »Propheten« spülen würde? Im Sommer 2015 feierten meine Frau und ich unsere Hochzeit in einem historischen Kloster in der Ortschaft Goch an der niederländischen Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Dort hatte man wirklich alles getan, um den Tag gelingen zu lassen. Lächelnde Menschen in mittelalterlichen Kostümen huschten auf der Hochzeitsfeier umher und servierten Honigwein und frisch gebackenen Dattelkuchen – eine Spezialität des Klostercafés.
Die kleine Gemeinde, die das Kloster in Goch bewohnt, hatte alles für uns organisiert. Mit ihrer Eventagentur veranstalten sie regelmäßig Mittelaltermärkte, Konzerte, Weinfeste sowie Festivals und sind damit über die Jahre zu einer Attraktion und Institution am Niederrhein geworden – mit rund 100.000 Besucher:innen

Umso glücklicher waren wir, als unser Wunschtermin bestätigt wurde. Ein paar Wochen vor der Hochzeit lernten wir die Organisator:innen kennen, ganz ungezwungen beim Bogenschießen. Schon damals war mir die Freundlichkeit der Menschen dort aufgefallen. Der Eventmanager begrüßte uns mit herzlichem Händedruck und 3-Tage-Bart. Er nahm sich außergewöhnlich viel Zeit, führte uns herum und erklärte die historische Vergangenheit der Anlage, die nun von ihm und »Gleichgesinnten« bewohnt und bewirtschaftet würde. Das Kloster sei sein »Baby«, sagte er stolz, und wir glaubten es sofort.
Wie viele Menschen denn im Kloster lebten, wollte ich damals wissen.
»Einige«, sagte er mit warmherzigem Lächeln über seinen schlichten Rollkragenpullover hinweg. Sie wären eine enge Gemeinschaft und würden sich mit vielen Dingen – wie Eiern aus dem eigenen Hühnerstall oder Würsten der eigenen Hochlandrinder – selbst versorgen. Es sei schon »ein etwas anderes Leben«, das sie im Kloster gewählt hätten. Aber sie seien glücklich.
»Wie schön das sicher ist! So abgeschieden und in Ruhe«, überlegte meine Verlobte laut.
»Ja«, antwortete er mit sanfter Stimme und schaute zurück zum Wohntrakt im hinteren Bereich der Anlage. Mehr sagte er nicht dazu.

Der Eventmanager Camiel E. schien mir einer der charismatischsten Menschen zu sein, die ich je kennengelernt habe. Damals war er Pächter, heute ist er der Besitzer des Klosters, das 2017 an ihn verkauft wurde.
Tatsächlich war er aber damals wie heute das öffentlichkeitswirksame Gesicht einer verschworenen Glaubensgemeinschaft. Erst vor wenigen Wochen stürmte eine Hundertschaft Polizist:innen das Kloster auf der Suche nach einer jungen Frau.
Ich konnte es kaum fassen, als ich davon erfuhr: Warum hatte ich nicht gemerkt, dass im Kloster etwas scheinbar nicht stimmte?

Der Orde der Transformanten: Vom Coaching zur »problematischen Glaubensgemeinschaft«
Die 54 Menschen, die auf Kloster Gräfenthal in Goch leben, gehören zum »Orde der Transformanten«, einer Glaubensgemeinschaft mit niederländischem Namen, die von Robert Baart im Jahr 2000 gegründet wurde. Baart war davor Coach für Persönlichkeitsentwicklung in Amsterdam. Er vermittelte in seinen Seminaren Methoden, womit sich jede:r selbst »verbessern« können sollte.
In Deutschland sind derzeit
Doch Robert Baart entwickelte eine eigene religiöse Ideologie:
Zunächst besteht die Glaubensgruppe aus 4 befreundeten Paaren, es folgen jedoch bald andere Niederländer:innen der Einladung und
Als 2008 einige Mitglieder in den Niederlanden unter Mordverdacht geraten,
Robert Baart zieht sich nach öffentlichen Anfeindungen zurück und die Gruppe sucht nach einer neuen Heimat – und findet sie im Kloster in Goch. Während Eventmanager wie Camiel E. die Geschäfte führen und die Gruppe finanzieren, leitet Baart im Hintergrund die religiösen Belange.
12 Jahre später, im Oktober 2020, sorgt der Orde nun wieder für Aufsehen: Eine 25-jährige Tochter von 2 Mitgliedern
Die Klostergemeinschaft selbst sieht sich als Opfer von Justizwillkür und zeigt sich erschüttert:

Auch Camiel E. weist im Telefongespräch mit mir die Anschuldigungen von sich: »Das ist alles verkehrt. Ich lebe schon 20 Jahre mit dem Mann zusammen und kann mir das nicht vorstellen. Das sind Vorwürfe von ehemaligen Mitgliedern und einem eifersüchtigen
Trotz der Beschwichtigungen und meines harmlosen Ersteindrucks: Ein selbst ernannter »Prophet«, Angst und drastische Vorwürfe, Abgeschiedenheit, instrumentalisierter Sex und ein Haftbefehl – das mulmige Gefühl über die Gemeinschaft dort im Kloster bleibt.
Nur Glaube oder doch Sekte? Die ermittelnde Staatsanwaltschaft betont, dass es nicht ihre Aufgabe sei, das zu beurteilen.
Höchste Zeit, bei Expert:innen nachzufragen, wo die Grenzen für solche Gemeinschaften liegen und wie diese zu erkennen sind.
Was Sekten wirklich sind und wie du sie erkennst
»Der Begriff ›Sekte‹ ist gar nicht festgelegt, sondern eher Umgangssprache. Wir tragen ihn zwar noch im Namen, vermeiden ihn aber ansonsten und sprechen eher von neuen religiösen und ideologischen Gemeinschaften und Psychogruppen«, erklärt Sabine Riede. Die Pädagogin ist seit 17 Jahren Geschäftsführerin der staatlich geförderten Informations- und Beratungsstelle der Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e. V.
Wir haben in Deutschland religiöse Vielfalt und die ist uns auch wichtig. Wir selbst sind weltanschaulich neutral und wollen Religionen auch nicht in ›gut‹ und ›böse‹ einteilen. Im Grundgesetz ist verankert, dass jeder in Deutschland glauben kann, was er will – aber nicht alles machen kann. Sobald ein Glaube dazu führt, dass Handlungen Gesetze überschreiten, dann gibt es da Grenzen.
Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e. V. kümmert sich um Aussteiger:innen und besorgte Angehörige. Der Rechtfertigung des Orde, es habe doch alles freiwillig stattgefunden und jede:r könne jederzeit gehen, hält sie aus ihrer Erfahrung entgegen:
Solange alle erwachsenen Mitglieder einer Gruppe Spaß am gemeinsamen Tun haben, ist alles gut. Doch oft sorgt Gruppendruck dafür, dass Menschen einknicken und Dinge tun, die sie eigentlich nicht wollen. Aussteigerinnen erzählen mir immer wieder, dass sie sich gezwungen gefühlt haben – obwohl alles nach außen frei wirkte.
Ob eine solche Gruppendynamik existiert, ist auf den ersten Blick nicht leicht zu erkennen. Diese
- Einfaches Weltbild und Intoleranz: Die Gruppe liefert eine einfache Erklärung für viele Fragen und Probleme. Statt zu differenzieren, diktiert eine Führungsperson ein abgeschlossenes Weltbild. Nicht selten sei die übrige Menschheit etwa »falsch«, »krank«, »verlogen« oder »fehlgeleitet«.
- Ablehnung von Etabliertem: Die Lehre der Gruppe steht in Kontrast zu allgemeinem Wissen und demokratischen Werten. So werden vor allem Wissenschaft und bestehende Gesetze angezweifelt. Mitglieder selbst betrachten sich als Besitzer:innen der »Wahrheit« und fühlen sich dadurch überlegen.
- Starke Abgrenzung: Die Gruppe zieht sich zurück, lebt abgeschieden oder reglementiert zwischenmenschliche Beziehungen. Oft sollen Mitglieder Kontakte zu Freundeskreisen und Verwandten abbrechen, weil diese »schlecht« für sie seien.
- Strenge Vorschriften: Die Gruppe verlangt Disziplin und das Befolgen von Regeln, die tief ins Privatleben eingreifen. Viele diktieren den Mitgliedern dabei sogar ihr Privatleben bis hin zum Sexualverhalten, etwa durch vorgeschriebene Partner:innenwahl, obligatorischen Gruppensex oder strenge Enthaltsamkeit.
- Zeitfresser: Die Gruppe füllt die Zeit der Mitglieder mit vielen Aktivitäten (etwa dem Anwerben, Besuch von Kursen, Meditation) und nimmt schnell einen Großteil der Woche ein.
- Kritikimmun: Zweifler:innen wird unterstellt, selbst daran »schuld« zu sein und mangelnden Einsatz zu zeigen. So immunisieren sich problematische Gruppen gegen jede Kritik.
Beispiele für extremere Gruppen, die harmlos beginnen und später auch brutaler Gewalt nicht abgeneigt sind, gibt es viele:
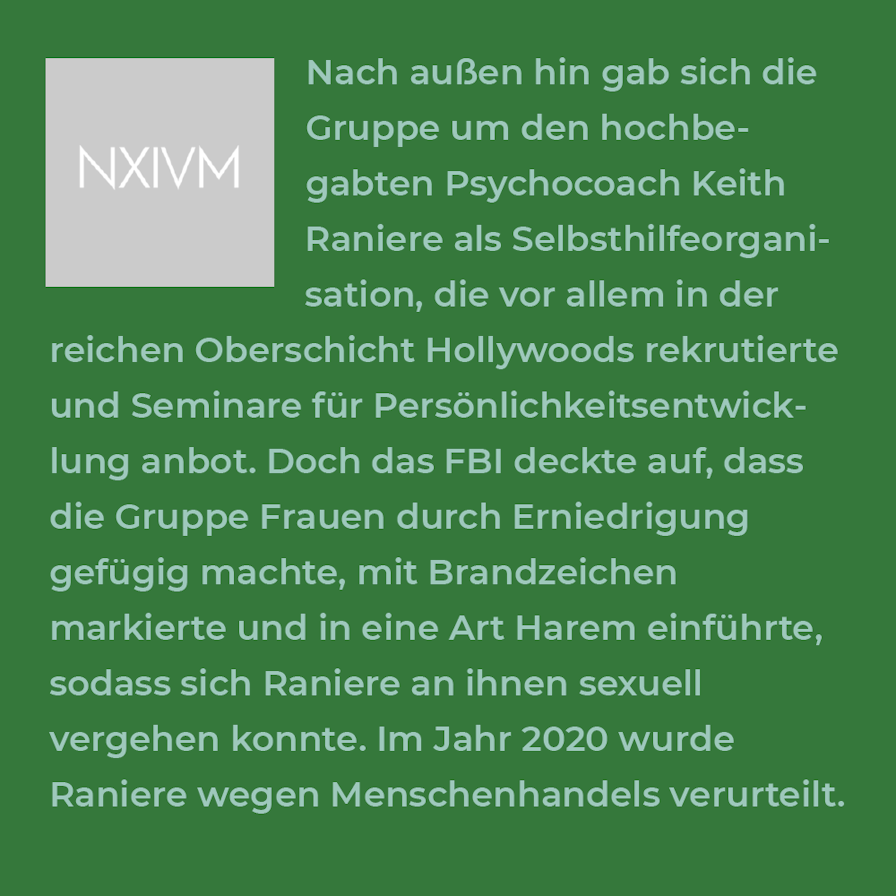
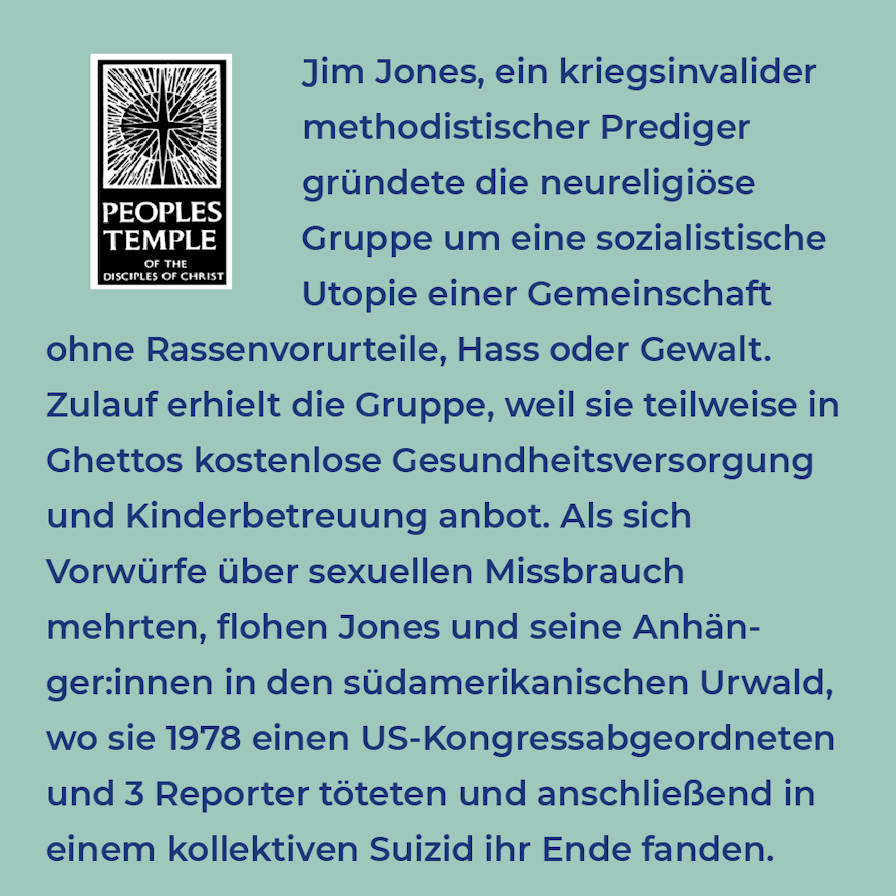
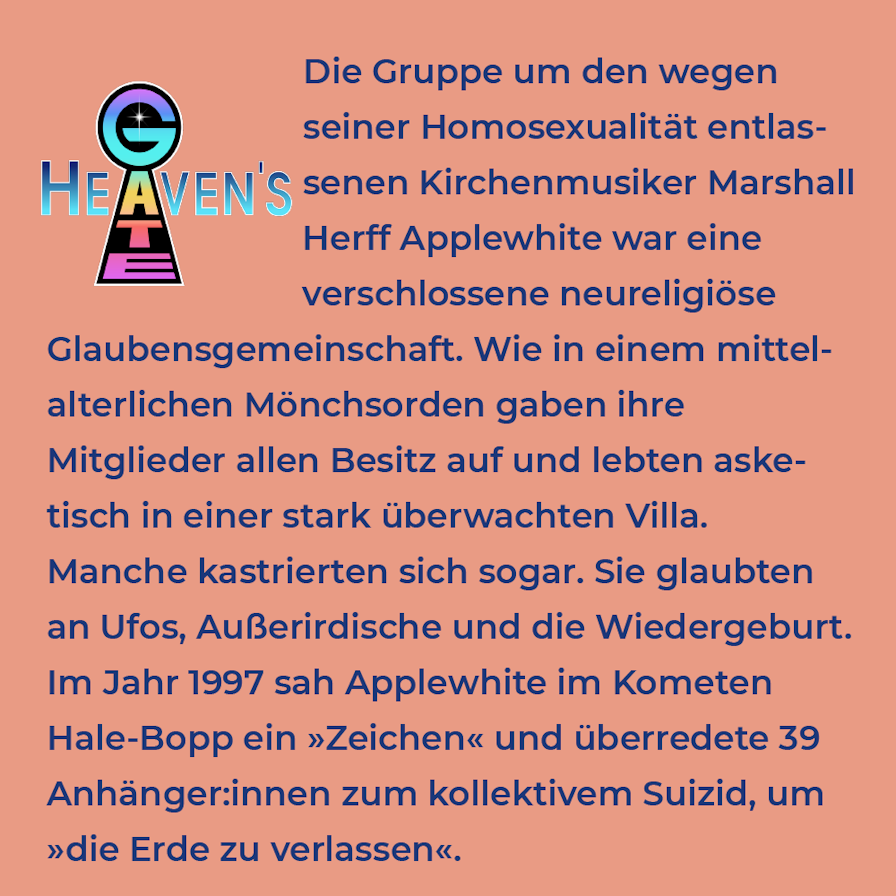
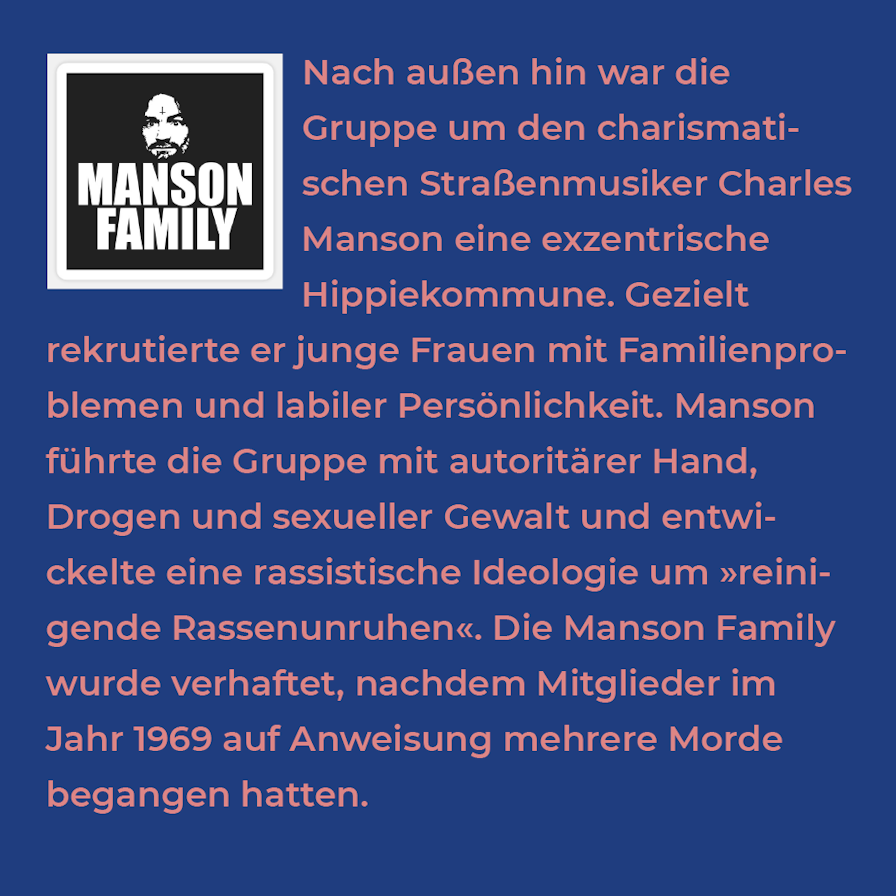
Das erinnert mich auffallend an Verschwörungsideologien wie etwa diejenigen rechtsextremer Reichsbürger:innen,
Die Ähnlichkeit komme nicht von ungefähr, sagt Sabine Riede:
Es gibt durchaus Gemeinsamkeiten mit politischen Ideologien. Die Verschwörungsgläubigen, die wir beraten, lassen oft die gleichen Bedürfnisse erkennen wie Aussteiger aus problematischen Religionsgemeinschaften, zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit, Einzigartigkeit, Entlastung.
Sind Sektenmitglieder alle »gehirngewaschen«?
Ein Stuhl, grelles Licht, Schlafentzug – Gehirnwäsche, wie Hollywood sie gern zeigt, führt auf die falsche Fährte. Es gibt aber sehr wohl weniger dramatische Techniken, um die menschliche Psyche zu formen – etwa die Selbst- und Realitätswahrnehmung mit gezielten Lügen zu destabilisieren (»Gaslighting«). Diese werden von vielen Sekten eingesetzt, um Anhänger:innen gefügiger zu machen.
Fakt ist: Auch problematische Religionsgemeinschaften haben manchmal politische Ambitionen. Religion kann extremistisch genutzt werden.
Riede betont, dass problematische Strukturen in nahezu jeder weltanschaulichen Ausrichtung vorkommen können: von selbst ernannten Humanist:innen über Yogagruppen, Sozialist:innen, religiösen Fanatiker:innen, Heiler:innen, Ernährungsgurus bis hin zu politischen Extremist:innen. Sie alle versprechen zunächst Geborgenheit – und zeigen erst später ihr wahres Gesicht.
Im Gespräch mit der Sektenexpertin erkenne ich, dass problematische Gruppen weit vielfältiger und verbreiteter sind, als ich bisher dachte. Und ich muss mir eingestehen, dass ich vielleicht vor vielen Jahren und lange vor dem Kontakt mit dem Orde selbst Teil einer problematischen Gruppe war.
Es gibt sie überall – das erkenne ich erst jetzt
»Führungspersonen einer problematischen Gruppe haben nicht unbedingt von vornherein etwas Schlechtes vor. Sie wollen zu Beginn vielleicht etwas Gutes, verändern sich dann aber, wenn mehr Menschen mitmachen. Macht sowie ihr Missbrauch und Geld spielen hier eine große Rolle« – diese Sätze von Sabine Riede lassen mich nach unserem Gespräch nicht mehr los.
Denn während meines Studiums habe ich mich einer
Du willst meine ganze Story lesen? Dann klicke hier!
Zu Beginn war es nur ein normales Training im Rahmen des Hochschulsports. Am Ende vermittelte der Trainer und Hochschulmitarbeiter asiatische Lebensphilosophie, stellte strenge Regeln auf, immunisierte sich gegen Kritik, machte Aussteiger:innen nieder und verschlang einen Großteil unserer Zeit. Irgendwann ertrug ich es nicht mehr, zog für mich die Reißleine und verließ die Gruppe.
Zu Beginn wirkte der Kampfsport wie ein normales Hochschulangebot für mehr Fitness und Körperkontrolle. Genau das, was ich neben meinem Studium suchte.
Mit vielen anderen Studierenden meldete ich mich an und kam freiwillig jede Woche zum Training oder manchmal auch eben nicht. Alles wirkte zunächst ungezwungen und spielerisch. Der Trainer betrieb das Ganze als Hobby neben seiner Unitätigkeit und wirkte äußerst charismatisch und höflich.
Doch schon bald zeigte er größere Ambitionen und verkündete erste strenge Regeln. Private Gespräche waren tabu: schweigen, melden, den Worten des Trainers folgen. Wer zu spät kam, hatte vor dem Eingang zu knien, bis der Einritt erlaubt wurde. Und wer nicht bald einen Keikogi kaufte – einen weißen Trainingsanzug – oder es sogar wagte, mit einem andersfarbigen Anzug zu erscheinen, wurde vor allen gemaßregelt. Es folgten Ansprachen über japanische Philosophie, Disziplin, Loyalität, das »Training der alten Schule« und immer wieder abschätzige Äußerungen über andere Sportarten. Die seien alle weich geworden und kaum ernst zu nehmen.
Neben dem Kampfsport sollten wir die richtige Einstellung üben, auch außerhalb der Trainingshalle. Etwa »jederzeit aufmerksam und bereit sein« – was auch immer das bedeuten sollte. Ich ertappte manch andere Teilnehmer:innen der Gruppe dabei, wie sie auf dem Unigelände heimlich die richtigen Handgesten übten und in Gesprächen in den Hierarchien und internen Rängen der Kampfsportgruppe dachten: »erster Schüler«, »Erfahrene«, »Neulinge«. Insgesamt fühlten wir Mitglieder der Kampfsportgruppe uns elitär und anderen Sportgruppen überlegen. Und es wurde gern gesehen, wenn diese Leidenschaft für den Sport auch mit zusätzlichem Einsatz für die Gruppe bewiesen wurde: Anwerbung neuer Schüler:innen oder sogar Sachspenden. Alles rein freiwillig, natürlich, nur für die Gunst des Trainers.
Bald gab es mehr als nur ein regelmäßiges Treffen. 3-mal pro Woche sollten wir auf der Matte stehen und dazu an manchen Wochenenden noch Extratrainings absolvieren – um uns auf Turniere vorzubereiten. Wer dies nicht schaffte oder wollte, wurde abschätzig behandelt. Kritik wurde nicht toleriert; wer an der Lehre zweifelte, zeigte nur zu wenig »Respekt« oder »Willen« für die Sache.
»Man darf sich keine Vorwürfe machen, wenn man eine solche Gruppe auch nicht gleich erkennt. Eine Innenansicht bekommt man nur, wenn man selbst dazugehört oder einer ausbrechen will.« – Sabine Riede, Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e. V.
Im zweiten Jahr kristallisierte sich ein harter Kern aus folgsamen Musterschüler:innen heraus, die in einer Art Geheimlehre besondere Techniken gezeigt bekamen. Und dann gab es »den Rest«, wozu auch ich zählte. Viele Teilnehmer:innen klagten hinter vorgehaltener Hand über den Gruppendruck, die Erwartungshaltung des Trainers und seine Methoden (vor allem seine Wutansprachen) oder tauschten sich über den immer stärker wachsenden Einfluss der Gruppe auf ihr Leben und ihre Psyche aus. Manch eine:r litt tatsächlich unter dem Training und trainierte etwa mit blutenden Füßen, Rückenschmerzen oder trotz stark angeschlagener Gesundheit weiter. Andere verteidigten fragwürdige Methoden des Trainers vor Neuankömmlingen und suchten immer neue Entschuldigungen.
Was mir aber besonders aufstieß: Wer es wagte, auszusteigen, wurde niedergemacht und in der Gruppe schlechtgeredet. In einem Fall wurden sogar persönliche E-Mails veröffentlicht, um ein Ex-Mitglied zu diskreditieren. Da reichte es mir und ich zog die Reißleine.
Das heißt nicht, dass jetzt jeder Fußballverein und jede:r Trainer:in automatisch verdächtig ist, betont die Sektenexpertin Sabine Riede:
Ein Kriterium, das uns als Beratungsstelle aber hellhörig machen würde, ist in diesem Beispiel die zunehmende Zeit. Es gab eine klare Dosissteigerung. Und dann ist es egal, was diese Zeit verschlingt – ob Kampfsport oder Yoga. Und auch eine Autoritätsperson, die versucht, mich weltanschaulich zu beeinflussen, würde mich aufhorchen lassen.
Nicht umsonst lautet der Leitsatz der Beratungsstelle »Gemeinschaft kann gefährlich werden«, gemeint als Warnung für den Alltag. Denn wo auch immer ein Machtgefälle herrscht, lässt sich dies auch ausnutzen. Jede Gruppe kann theoretisch zu einer problematischen Gruppe werden – ob in einem Kloster oder einer Sporthalle.
Wachsamkeit ist also in jedem Fall gut. Vor allem, wenn Menschen gerade jetzt besonders anfällig sind …
Das Internet macht anfällig für Sekten und Psychogruppen. So schützt du dich
Sekten und Co. erleben gerade in unserer heutigen Zeit starken Zulauf – das zeigen etwa die internen Zahlen von chronisch überlasteten Beratungsstellen wie Sekten-Info Nordrhein-Westfalen e. V. Denn oft wenden sich auch Menschen aus anderen Bundesländern an die Beratungsstelle. Besonders die Anzahl an Menschen, die sich in Verschwörungsideologien verloren haben, nimmt nach Angaben der Beratungsstelle stark zu.
Warum gibt es staatlich geförderte Sektenhilfszentren eigentlich nicht in jedem Bundesland?
Als Autor für Digitalisierung gebe ich hier auch dem Internet eine Teilschuld: Die ständig fortschreitende Technik um Smartphones hat auch manche meiner Verwandten abgehängt und befremdet. Durch Fake News und Dauerbeschallung mit Negativnachrichten verspüren manche Menschen eine große Erschöpfung – und suchen nach einfachen Weltbildern als Alternative.
Aber was wäre die Lösung?
In meinen Recherchen zu Extremismus und Onlinehass habe ich gelernt, dass eine Lösung oft nicht im digitalen, sondern im echten Zwischenmenschlichen liegt. Hier sind wir alle gefragt, aufmerksamer zu sein:
- So schützt du andere: »Wenn Menschen im engen Umfeld anfangen, auf alles zu schimpfen, und Verzweiflung zeigen, macht mich das sehr hellhörig. Dann sollte man schauen, ob es demjenigen nicht gut geht«, rät Sektenexpertin Sabine Riede. Dabei geht dies eigentlich gegen unseren Instinkt: Wir lassen andere mit Problemen erst mal in Ruhe. Aber gerade solch Fürsorge und zwischenmenschliche Verbindung, das betont auch Sabine Riede, können ein potenzielles Abrutschen in problematische Ideologien oder Gruppen verhindern.
- So schützt du dich selbst: Psycholog:innen wissen heute, dass es vor allem Menschen mit geschwächtem Selbstbewusstsein sind, die in Krisen (ein Jobverlust, eine Trennung, ein Todesfall) und Umbruchsituationen besonders anfällig für einfache Weltbilder sind. Und Krisen passieren nun mal früher oder später. Was dabei helfen kann, sie besser zu überwinden, ist ein Leben,
Du willst mehr über Selbstwirksamkeit lernen? Dann lies jetzt diesen Artikel bei uns von Katharina Ehmann:
Die Aussagen von Camiel. E. zu den Vorfällen wurden nachträglich in den Artikel eingefügt.
Titelbild: Patrick Fore - CC0 1.0