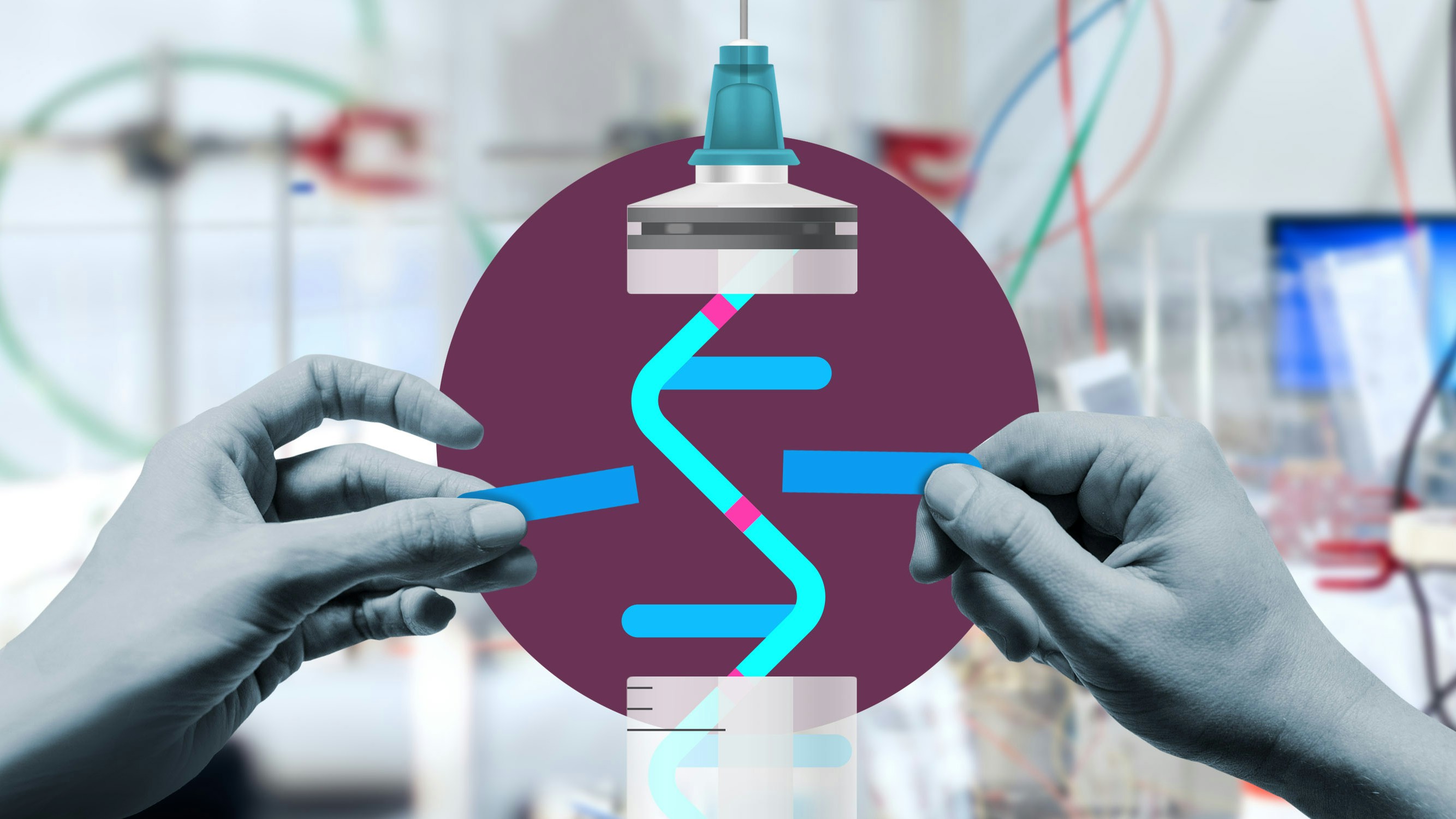Das sind die 10 wichtigsten Perspective-Daily-Texte des Jahres 2020
Wie kann es weitergehen? Diese Frage hat uns auch im Pandemiejahr immer begleitet. Hier sind die Artikel, die du dieses Jahr bei uns gelesen haben solltest.
Was für ein Jahr! Corona dominierte die Nachrichten und stellte uns als Redaktion vor eine Herausforderung: Wie geht konstruktive Berichterstattung während einer Pandemie? Hat entschleunigter Journalismus eine Chance, wenn Pushnachrichten zu den neuesten Infektionszahlen, R-Werten und Maßnahmen quasi im Minutentakt aufploppen? Darüber entscheiden nicht wir, sondern die Leser:innen.
Was wir aber wissen: Unsere Leitfrage »Wie kann es weitergehen?« hilft dabei, zu sortieren, worauf es wirklich ankommt und welche Handlungsoptionen bestehen, wenn beim täglichen
Zum Ende des Jahres empfehlen wir dir Texte, wovon wir glauben, dass sie nicht nur ein bisschen Hoffnung, sondern auch Orientierung und einen Blick nach vorn bieten – nicht bloß in Bezug auf Corona.
Was steckt hinter der neuen RNA-Impfung?
von Benjamin FuchsEnde Juli war mir noch nicht klar, wie wichtig das Thema RNA-Impfung in diesem Jahr noch werden würde – Lara Malberger schon. In diesem Text erklärt sie leicht verständlich Wirkweise, Chancen und Risiken der neuen Impfung. Als Anfang November die Firma BioNTech mit den guten Zwischenergebnissen aus der klinischen Studie an die Öffentlichkeit ging, musste ich an Laras Artikel denken und habe direkt noch einmal nachgelesen. Ich empfehle ihn allen, die an den ruhigen Feiertagen etwas Muße haben, um sich noch einmal zu informieren, was es mit der Impfung auf sich hat, die jetzt vielen Hoffnung gibt.
Warum es in der EU ständig Streit um die Landwirtschaft gibt
von Katharina WiegmannEs gibt diese Begriffe, die bedeutungsschwanger durch den politisch-medialen Diskurs flattern und wovon trotzdem kaum jemand weiß, was genau gemeint ist. Die EU-Agrarsubventionen zählen dazu. Dass es hier um viel Geld geht, ist bekannt; auch dass es immer mal wieder Streit um Bedingungen und Verteilung gibt. Aber wer genau bekommt das Geld, warum und wofür? Wieso fließen überhaupt so viele Mittel in die Landwirtschaft – und was hat das alles mit Klimaschutz zu tun? Felix Austen hat sich aufgemacht, all diese Fragen in einer Artikelreihe zu ergründen. Und zwar nicht nur vom Schreibtisch, sondern auch vom Schweinestall aus.
Was wir von der Bekämpfung der Pandemie für die Klimakrise lernen können
von Stefan BoesDie Coronapandemie und die Klimakrise haben auf den ersten Blick scheinbar nicht viel mehr gemeinsam, als dass beide zu den größten Herausforderungen unserer Zeit gehören. Doch eines wurde in der Pandemie überdeutlich: dass wir handeln müssen, bevor wir die Konsequenzen des Nichthandelns erfahren. Sogenannte Kipppunkte, die das Funktionieren des gesamten Systems plötzlich ändern, gibt es in beiden Krisen. Es gilt, frühzeitig zu reagieren, um die schlimmsten Folgen abzumildern, die wir gar nicht genau vorhersagen können.
Wenn du mehr über die Lehren aus Corona für unseren Umgang mit der Klimakatastrophe erfahren möchtest, solltest du unbedingt diesen Text von Han Langeslag lesen.
Wie ein selbsternannter Prophet am schönsten Tag im Leben unseres Autors verdiente
von Han Langeslag»Auf eine Sekte reinfallen?! Das wird mir sicher nie passieren!« Denkst du auch? Leider gehört es oft zu den Stärken einer Sekte, dass sie nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen ist – sondern erst dann, wenn es zu spät ist.
Mein Favorit aus der Goldgrube der Artikel von Dirk Walbrühl ist in diesem Jahr ohne Zweifel seine persönliche Geschichte, wie er auf eine Sekte reinfiel, ohne es zu merken. Eine Story, die nicht nur spannend ist, sondern dir gleichzeitig hilft, problematische Gruppen früh genug als solche zu erkennen.
Kann es eine Welt ohne Arbeit geben?
von Lara MalbergerWährend der Pandemie ist mir aufgefallen, dass manche Tage ineinanderfließen: aufstehen, arbeiten, essen, schlafen – und dann das Ganze wieder von vorn. Auch wenn ich mir manchmal etwas mehr Freizeit wünsche, mache ich meine Arbeit gern. Dieses Privileg haben nicht alle Menschen und nicht wenige macht ihr Job sogar krank. Das müsse nicht sein, sagt die Post-Work-Bewegung. Ihre Verfechter:innen glauben, dass ein Leben ohne 40-Stunden-Woche möglich sei. Deshalb setzen sie sich dafür ein, dass unsere Arbeit irgendwann nicht mehr unser Leben bestimmt. In diesem Text hat Benjamin Fuchs erklärt, wie das funktionieren soll – und was für eine Welt ohne Arbeit noch passieren muss.
Macht uns die Krise zu besseren Menschen?
von Maria StichEgal ob Tsunamis, Erdbeben oder Ebola: Jede Katastrophe verursacht zunächst einmal unermessliches Leid. Dass darin aber immer auch die Chance steckt, Hilfsbereitschaft in uns hervorzubringen, beschreibt Juliane Metzker in diesem Artikel. Mit vielen Beispielen aus der Geschichte erzählt sie von Menschen, die einander brauchen und füreinander da sind.
Zu Beginn der Coronakrise gab es auch in Deutschland eine riesige Solidaritätswelle, die über die Monate zunehmend abgeebbt ist. Ich finde es deshalb wichtig, mich immer wieder bewusst daran zu erinnern, wie wir miteinander umgehen möchten. Julianes Text hilft dabei. Er ist ein zeitloser Text, der aktuell und bei künftigen Krisen Hoffnung schenkt: Hoffnung darauf, dass eine solidarische Gesellschaft, worin wir aufeinander achtgeben, möglich ist.
Was Städte lebenswert macht – und wie sie sich jetzt verändern müssen
von Katharina WiegmannSchon der Lockdown im März war für viele Beschäftigte im Einzelhandel eine schwierige Zeit. Nun droht vielen die Insolvenz. Hinter diesen Worten stecken jede Menge persönliche Tragödien, die ich nicht relativieren will. Doch wer die vergangenen Monate mit dem kombinierten Bemühen um Abstand und Ablenkung durch eine deutsche Stadt geschlendert ist, bemerkte Folgendes: Viele Innenstädte sind schon längst verödet. Denn außer Konsum haben sie nicht viel zu bieten.
Orte der Begegnung und des kostenfreien Aufenthalts – ausgestattet mit Sitzgelegenheiten oder Toiletten – gibt es nicht viele. Das Sterben der Stadt als sozialer Raum hat lange vor Corona begonnen. Stefan Boes hat sich in Osnabrück umgesehen und mit einer Einzelhändlerin, einer Umweltwissenschaftlerin sowie einem Stressforscher über die Zukunft von Stadtentwicklung gesprochen. Und er hat mir damit eine spannende neue Forschungsdisziplin nahegebracht: die Neurourbanistik.
Vom Vertrauen in der Krise
von Juliane MetzkerEs gibt wenige Texte, die ich dieses Jahr so vehement Verwandten und Bekannten aufs Auge gedrückt habe, wie diesen Essay von Katharina Wiegmann. Warum? Weil ihr Beitrag zeigt, dass es zwischen Demos gegen Coronamaßnahmen und Kontaktverbote noch viel Raum für demokratischen Diskurs gibt – und dass Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung auch konstruktiv formuliert sein kann. Deshalb ist dieser Artikel für mich ein Must-read 2020.
Das eine Afrika gibt es nicht
von Felix AustenExplodiert die Bevölkerung in Afrika wirklich? Sind die Menschen dort alle bitterarm? Und versinkt der Kontinent kollektiv in Gewalt und Chaos? Seit der Gründung von Perspective Daily zeigt Peter Dörrie immer wieder, dass der afrikanische Kontinent viel mehr ist, als viele oft meinen. Dass seine Geschichten nicht nur uns, sondern auch ihn, der zig Länder auf dem Kontinent bereist hat, immer wieder überraschen können. Und dass Afrika eben nicht überall arm, gefährlich und extrem kinderreich ist.
2020 hat er nochmals eine neue Perspektive gewagt und damit einen hilfreichen Überbau für all seine anderen Geschichten geliefert. In 5 Karten hat er diesmal gezeigt, warum wir »das eine Afrika« vergessen und stattdessen endlich anfangen sollten, uns mit seinen vielen unterschiedlichen Facetten bekannt zu machen.
Endlich den Neoliberalismus verstehen
von Maria StichUm Dinge zu verändern, müssen sie zunächst verstanden werden. Und um sie zu verstehen, hilft es, bei ihrer Geschichte anzusetzen. Chris Vielhaus wollte in diesem Jahr nichts Geringeres, als euch den Neoliberalismus verständlich zu machen.
Im ersten Text seiner 3-teiligen Serie beschäftigt er sich unter anderem mit Friedrich August von Hayek, der in den 20er-Jahren den Grundstein für die einflussreichste Ideologie unserer Zeit gelegt hat. Besonders augenöffnend fand ich, dass unsere aktuelle Wirtschaftsform – die maßgeblich für die Spaltung von Arm und Reich sowie die Klimakrise mitverantwortlich ist – nicht auf einer wissenschaftlichen Basis beruht. Der Text ist für alle lesenswert, die das Gefühl teilen, dass mit dem Neoliberalismus so einiges schiefläuft – und wir gleichzeitig viel zu wenig darüber wissen.
Titelbild: Cookie the Pom - CC0 1.0