Wenn wir nicht mehr anders können, als online zu gehen
Regierung und Mediziner warnen immer eindringlicher vor grassierender »Internetabhängigkeit«. Bisher hielt ich das für übertrieben, doch dann kam Jan.
Neulich beim Abendessen in der WG:
Ich habe in den letzten Wochen nicht viel sonst gemacht und bis zu 24 Stunden am Stück im Internet Videos geschaut. Vielleicht noch aufstehen, um auf die Toilette zu gehen oder zu essen – bis spät nachts; einfach immer weiter, bis ich vor Erschöpfung dann eingeschlafen bin. Ich denke, ich bin süchtig.
Über seinen Nachtisch-Teller mit Bananeneis hinweg lächelte uns unser Mitbewohner
Aber ist Jan wirklich abhängig? Und wenn ja, wovon? Vom Internet? Tatsächlich würde das zum Thema des Jahres 2016 der
Haben wir es im Zeitalter der Digitalisierung mit neuen Formen von
Die nächste Folge beginnt in 5, 4, 3 Sekunden
Als ich hier nach Deutschland kam, hatte ich außerhalb der Schule nicht wirklich etwas anderes zu tun. Die Filme waren am Anfang nur Zeitvertreib. Doch das wurde langsam immer häufiger – bis ich mich regelmäßig kaputt fühlte.
Möglich wird Jans Verhalten durch sogenannte Video-on-Demand-Dienste wie Netflix, Amazon-Prime und Maxdome. Sie nehmen ganze Staffeln einer Serie auf einmal ins Angebot auf. Dabei startet die nächste Folge automatisch, wenn das nicht aktiv vom Zuschauer verhindert wird. Keine Lust mehr auf eine bestimmte Serie? Kein Problem. Video-on-Demand-Portale werten die Gewohnheiten des Zuschauers aus und schlagen

Dadurch haben Internet und Video-on-Demand-Dienste die Fernsehgewohnheiten
Zu Beginn habe ich gezielt die interessantesten Sachen aus dem Angebot ausgewählt. Zum Schluss habe ich wahllos fast alles gesehen, außer Horror. Die nächste Folge, der nächste Film fängt ja immer automatisch an, wenn man nichts tut.
Video-on-Demand-Dienste werten dieses

»Das Schöne an Netflix ist, dass sich Serien unabhängig von Stimmung oder Anlass für einen Serienmarathon finden lassen.« – Cindy Holland von Netflix
Auch Medien greifen die Abhängigkeits-Metapher ungeniert auf und titelten beispielsweise
Als er versuchte, von Video-on-Demand loszukommen, stieß er im Internet auf ein anderes verlockendes Angebot: Mobile Games.
Login: Die Flucht in die Welt der Spiele
Ich habe dann Handy-Spiele gespielt und viele Gratis-Spiele aus dem App-Store heruntergeladen – bis ich gemerkt habe, dass auch diese viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Dann habe ich versucht, die Apps zu deinstallieren, und immer wieder installiert. Viele Male.
Während Binge Watching bisher kaum erforscht ist, stehen digitale Spiele bereits eine Weile
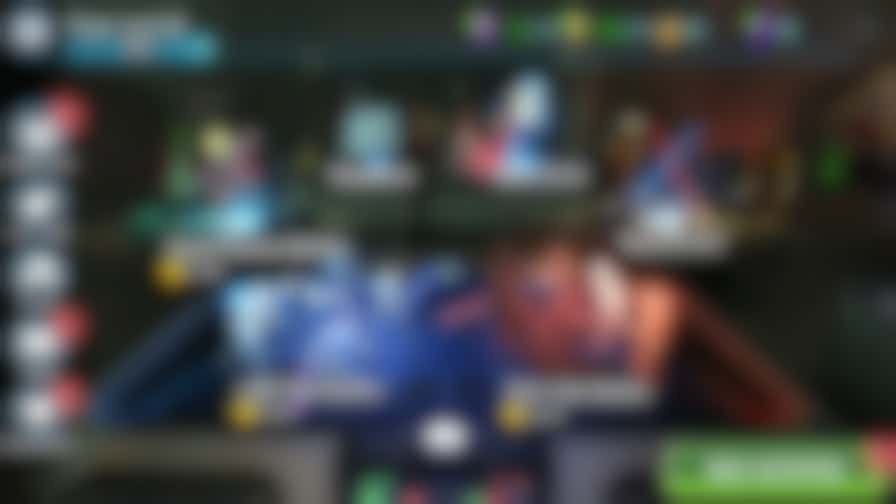
Exzessive Spieler sind hier besonders willkommen und passen zum Geschäftsmodell der Anbieter. Für sie sind diese Nutzer »Die Art und Weise, wie unsere Industrie über Whales spricht, ist im Kern entmenschlichend.« –
Diese spielen nicht nur lange, sondern stecken auch viel Geld in eigentlich kostenlose Apps
Das lohnt sich für Anbieter so sehr, dass einige Games gezielt auf die Gewohnheiten der exzessiven Spieler ausgerichtet werden: Dazu gehören »Ich werde kein Spiel spielen oder empfehlen, von dem ich glaube, dass es kostenloses Spielen durch die Ausbeutung von abhängigen Spielern finanziert.« – Richard Garfield, A Game Player’s Manifesto
In der Gaming-Szene ist dies mittlerweile
Wie aber können wir Games erkennen, die exzessives Verhalten fördern? Die kurze
- Das Spiel wird kostenlos angeboten, bietet aber Vorteile im Spiel, die den Spielverlauf beschleunigen, wenn bezahlt wird.
- Das Spiel hat eine Mechanik, die das Spielverhalten reguliert, zum Beispiel tägliches Einloggen, um »Energie« zum Spielen zu erhalten.
- Das Spiel fördert den Sammeltrieb als Spielelement und gibt Belohnungen nach dem Zufallsprinzip aus.
- Das Spiel enthält eine Rangliste (oder andere Vergleichsmöglichkeiten) und bietet unfaire Vorteile gegenüber anderen Spielern für echtes Geld an.
- Das Spiel hat kein erkennbares Spielende.

Für Jan boten die Mobile-Games keinen Ausstieg, sondern quasi einen Ersatzstoff. Er hatte die Kontrolle verloren, mit spürbaren Auswirkungen auf sein Leben. Eine Zeit lang wechselte er zwischen Filmen und Spielen hin und her. Er erzählt, wie er in seinem Sozialleben immer unzuverlässiger wurde – vor allem, wenn es um das Einhalten von Terminen und Pflichten ging.
Ich hatte immer weniger Selbstbeherrschung und tauchte lieber in diese andere Welt ab. In Gesprächen konnte ich teilweise gar nicht mehr klar denken.
So konnte es nicht weitergehen.
Niemand wird »einfach so« vom Nutzer zum Patienten
Halten wir fest: Unterhaltung mit Computer und Smartphone ist so verlockend und bequem, dass der Konsum außer Kontrolle geraten kann. Aber wo kommt das wirklich her? Und wie schlimm kann es werden?
Dazu befrage ich Bettina Bicknese. Die Psychotherapeutin kennt die Ausprägungen von »Internetabhängigkeit« gut und hat sie bei vielen Patienten erlebt. Sie arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, die unter psychischen Störungen leiden – insbesondere exzessivem Spielen an Smartphone oder Computer. Als ich mit ihr über Jan spreche, erklärt sie, wie
Es scheint erst einmal eine Geschlechtertendenz zu geben. Jungs haben eine höhere Affinität, was actionreiche Spiele und Filme betrifft. Da gibt es einen regelrechten Hype, die heftigsten Bilder auf den Bildschirmen ertragen zu können und abgehärtet zu sein. […] Mädchen sprechen eher auf eine Dauerpräsenz in sozialen Medien und Foren an. Da spielt meist Angst vor Mobbing und Ausgrenzung im Hintergrund eine Rolle.
Wichtig ist hierbei, dass
Diese Jugendlichen sind im wirklichen Leben meist nicht die erfolgreichsten Schüler, nicht die Sunnyboys und nicht die erfolgreichen Stürmer der Fußballmannschaft aus glücklichen, intakten Familien.
Die psychosozialen Belastungen wirken dabei oft als Einstiegsfaktoren und machen die Flucht ins Digitale erst plausibel. Auch für Jan wirkten die Digitalen Medien so. Er vermisste seine Freunde aus der Heimat und der schüchterne, junge Mann fand in Deutschland einfach keine neuen. Filme lenkten ihn ab und Mobile Games gaukelten sogar Freundschaften vor. Das Zauberwort hier lautet: Multiplayer, also die Vernetzung der Nutzer.

Dadurch entsteht ein Gruppendruck, aktiv mitzumachen und nicht auszusteigen. Der Trend auf dem Mobile-Markt geht zu mehr
Für Wissenschaftler, Mediziner und Therapeuten sind diese neuen Formen von Abhängigkeitsverhalten nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Neurowissenschaftler untersuchen bereits die
- beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Internet und denkt häufig über internetbasierte Tätigkeiten nach.
- zeigt Entzugssymptome, wenn das Internetangebot nicht zur Verfügung steht (reizbar, ängstlich, traurig)
- zeigt eine
- hat versucht das Verhalten zu kontrollieren, ist dabei aber gescheitert.
- verliert das Interesse an Hobbys oder Offline-Aktivitäten.
- täuscht Bezugspersonen über das Ausmaß der Online-Tätigkeit.
- versucht mit der Tätigkeit, negative Emotionen (etwa Hilflosigkeit, Schuld oder Angst) zu lindern.
- gefährdet wichtige Beziehungen oder den Beruf durch das Verhalten.
Probleme mit der »Internetabhängigkeit«
Ohne Therapie, das betont Bettina Bicknese, finden viele Jugendliche nicht allein den Weg aus der »rauschhaften, schnelllebigen und faszinierenden Internetwelt zurück in den nüchternen Alltag«. Doch nicht nur in Deutschland stehen dabei einige Probleme im Weg:
Mangelnde Diagnose-Möglichkeiten: Bevor eine Abhängigkeit therapiert werden kann, braucht es zunächst eine Diagnose und eine Krankenkasse, die die Behandlung zahlt. Psychische Leiden werden dafür anhand eines internationalen Katalogs namens
Die Behandlungswüste: Selbst mit einer passenden Diagnose und Finanzierung durch eine Krankenkasse ist bei »Internetabhängigkeit« keine Behandlung garantiert – es mangelt schlicht an
In der Behandlung muss auch für eine ausreichende Ernährung, Körperpflege, soziale Kompetenzen und einen gesunden Tag-Nacht-Rhythmus gesorgt werden. Diese Bereiche sind bei schweren Fällen häufig stark vernachlässigt.

Andere Therapeuten haben ein grundsätzliches Problem mit der Definition der Diagnose »Internetabhängigkeit«. So etwa Karsten Strauß. Er leitet ein Institut für Suchtmedizin in Schleswig-Holstein und arbeitet vor allem mit Patienten, die unter stoffgebundenen Abhängigkeiten (wie etwa
Seine Argumentation: Schließlich konnte jeder, der es wollte, schon in den 1980er-Jahren in Automaten-Spielhallen Tage und Nächte durchzocken oder mit Videokassetten Fernsehmarathons starten. Das Internet hat aus dieser Perspektive nicht zu neuen Abhängigkeiten geführt, sondern nur die Einstiegshürden für exzessives Verhalten gesenkt. Karsten Strauß betont den Unterschied zur klassischen, stoffgebundenen Sucht:
Abhängigkeit und Sucht werden in unserer Gesellschaft viel zu inflationär gebraucht. Was beim einen als Verhalten im Rahmen seiner Arbeit normal ist, gilt beim anderen als abhängig krank. Aber nicht jedes auffällige oder auch exzessive Verhalten ist per se problematisch oder muss krankheitswertig sein. Wer solcherart Verhalten mal mit einer Alkoholabhängigkeits-Erkrankung vergleicht, erkennt deutliche Unterschiede in der Qualität. Abhängigkeit ist eine sehr schwere, langfristige und nicht selten sogar tödliche Erkrankung.
Nicht immer muss auffälliges oder exzessives Verhalten mit einer stationären Therapie behandelt werden. Häufig reicht auch ein
Dauerhaft Ausschalten geht nicht – deshalb: Vorbeugen
Die Verlockung der Digitalen Welt steckt mit dem Smartphone in fast jeder Tasche. Wir haben uns an eine unbegrenzte Nutzung des Internets im Alltag gewöhnt. Apps dienen nicht nur zur Unterhaltung, sondern helfen uns dabei, unser Leben zu strukturieren, zu reisen und unser Essen auf den Tisch zu stellen. Das macht es nicht einfacher, ungesundes Verhalten zu bemerken. Doch der »Technik« den Schwarzen Peter zuzuschieben, wäre zu einfach.

Das findet auch Martin Müsgens. Er ist Referent bei der Initiative klicksafe bei der Landesanstalt für Medien NRW (LfM). Das Smartphone ganz abzuschaffen, hält er in den meisten Fällen für kontraproduktiv: »Wer das versucht, erlebt in gewisser Weise eine
Mediziner und Politiker fordern deshalb
Je früher Eltern sich für das interessieren, was Kinder mit Medien machen, desto besser. Hier gilt es, Kinder dabei zu unterstützen, die digitalen Angebote Schritt für Schritt kennenzulernen und entsprechende Kompetenzen aufzubauen. Regelmäßiger Austausch über Medienerfahrungen ist ebenfalls wichtig. Gerade beim Thema digitale Spiele gibt es jetzt aber auch zunehmend eine junge Elterngeneration, die damit selbst aufgewachsen ist und die Angebote besser einschätzen kann.
Dazu gehört natürlich auch, dass wir unsere eigenen Gewohnheiten überprüfen und als Beispiel vorangehen: Denn es hilft nichts, wenn wir selbst immer wieder »nur eben schnell« was mit dem Smartphone nachschauen.
FAQ: Und was wird aus Jan?
Zurück zu Jan. Einige Wochen vor unserem Gespräch beim Abendessen hatte er Computer und Smartphone seiner Schwester gegeben, um »nicht mehr in Versuchung zu kommen«. Das hielt jedoch nur ein paar Tage, bevor er für ein Projekt zurück an den Bildschirm musste und alles von vorne begann. Ein Lehrer in seiner Schule erkannte das Verhalten und bot Unterstützung an:
Er hat mich darauf angesprochen und wir haben gemeinsam darüber geredet. Er hat mir gesagt, dass ich mir Hilfe holen soll. Letzte Woche hatte ich dann mein erstes Gespräch mit einer Sozialpädagogin.

Titelbild: Joe (bearbeitet) - CC BY 3.0




