Warum du glaubst, dass du zu wenig Zeit hast, und wie du dich endlich von diesem Denken befreist
Wir ertragen den Stillstand nur schwer, weil wir so wenig Zeit, aber so viele Ziele haben. In diesem Text lernst du das Denkmuster kennen, das unser Leben bestimmt – und wie wir es überwinden.
In meiner Kindheit habe ich früh gelernt, dass die Welt kein friedlicher Ort ist. Ich habe das nicht auf der Straße gelernt, auf der ich mit meinen Freunden spielte, nicht im Wald, wo wir Verstecke bauten, nicht auf dem Fußballplatz, wo wir gegen die Jungs aus der Nachbarsiedlung antraten. Ich erfuhr es jeden Abend, wenn in unserem Wohnzimmer die Nachrichten liefen, die immer wieder Bilder von Krieg, Hunger und Gewalt zeigten. Panzer fuhren auf unbefestigten Straßen durch zerstörte Dörfer, Kinder hungerten und konnten nicht in die Schule gehen. Nichts verband mich mit ihnen, doch durch sie verstand ich, dass die Welt gefährlich ist.
Die Nachrichten gingen vorüber. Am nächsten Tag ging ich in die Schule, spielte Fußball und lief im Wald herum. Hier deutete nichts darauf hin, dass irgendetwas auf diesem Planeten nicht stimmen könnte. Ich war in Sicherheit.
Immer mehr Menschen begreifen, dass wir etwas zu verlieren haben.
Die beiden existenziellen globalen Krisen unserer Zeit, die Pandemie und der Klimawandel, zeigen uns, dass vieles, was uns als selbstverständlich erscheint, auf dem Spiel steht.

Wie sähe ein Leben aus, in dem wir genug Zeit haben für alles, was uns wichtig ist? In seinem neuen Sachbuch zeigt der Soziologe und Perspective-Daily-Autor Stefan Boes, wie eine Zeitwohlstandsgesellschaft aussehen könnte, die uns ein Leben in dem Tempo ermöglicht, das wirklich zu uns passt. Jetzt »Zeitwohlstand für alle« bestellen!.
Bildquelle:In einer Pandemie trübt noch etwas anderes die Sehnsucht nach einer heilen Welt. Das um sich greifende Coronavirus macht jeden Ort zu einem potenziell gefährlichen. Selbst die Wälder, Parks und Seepromenaden sind jetzt oft so voll mit Menschen, dass ich den gebotenen Abstand nicht immer einhalten kann. Es gibt keinen Ort, an dem nicht die Gefahr einer folgenschweren Covid-19-Infektion droht.
Ich glaube, immer mehr Menschen begreifen, dass wir etwas zu verlieren haben. Für meine Generation ist das besonders schwer zu akzeptieren. Ich bin 1987 geboren und kenne aus eigener Erfahrung nichts anderes als Frieden, Wohlstand, Freiheit und eine Gesundheitsversorgung, die mir ein gesundes Leben bis ins hohe Alter ermöglicht. Ich gehöre der glücklichen Gruppe jener an, die das eigene Leben weitgehend störungsfrei gestalten können. Viele von uns haben die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen.
Was ich gerade gesagt habe, weiß alle Welt, doch man macht sich selten bewusst, dass die Zahl der Jahre, die uns zugedacht ist, keine bloße quantitative Gegebenheit, kein äußeres Charakteristikum ist (wie die Länge der Nase oder die Farbe der Augen), sondern Teil der Definition des Menschen. Derjenige, der bei bester Gesundheit zweimal so lange, sagen wir also einhundertsechzig Jahre leben könnte, würde nicht derselben Spezies angehören wie wir. Nichts in seinem Leben wäre mehr genauso, weder die Liebe noch die Ambitionen noch die Gefühle noch die Nostalgie, nichts.
Die Vorstellung, dass unsere Lebenszeit klar umrissen ist, gibt uns einen Rahmen für die Art, wie wir uns entscheiden zu leben. An die religiöse Verheißung eines ewigen Lebens glauben die meisten von uns nicht mehr.
Ist das viel oder wenig? Wenn ich über meinen Lebensrhythmus nachdenke, scheint meine Zeit knapp zu sein. Ich beeile mich mit meinem Leben.

In diesem Text möchte ich erklären, warum ich das tue. Es sind nicht nur äußere Zwänge, die mich veranlassen, schneller zu werden, mehr zu leisten, mehr zu erledigen und zu erleben. Es ist eine Lebensstrategie, die ich bewusst anwende. Eine Strategie, die mich – und meiner Meinung nach auch viele andere Menschen – aber nicht ausgeglichen und zufrieden macht, sondern erschöpft. In diesem Text versuche ich, das Denkmuster zu identifizieren, das unsere Gesellschaft seit Jahrhunderten dazu antreibt, immer schneller zu werden, weil uns scheinbar die Zeit fehlt. Und ich werde beschreiben, wie wir es am Ende schaffen können, dieses Denkmuster zu überwinden.
Wir verdichten unser Leben, um mehr davon zu haben
Die Erwartung, dass ich ein langes Leben führen kann, ohne dass mich jemand großartig dabei stört, habe ich, seit ich denken kann. Zeit zu haben ist ein Privileg. Seltsam, denn häufig fühlt es sich an wie ein Konflikt: All der Zeitdruck, der Stress, die Entscheidungen, die wir treffen müssen, führen ja auch zu echten Belastungen, möglicherweise sogar zu Krankheiten,
Wir erleben viele Tätigkeiten als Pflichten, obwohl uns niemand zwingt, sie zu tun.
Das klingt vielleicht zunächst nicht ganz richtig. Im Beruf weiterkommen, Sport machen, das Buch lesen, den Urlaub planen, die Weihnachtsgeschenke kaufen – das muss ich doch nun einmal tun. Wir erleben diese Tätigkeiten aber nicht deshalb als Pflichten, weil jemand uns zwingt, sie zu tun. Dass wir die ganze Zeit so beschäftigt sind, ist vielmehr das Ergebnis von Entscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben. Diese Entscheidungen haben zu Routinen im Umgang mit der Zeit geführt. Wir überlasten uns aus Gewohnheit.
Dass das ein Luxusproblem ist, wird deutlicher, wenn wir uns jemanden vorstellen, der oder die nur sehr begrenzt über die eigene Zeit verfügen kann.
Aber auch diejenigen, die erfolgreich im Berufsleben verankert sind, haben wenig Zeit. Flexible Arbeitszeitmodelle sind noch nicht überall durchgesetzt,
Wer die eigene Zeit freier gestalten kann, sollte das doch dann eigentlich nicht als Konflikt erleben, sondern als Freiheit. Natürlich sind diese Freiheiten begrenzt. Alle Menschen müssen bestimmte Pflichten erfüllen. Ich versuche mir als Vater, der häufig 40 oder mehr Stunden pro Woche arbeitet, hier und dort ein paar Freiräume zu schaffen. Innerhalb dieser Freiräume denke ich dann aber meist nicht, dass ich etwas tun oder lassen kann, zum Beispiel einfach ausruhen.
Ich glaube stattdessen, etwas tun zu müssen. Sobald ich etwas Freizeit habe, denke ich an meine To-do-Liste. An den Garten, den unaufgeräumten Dachboden, an das Buch, an dem ich weiterarbeiten möchte, an die Kinderfotos, die ich auf dem Computer sortieren will, an die Schlagzeugfelle, die mal wieder gewechselt werden müssen, und an die Menschen und Orte, die ich mal wieder besuchen sollte.
Aber warum denke ich überhaupt, dass ich all das tun muss? Warum gerate ich auch dann mit der Zeit in Konflikt, wenn ich frei darüber verfügen kann?
»Jede Entscheidung, die getätigt wird, ist eine zerstörte Möglichkeit.« – Helga Nowotny, Zeitsoziologin
Die Grundlage für diesen Konflikt ist zunächst einmal eine essenzielle menschliche Lebenserfahrung. Sie lässt sich mit dem aus der Systemtheorie stammenden Begriff »Kontingenz« beschreiben. Kontingenz bedeutet die Notwendigkeit, aus Alternativen auswählen zu müssen. Es gibt immer eine ganze Reihe verschiedener Optionen. Daraus selektieren wir, obwohl wir auch eine ganz andere Option hätten wählen können: einen anderen Beruf, eine andere Lebenspartnerin, einen anderen Wohnort, ein anderes Reiseziel, ein anderes Produkt, eine andere Tätigkeit, mit der wir unseren Tag verbringen.
Kontingenz bedeutet: Alles könnte auch anders sein. Das heißt, wir wissen, dass wir nichts zwangsläufig, notwendigerweise und ohne die Kenntnis von Alternativen tun. »Jede Entscheidung, die getätigt wird, ist eine zerstörte Möglichkeit«, schreibt Helga Nowotny in ihrem Klassiker der Zeitsoziologie, »Eigenzeit«.
Wenn wir schon Möglichkeiten zerstören, dann sollten wir natürlich wenigstens sicher sein, dass wir die beste Möglichkeit gewählt haben. Wir wissen schließlich: Es liegt an uns, ob wir das Beste aus unserem Leben herausholen oder nicht. Unsere Entscheidungen sollten nicht zu irgendeiner Art zu leben führen, sondern zu der bestmöglichen. Keine leichte Aufgabe, wenn niemand uns sagt, wie wir leben sollen und welche Folgen das haben wird, was wir tun. »Die Zeit des Handelns enthält immer Elemente der Entscheidung; sie ist konfrontiert mit der Ungewissheit des Ausgangs«, schreibt Nowotny.
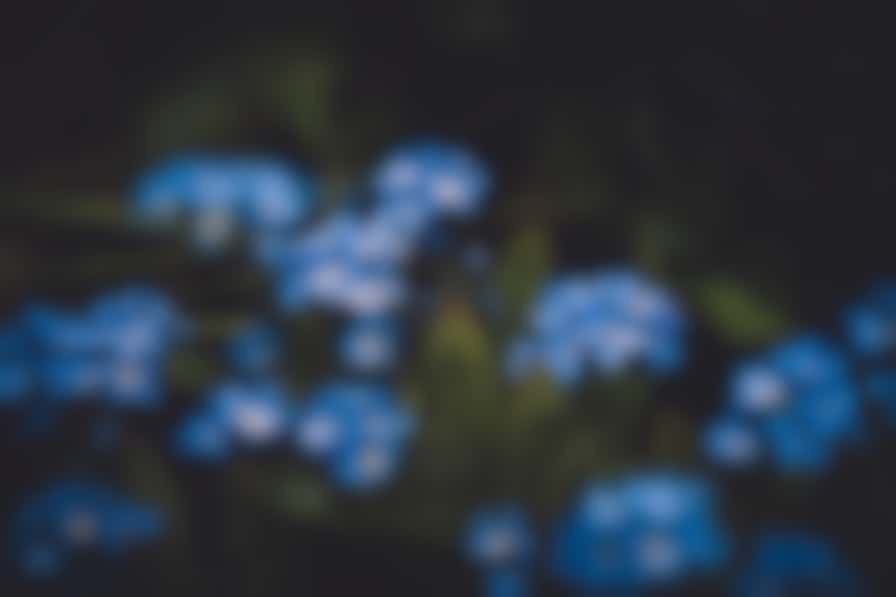
Wir sind gezwungen, frei zu sein
Das Privileg, das eigene Leben gestalten zu dürfen, kann aber, wie schon gesagt, ernsthafte gesundheitliche Folgen haben, die alles andere als Luxusprobleme sind. In seiner berühmten Depressionsstudie »Das erschöpfte Selbst« erläutert der französische Soziologe Alain Ehrenberg, wie die modernen kapitalistischen Demokratien uns aus traditionellen Bindungen befreit und einen sozialen Individualisierungsprozess eingeleitet haben. Wir seien nach und nach in die Situation versetzt worden, für uns selbst entscheiden und unsere Orientierungen konstruieren zu müssen. Wir seien reine Individuen geworden. Keine Tradition sage uns mehr, wer wir zu sein haben und wie wir uns verhalten müssen.
»Die Depression ist die Krankheit einer Persönlichkeit, die versucht, nur sie selbst zu sein.« – Alain Ehrenberg, Soziologe
»Das Recht, sich sein Leben zu wählen, und der Auftrag, man selbst zu werden, verorten das Individuum in einer ständigen Bewegung«, schreibt Ehrenberg. Die neue Souveränität des Individuums führe durch die »Last des Möglichen« zur Fatigue d’être soi, wie es im Originaltitel heißt, zur Müdigkeit, man selbst zu sein. Ehrenberg sieht darin einen wesentlichen Grund für die Zunahme psychischer Erkrankungen wie Depressionen.
Die Depression sei »nicht die Krankheit des Unglücks, sondern die Krankheit des Wechsels, die Krankheit einer Persönlichkeit, die versucht, nur sie selbst zu sein: Die innere Unsicherheit ist der Preis für diese Befreiung«, so Ehrenberg. Ab den 80er-Jahren, sagt er, sei die Depression in einer Symptomatik aufgetreten, bei der nicht so sehr das psychische Leiden als vielmehr die Hemmung und Verlangsamung dominieren. »Die Depression ist das Geländer des führungslosen Menschen, sie ist nicht nur sein Elend, sondern das Gegenstück zur Entfaltung seiner Energie«, schreibt Ehrenberg.
Mit den krankheitsbedingt mangelnden Projekten, der mangelnden Motivation und der mangelnden Kommunikation sei der Depressive das genaue Negativ zur geltenden sozialen Norm.
Diese Norm besagt: Wir sind freie Individuen und der einzige Auftrag, den wir erfüllen müssen, besteht darin, das beste aller Leben zu leben und ganz man selbst zu sein.
Das, was wir tun wollen, wird zu etwas, was wir erledigen müssen.

Für Ehrenberg sind psychische Leiden wie Depressionen eine Reaktion auf die allgegenwärtige Erwartung, das eigene Leben selbstbestimmt zu gestalten. Wir sind gezwungen frei zu sein – und jetzt liegt es an uns, glauben wir. Also müssen wir das Beste aus unseren unbegrenzten Möglichkeiten machen. Wir glauben: Erfolg und Misserfolg hängen allein von unserer eigenen Leistung ab.
So, als gäbe es kein Glück, kein Unglück, keine Ungleichheiten, keine Benachteiligung, keine sozialen Klassen, keine individuellen Grenzen unseres körperlichen und psychischen Leistungsvermögens. Wenn wir scheitern, dann an uns selbst. Und sich nicht selbst zu verwirklichen, nicht erfolgreich zu sein, sich zu langweilen, statt aufregende Dinge zu erleben – wäre das nicht ein gescheitertes Leben?
Für den Soziologen Andreas Reckwitz sind Selbstentfaltung, sozialer Erfolg und die Vermehrung positiver Emotionen die Kernelemente unseres Lebenssinns geworden. Wir haben den Anspruch, dass unser Leben möglichst dicht an positiven Erlebnissen sein soll, damit es sich wie ein erfülltes Leben anfühlt, schreibt er in seinem aktuellen Buch »Das Ende der Illusionen«.
Die spätmoderne Kultur verspricht dem Individuum subjektive Erfüllung in einer Weise wie keine zuvor und suggeriert ihm, ein Recht auf dessen Realisierung zu besitzen, und lässt doch immer wieder diese subjektive Erfülltheit als ein Phantasma scheinen, dem das reale eigene Leben – außer vielleicht in bestimmten, herausgehobenen Momenten – kaum je genügt.
Auf der Suche nach Erfüllung optimieren wir uns, wir vermehren unsere Möglichkeiten, beschleunigen unsere Handlungen. Um alles besser zu organisieren, landen unsere Vorhaben auf imaginierten To-do- und Bucketlisten. Das, was wir tun wollen, wird zu etwas, was wir erledigen müssen.
Auf uns liegt die schwere Last des Möglichen.
Wir haben keine Zeit, obwohl wir sie im Überfluss gewinnen: der Zeit-Rebound-Effekt
Solange wir die Idee verfolgen, dass wir alles sein und haben können, laufen wir Gefahr, unter der Last der unbegrenzten Möglichkeiten zusammenzubrechen. Wenn alles auch anders sein könnte, könnte das andere auch immer besser sein. Je mehr Optionen wir haben oder zu haben glauben, desto schwerer fällt es uns, mit der Kontingenz unseres Tuns fertig zu werden.
Wir müssen uns selbst, aber auch anderen erklären können, warum wir das eine tun und das andere lassen. Und wenn wir uns entschieden haben, müssen wir uns zeitlich organisieren: unsere langfristig verfolgten Lebensziele genauso wie die kurzfristigen Entscheidungen in täglichen Zeitstrukturen. Der Tag hat nur 24 Stunden, die Anzahl der Dinge, die wir erleben und konsumieren können, ist aber unendlich.
Wir hören Podcasts, damit wir nebenbei noch etwas anderes erledigen können.
Um möglichst vieles davon tun zu können, hilft es – so glauben wir –, unser Leben zu verdichten. Wir beantworten Nachrichten, während wir auf den Bus warten. Wir hören Podcasts, damit wir nebenbei noch etwas anderes erledigen können. Wir meditieren ein paar Minuten mit einer App, damit wir schnell wieder klar und ausgeglichen sind.
Das alles folgt einer Strategie: Wir erhöhen unsere Lebensgeschwindigkeit, damit wir scheinbar mehr vom Leben haben. Zufällig habe ich gerade ein Zitat von Roger Willemsen gelesen, der ziemlich treffend beschrieben hat, was wir da versuchen: »Wir beschleunigen das Leben in der Angst, wir könnten es verpassen. Und indem wir es beschleunigen, verpassen wir es.«

Aber wie kann das eigentlich sein, dass wir ständig versuchen, noch schneller zu sein, obwohl wir dank des technischen und sozialen Fortschritts Zeit im Überfluss gewonnen haben?
Im Gegenteil: Die Möglichkeiten scheinen nur noch größer zu werden. Wir brauchen eigentlich noch mehr Zeit, um alles zu schaffen. Also nehmen wir das Smartphone in die Hand, bestellen Essen, um nicht kochen zu müssen, bestellen Saugroboter, um nicht saugen zu müssen, schreiben Nachrichten, um nicht anrufen zu müssen, checken Newswebsites, um nicht Zeitung lesen zu müssen, bleiben aus Gewohnheit bei Instagram hängen und stoßen dort, nach vielleicht einer halben Stunde vergeudeter Zeit auf ein Zitat von Roger Willemsen, das uns sagt, was wir schon wissen: dass wir auf absurde Weise unsere Zeit vergeuden.
Wir müssen uns damit abfinden, dass nicht alles, wonach wir streben, in unserer Reichweite liegt.
Dieses paradoxe Phänomen wird häufig auch als »Zeit-Rebound-Effekt« beschrieben. Das bedeutet: Wir wenden zeiteffiziente Techniken an, womit wir aber nur scheinbar Zeit einsparen. So benutzen wir zum Beispiel Trockner und Mikrowellen, hören Podcasts, betreiben Multitasking, füllen Warte- und Pausenzeiten mit Erledigungen. All diese Techniken sollten uns dann eigentlich mehr freie Zeit verschaffen. Wir könnten uns zum Beispiel ausruhen, während der Saugroboter die Wohnung für uns reinigt.
Doch die Zeitersparnis legen wir sofort als neuen Standard fest. Die frei gewordene Zeit ermöglicht es uns, viele weitere Dinge zu tun, die sich ebenfalls in kurzer Zeit erledigen lassen. Der Zeit-Rebound-Effekt besagt, dass die zeitsparenden Techniken nicht in eine höhere Qualität der Zeit investiert werden, sondern dass sie unseren Anspruch verändern und die Nachfrage nach weiteren zeitsparenden Techniken steigt. Wir vermehren und verdichten unsere Erlebnisse. Dazu beschleunigen wir unser Lebenstempo.
Vielleicht können wir weitere Strecken zurücklegen, häufiger mit unseren Freund:innen kommunizieren, mehr Podcasts hören und mehr Sachbücher lesen, weil das dank der entsprechenden App nur noch 30 Minuten dauert. Gerade die digitalen Geräte und Dienste ermöglichen es uns, langwierige Tätigkeiten deutlich schneller auszuführen.
Doch in der digitalen Welt steigt wiederum die Zahl der Optionen, die wir realisieren können. Schon 1988 schrieb die Zeitsoziologin Helga Nowotny:
Den Menschen ist vor allem durch die modernen Kommunikationsmittel bewusster geworden, wie sie ihre Tage oder Stunden sonst verbringen könnten. Sie erleben daher den Mangel an Zeit deutlicher. Wann immer sie sich auf eine Information konzentrieren, versagen sie sich die Möglichkeit, sich auf eine andere voll zu konzentrieren.
Es gibt immer noch ein Sachbuch, das wir in der App konsumieren können. Noch eine Podcastfolge, noch eine Nachricht, die wir beantworten sollten. Noch ein Video, das wir sehen sollten, nachdem es viral gegangen ist. Noch einen Artikel, der eine neue Sichtweise bereithält und auf unserer Leseliste landet. Doch es ist egal, wie schnell wir werden, wie viel wir gleichzeitig tun können. Wie sehr wir auch unsere Möglichkeiten steigern, wie viel wir auch erleben, wie groß unsere Reichweite auch immer sein wird, wir kommen doch nie an den Punkt, an dem wir sagen: Jetzt ist es gut.
Ist es das, was wir wirklich wollen? So wollen wir leben? Oder sehnen wir uns nicht nach einer ganz anders gelebten Zeit?
Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass wir alles sein und haben können
»Unser Leben wird besser, wenn es uns gelingt, (mehr) Welt in Reichweite zu bringen«, so laute das unausgesprochene Mantra des modernen Lebens, schreibt der Soziologe Hartmut Rosa in seinem aktuellen Buch »Unverfügbarkeit«. Dabei begegneten wir der Welt zunehmend auf aggressive Weise. »Alles, was erscheint, muss gewusst, beherrscht, erobert, nutzbar gemacht werden.«
Als Beispiel dafür nennt Rosa unser Verhältnis zum eigenen Körper: »Alles, was wir an ihm wahrnehmen, steht tendenziell unter Optimierungsdruck.« Das Gewicht sollte reduziert, der Blutdruck gesenkt und die Schrittzahl erhöht werden. Wir müssten außerdem auch gelassener und achtsamer sein und so weiter.

Aber auch das, was uns außerhalb unserer selbst begegne, trage diesen Aufforderungscharakter: »Berge sind zu besteigen, Prüfungen zu bestehen, Karrierestufen zu nehmen, Liebhaber zu erobern, Orte zu besuchen und zu fotografieren, Bücher zu lesen, Filme zu sehen«, schreibt Rosa. Unser Leben erschöpfe sich mehr und mehr in der Abarbeitung von explodierenden To-do-Listen. Egal was wir tun, wir müssten es »erledigen, besorgen, wegschaffen, meistern, lösen, absolvieren.«
Es ist natürlich kein Wunder, dass sich so niemals das Gefühl einstellt: Jetzt kann ich endlich einmal innehalten. Jetzt ist es genug. Jetzt habe ich endlich einmal Zeit.
Aber wie können wir dem Zeitdruck widerstehen? Wie könnte es sich einstellen – das Gefühl, in der richtigen Geschwindigkeit zu leben und auch wirklich präsent im eigenen Leben zu sein?
Die Lösungen dafür liegen auf verschiedenen Ebenen:
- Unverfügbarkeit akzeptieren: Für Hartmut Rosa liegt die Lösung für unser Streben nach Steigerung in sämtlichen Lebensbereichen in der Akzeptanz des Unverfügbaren. Eine vollständig verfügbar gemachte Welt wäre eine tote und stumme Welt, sagt er. Glückserfahrungen machen wir hingegen dann, wenn wir einer Sache gegenüberstehen, die wir nicht einfach so verfügbar machen können: der Schneefall im Winter, die tiefe Beziehung zu einem Menschen, das berührende Konzert, die gelungene Party – das alles ist erreichbar, aber es lässt sich nicht sicher verfügbar machen, kontrollieren und beherrschen. Gelingendes Leben, sagt Rosa, vollziehe sich an der Grenze von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit.
- Suffizienz statt Wachstum: Wachstum ist nicht allein das Ziel von Unternehmen und kapitalistischen Demokratien. Der Kapitalismus ist keine Wirtschaftsform, sondern eine Kultur. Auch als Individuen streben wir im Kapitalismus nach persönlichem Wachstum. Wenn wir uns aber so weit wie möglich dem Wachstumsdenken entziehen, Konsum reduzieren, Effizienz verweigern, nicht ständig nützlich sein wollen – dann werden wir freier. Und können so eine neue Kultur der Genügsamkeit etablieren, die angesichts der Klimakrise ohnehin Realität werden muss.
- Arbeitszeit reduzieren: Ein selbstbestimmter Umgang mit der Zeit kann nur dann gelingen, wenn wir auch über unsere Zeit verfügen können. In der Regel dominiert die Erwerbsarbeit unser Leben. Die Möglichkeit, weniger und flexibler zu arbeiten, könnte unseren eng getakteten Alltag entspannen und Freiräume für andere Dinge schaffen.
- Eigenzeiten etablieren: Die Gesellschaft hat ihre eigenen Zeitstrukturen und wir versuchen, mit dem Tempo unserer Umwelt mitzuhalten – uns zu synchronisieren. Die Arbeitswelt, die digitale Nachrichtenwelt, die neuen Kommunikationstechnologien geben ein Tempo vor, das häufig nicht mit dem unseres eigenen Lebens übereinstimmt. Je besser es uns gelingt, die eigene, passende Lebensgeschwindigkeit zu finden und uns so viel Zeit zu nehmen, wie wir für etwas brauchen, desto geringer ist das Risiko, in Eile zu geraten, gestresst und überfordert zu sein. Wir leben dann nicht entfremdet, sondern sind ganz bei uns.
Aus Karriereratgebern ist das Wort Zeitmanagement bekannt. Mir gefällt ein Wort aus der Soziologie besser, das nicht so schön ist, aber eine wertvolle Kompetenz beschreibt, die »Zeitgestaltungskompetenz«. Die Deutsche Gesellschaft für Zeitpolitik definiert sie so:
Die Kompetenz, die wir meinen, beschränkt sich nicht auf die äußeren Bedingungen des Umgangs mit der Zeit. Sie zielt auf die Befähigung der Menschen zum ›bewussten‹ Gebrauch ihrer Zeit –
Wir sind kompetent darin, unsere Zeit zu managen, zu nutzen und auszuschöpfen. Zeitkompetent sind wir erst, wenn wir Zeit so gestalten, dass sie zu unseren Bedürfnissen, Werten und Sinnkriterien passt. Damit würden wir uns von einem ökonomischen zu einem ökologischen Zeitverständnis bewegen, das unseren persönlichen Eigenzeiten gerecht wird. Wir beuten die Zeiten nicht mehr aus und wir beuten uns nicht mehr aus.
Unverfügbarkeit akzeptieren, Wachstum verweigern, Arbeitszeit reduzieren und so Zeitwohlstand gewinnen und dabei lernen, eine Eigenzeit zu etablieren, die uns das Gefühl gibt, in der Gegenwart sicher verankert zu sein – das könnte der Schlüssel sein zu einem Leben, in dem wir Zeit haben für das, was uns wirklich wichtig ist. Wir wären endlich kompetente Zeitgestaltende.
Beginnen kann es mit einem Umdenken: Wenn wir den Dingen ihren Lauf lassen, wenn wir einmal nicht darüber nachdenken, wie lange etwas dauert, welchen Zweck es hat oder was wir dadurch gewinnen, wenn wir uns also treiben lassen, in etwas aufgehen, für etwas offen sind, dann entstehen Momente der Lebendigkeit. Und dann gewinnen wir wirklich etwas: eine gute Zeit.

Titelbild: Noah Silliman - CC0 1.0

