Nach der Pandemie: Wie unser Gehirn die Coronagewohnheiten loswird
Experimente mit Zebrafischen und Ratten machen Hoffnung, dass uns die Ansteckungsangst und das gezwungene Abstandhalten nicht auf ewig erhalten bleiben.
Vorgestern hatte ich einen Albtraum. »Albtraum« klingt, inhaltlich betrachtet, übertrieben, aber so fühlte es sich an. Es war Sommer, heiß, die Sonne gleißte, wie sie es nur im Süden tut. Ein Ort am Meer, ich hörte die Brandung, es roch nach Salz. Es muss Italien gewesen sein, wo meine Familie lebt. Ich ging mit meiner Mutter aus dem Haus. Da merkte ich, dass ich meine Maske vergessen hatte. Ich suchte verzweifelt in meiner Handtasche. Nichts. Auch die Schlüssel für die Haustür waren weg. Mund und Nase mit etwas anderem zu bedecken, war auch nicht möglich, da ich nur ein trägerloses Sommerkleid trug. Schuldbewusst und ängstlich schlich ich mich an den Häusern entlang, um jede Ecke spähend, ob mir jemand entgegenkam. Ich hielt mir die Hände vors Gesicht und suchte nach einem Geschäft, um eine Maske zu kaufen. Wurde aber nicht fündig. Dann erwachte ich mit einem Gefühl von Angst und Scham, als wäre ich nackt durch die Gegend gelaufen.
Einmal im richtigen Wachzustand angelangt, erschrak ich dann aus einem anderen Grund. Für mich steht fest, dass ich meine Eltern erst dann in Italien besuchen werde, wenn das Risiko, mich im Flieger oder im Zug mit dem Coronavirus anzustecken und es zu ihnen zu bringen, gleich null ist. Das heißt: Mein Traum spielte in einer Zeit, in der das Coronavirus seinen Schrecken bereits verloren haben musste. Doch geht mein Unterbewusstsein davon aus, dass wir auch dann weiterhin Masken tragen werden – tragen müssen!
Aber wie wird es dann wirklich sein? Wie wird es sein, wenn die Pandemie vorbei ist?

Bleibt das Maskentragen Gewohnheit?
Wenn wir mehrmals täglich eine halbe Minute lang Hände waschen, beim Rausgehen zu einer OP- oder FFP2-Maske greifen, sie gleich aufsetzen oder in die Tasche stecken, um sie bei Bedarf herauszuholen – dann sind das inzwischen Gewohnheiten. Wir denken nicht darüber nach, wir tun es genauso automatisch, wie wir Schuhe und Mantel anziehen und morgens ins Bad latschen und die Zahnbürste in den Mund stecken.
Gewohnheiten sind das Ergebnis eines Lernprozesses, in dem unser Hirn Reiz und Reaktion assoziativ zusammen speichert. Erst durch den Lernprozess wird aus einer Handlung, die anfangs bewusst und zu einem bestimmten Zweck durchgeführt wurde, eine automatische Reaktion, sprich: eine Gewohnheit. Der Zweck der Handlung tritt dann in den Hintergrund, er ist uns nicht mehr bewusst. Wer denkt etwa beim Einführen der Zahnbürste in den Mund an die Karies, die durchs Reinigen des Zahnschmelzes verhindert werden soll? Im Erwachsenenalter vermutlich niemand, oder nur im Ausnahmefall.
Aber als wir Kleinkinder waren, mussten uns unsere Eltern die Assoziationskette Zahnbürste–Karies–Zahnarztbesuch-Vermeidung regelrecht einhämmern, damit wir die Zähne artig putzten. Und sie mussten uns mit Bussis, Lob und sonstigen Prämien belohnen, damit wir es wieder taten. So funktioniert Gewohnheitsbildung: Durch Wiederholung in einem bestimmten Kontext wird ein anfangs willentlicher und zielgerichteter Akt zur Reaktion, die keine kognitive Steuerung mehr braucht.
Statt zur Dinnerparty ab ins Bett
Das ist der Grund, weshalb wir uns oft an eine Gewohnheit halten, obwohl sie gerade gar nicht zweckdienlich ist. William James, der Vater der modernen Psychologie, erzählte 1890 eine lustige Geschichte: Es geschah damals anscheinend häufig, dass manche zerstreuten Herrschaften ihr Schlafzimmer betraten, um sich für ein Dinner herauszuputzen, und sich stattdessen entkleideten und in die Federn krochen.
Folgt daraus, dass wir künftig eine Maske aufsetzen, auch wenn sie ihren Zweck eingebüßt haben wird?
Wie haben wir uns an die Maske gewöhnt?
Die Mechanismen der Gewohnheitsbildung haben Psychologinnen und Psychologen zusammen mit Hirnforschenden an Nagetieren studiert.
Ratten in 2 Gruppen wurden darin trainiert, einen Hebel zu betätigen, um an Zuckerkügelchen zu kommen. Die erste Gruppe wurde nur kurz eingelernt. Sie durfte nur 100-mal den Hebel drücken und ihren Lohn erhalten, eine andere Gruppe 500-mal. Nachdem die Tiere das Training absolviert hatten, begann der zweite Teil des Versuchs: Unmittelbar nach dem Verzehr von Zuckerkügelchen wurde der Hälfte der Tiere eine Lithiumchloridlösung gespritzt, die Übelkeit verursachte. Die andere Hälfte diente als Kontrollgruppe.
Im folgenden Test durften alle Ratten wieder Hebel drücken und zur Belohnung Zuckerkügelchen fressen. Dabei zeigten sich erhebliche Abweichungen in den Leistungen der beiden Gruppen. Die weniger trainierten Ratten, deren Zuckerkügelchen durch die Spritze entwertet worden waren, gaben sich nicht mehr so große Mühe für die Zuckerdosis, sie drückten den Hebel nur schwach. Für jene, die länger trainiert und häufiger belohnt worden waren, schien die Entwertung der Prämie durch die Spritze hingegen keine Rolle zu spielen. Sie drückten den Hebel weiterhin mit voller Kraft.
Setzen wir uns Menschen nun an die Stelle der Ratten und die Anti-Corona-Gewohnheiten anstelle des Hebeldrückens. Wir bekommen keinen Zucker dafür, dass wir Masken tragen und emsig Hände waschen, eine Belohnung wird uns trotzdem zuteil: Wir bleiben gesund. Außerdem dürfen wir uns zu jener Bevölkerungsgruppe zählen, die sich achtsam und verantwortungsbewusst verhält. Letztere Gratifikation hängt allerdings von der Anerkennung ab, die wir in unserem Umfeld erfahren.

Sind wir von Menschen umgeben, die ebenfalls Maske tragen, penibel Abstand halten und auf Hygiene achten, werden wir uns in unserem Präventionsverhalten bestätigt fühlen. Dann hat dieses eher eine Chance, zur langanhaltenden Gewohnheit zu werden, zumal wir es noch einige Monate werden einüben dürfen. Wer hingegen von Maskenverweigerern und Coronaleugnern umgeben ist, oder gar von Menschen, die Maskierte wie Außerirdische angucken – das kann in Berlin durchaus passieren –, wird höchstwahrscheinlich am Tag der Coronaentwarnung sämtliche Masken in den Mülleimer werfen und froh sein, die Haut der Hände endlich wieder schonen zu können.
Von Ratten und Menschen
Aber was haben Rattengewohnheiten mit uns zu tun? Wir sind doch keine Nagetiere. Doch, so wenig schmeichelhaft es erscheint, unterscheiden sich Rattenhirne nur unwesentlich von Menschenhirnen. Die neuronalen Prozesse, die der Bildung von Gewohnheiten zugrunde liegen, sind bei Menschen und Ratten ähnlich und spielen sich bei beiden Spezies in analogen Gehirnregionen unterhalb der Großhirnrinde ab.
Wie alle Synapsen im Gehirn können auch die Synapsen des Striatums beim Erlernen einer Aufgabe – also auch einer »Gewohnheit« – sowohl gestärkt als auch geschwächt werden. Ob sie eine Stärkung oder eine Schwächung erfahren, hängt mit der Entladung von Dopaminzellen
Bekamen die Probanden die erwartete Belohnung nicht, fiel die Aktivität der Dopaminzellen unter das normale Niveau. Die Autoren der Studie gehen davon aus, dass im ersten Fall die kortiko-striatalen Synapsen, die beim Erlernen der Aufgabe aktiv waren, gestärkt und im
Andererseits: Alte Gewohnheiten vergisst man nicht, sie können zwar von neuen überschrieben werden, bleiben aber trotzdem immer in einer »Ecke unseres Hirns« abrufbereit. Es ist also durchaus möglich, dass wir nach Ende der Pandemie einfach in alte Gewohnheiten zurückfallen. Doch es gibt noch einen Weg: Wir könnten uns auch bewusst dafür entscheiden, in Bussen und Bahnen weiterhin Masken zu tragen und häufiger Hände zu waschen. Diese Gewohnheiten haben sich nämlich als lohnend gezeigt. Nachweislich sind 2020 viel weniger Menschen an Grippe erkrankt als in den vorigen Jahren.
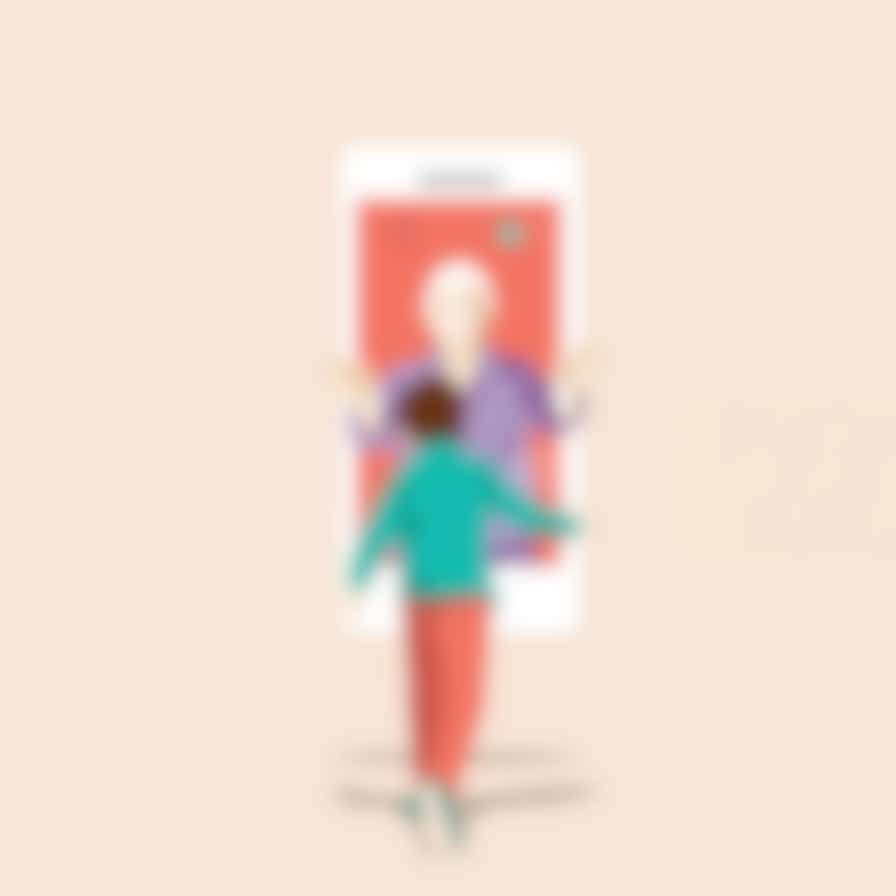
Bleibt die Ansteckungsangst?
Auf einem anderen Blatt steht das reflexartige Ausweichen vor fremden Menschen, weil sie Coronaüberträger sein könnten – eine Angstreaktion, die Psychologen als Resultat einer Angstkonditionierung betrachten. Es ist uns keineswegs angeboren, vor anderen Artgenossen Angst zu haben. Erst durch die Pandemie und dadurch, was wir über die Übertragungswege des Coronavirus erfahren haben, ist die Assoziationskette Mensch–Coronavirus–Covid–Krankheit–Tod entstanden, sodass wir die Nähe eines anderen Menschen sogar mit Todesgefahr in Zusammenhang bringen.
Ein klarer Fall klassischer Angstkonditionierung. Hierbei lernen wir, vor etwas Angst zu haben, was wir normalerweise als »neutral« einordnen. Dieser neutrale Faktor – in diesem Fall unsere Mitmenschen – wird mit etwas assoziiert, vor dem wir uns bereits zu fürchten gelernt haben – in diesem Fall das Erkranken an Covid-19. Die tief verwurzelte Angst, schwer krank zu werden, steht plötzlich mit den Menschen in Zusammenhang, die uns umgeben.
Wie Angstkonditionierung funktioniert und wie sie aufgehoben werden kann, ist hinlänglich an Ratten studiert worden. Eine klassische Versuchsanordnung besteht darin, den Tieren einen milden Elektroschock zu verpassen, wenn ein bestimmter
Die Angst verschwindet
Für uns Menschen heißt das: Anstelle des Warntons treten in unserer pandemischen Gegenwart Menschen auf und anstelle der Elektroschocks Covid-Erkrankungen. Aber solange wir und unsere nächsten Menschen gesund bleiben, fehlt dem Mechanismus der Angstkonditionierung – zum Glück – ein wesentliches Element: das tatsächliche Erlebnis des befürchteten Unheils. Die Assoziation Mensch–Covid bleibt für den Einzelnen abstrakt. Und wenn wir erst mal überall Menschen antreffen, die nicht mehr auf Abstand achten, ohne dass diese Nähe schlimme Folgen hätte, dürfte die Angst schnell verschwinden.
Dafür gibt es aber auch einen schlichteren Grund: Wir Menschen sind soziale Tiere. Wir brauchen soziale Kontakte, Nähe, Interaktion und auch die physische Anwesenheit anderer Menschen. Die medialen Verabredungen, mit denen wir derzeit behelfsmäßig den Mangel an echten Treffen zu kompensieren versuchen, können uns zwar vor dem Gefühl tiefer Einsamkeit bewahren, aber persönliche Begegnungen nicht ersetzen. Die Entbehrung sozialer Kontakte zur Eindämmung der Pandemie hat bereits Folgen:
Ich selbst hatte den Eindruck, bislang halbwegs stabil durch die Pandemie durchgekommen zu sein, obwohl mir das Reisen, die Theaterabende und das soziale Leben sehr fehlen. Aber mein Arzt ist anderer Meinung. Er hat bei mir ein Lockdown-Erschöpfungssyndrom diagnostiziert, das in den Medizinbüchern noch nicht kanonisiert wurde, weshalb er es nicht so nannte. Die Symptome waren für ihn aber klar.
Wochenlang fühlte ich mich so müde und schwach, dass ich mich mehrmals am Tag hinlegen musste, weil ich sonst umgefallen wäre. Plötzlich fühlte ich alle meine Kräfte schwinden, mich übermannte der Schlaf, als hätte ich eine Woche lang alle Nächte durchgemacht. Dabei hatte ich jede Nacht mindestens 8 Stunden geschlafen. Das ging weit über eine mir bekannte Winterdepression hinaus. Es fühlte sich eher wie ein Winterschlaf an. Aber da ich weder ein Igel noch ein Murmeltier bin und mir einen Winterschlaf nicht leisten kann, ging ich zum Arzt. Ich dachte, Grund des Übels wären Vitamin-D- oder Eisenmangel oder beides. Doktor R. machte eine Blutuntersuchung.

Als ich zur Besprechung der Ergebnisse die Praxis aufsuchte, sah er mich bedauernd an. Das Blutbild sei perfekt, sagte er, ich sei kerngesund. Aber es würden inzwischen viele Patienten Symptome wie meine beklagen. Vor allem Menschen, die vor der Pandemie beruflich viel gereist seien und ein vielfältiges soziales Leben gehabt hätten, fühlten sich im Lockdown todmüde und schwach. Wo all das wegfalle, Reisen, Kontakte, Anregungen, erklärte er, könne sich der Körper keineswegs erholen, wie man erwarten würde. Er schreie einfach danach.
Nach und nach kehrte die Energie zumindest teilweise zurück. Aber ich begann, mir andere Sorgen zu machen. Was, wenn wir uns an all die Kontaktbeschränkungen, an die Beinah-Isolation gewöhnen? Wird die Pandemie uns alle in Eigenbrötler und Eremiten verwandeln? Wird unser Hirn überhaupt zur Normalität zurückkehren können, wenn die äußere »Normalität« zurückkehrt?
Hunger und Isolation wirken ähnlich
Doktor R. hat seine Diagnose aufgrund seiner praktischen Erfahrungen gestellt. Doch sie deckt sich mit dem, was Neurowissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology bereits 2019 herausfanden:
An einem Tag blieben die Probanden 10 Stunden lang in Isolation; an einem anderen Tag mussten sie 10 Stunden fasten. Anschließend wurden sie einer funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRI) – einem Bildgebungsverfahren, durch das die graue Masse unter unserem Schädel visualisiert wird – unterzogen, während ihnen Bilder von ihrem Leibgericht, von interagierenden Menschen und von Blumen gezeigt wurden. Außerdem mussten die Probanden während der Isolation bzw. des Fastens und unmittelbar danach einen Fragebogen ausfüllen.
In diesem beklagten die Fastenden erwartungsgemäß Hunger; die Isolierten fühlten sich einsam und sehnten sich nach sozialen Kontakten. Interessanter waren die
Wie Ausgehungerte bei einem Festmahl
Stell dir vor, du müsstest anderthalb Jahre lang fasten und würdest nur durch Infusionen am Leben erhalten. Was würdest du tun, wenn du nach Ende der Fastenzeit vor einer Tafel voller Leckerbissen stündest? Weiter fasten? Eher unwahrscheinlich. Momentan wird in Deutschland mehr gekocht und folglich auch mehr gegessen als sonst – und zugleich ein ausgedehntes Kontakte-Fasten betrieben. Wenn sich das auf unser Gehirn genauso auswirkt wie Nahrungsentzug, warum sollten wir uns nach Aufhebung aller Kontaktbeschränkungen anders verhalten als Ausgehungerte bei einem Festmahl?

Dass wir bis dahin die Kunst des Socializing verlernt haben könnten, darüber brauchen wir uns nicht allzu viele Gedanken zu machen. »Aus unseren Daten können wir ablesen, dass der Organismus zumindest auf einigen Ebenen sehr resilient gegenüber Änderungen in der sozialen Umgebung ist und schnell auf ein soziales Level zurückfindet«, sagt Lukas Anneser, Forscher am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt.
2020 führte Anneser mit Kollegen am Max-Planck-Institut für Hirnforschung eine Studie durch, in der sie das Gehirn von Zebrafischen unter die Lupe nahmen. Sie stellten fest, dass die Reaktion der Fische auf ihre Umgebung mit einem Hormon zusammenhängt. Isolierten sie Tiere, sanken bestimmte Werte des Hormons. Kamen sie wieder mit ihren Artgenossen zusammen,
Aber lässt sich all das auf Menschen übertragen? Werden wir auch, wenn soziales Leben wieder stattfinden darf, uns schnell wieder »selbst regulieren«? Das sei schwierig zu beantworten, sagt der Naturwissenschaftler. Jedenfalls sei das Sozialverhalten evolutionär gesehen relativ alt. »In Wirbeltieren finden sich quasi in allen Teilen des phylogenetischen Stammbaumes mehr oder weniger stark ausgeprägte Sozialformen.« Die Evolution baut auf Bestehendem auf, das immer weiter verändert wird. Sofern Veränderungen keinen Vorteil mit sich bringen, finden sie auch nicht statt.
Einen Vorteil brächte uns ein Verzicht auf den wunderbaren Selbstregulierungsmechanismus der Zebrafische sicher nicht. Menschen sind auch deshalb soziale Tiere, weil sie zum Überleben aufeinander angewiesen sind. Social Distancing ist momentan notwendig; auf Dauer wäre es keine gute Idee.
Redaktion: Juliane Metzker, Han Langeslag
Titelbild: United Nations COVID-19 Response - CC0 1.0

