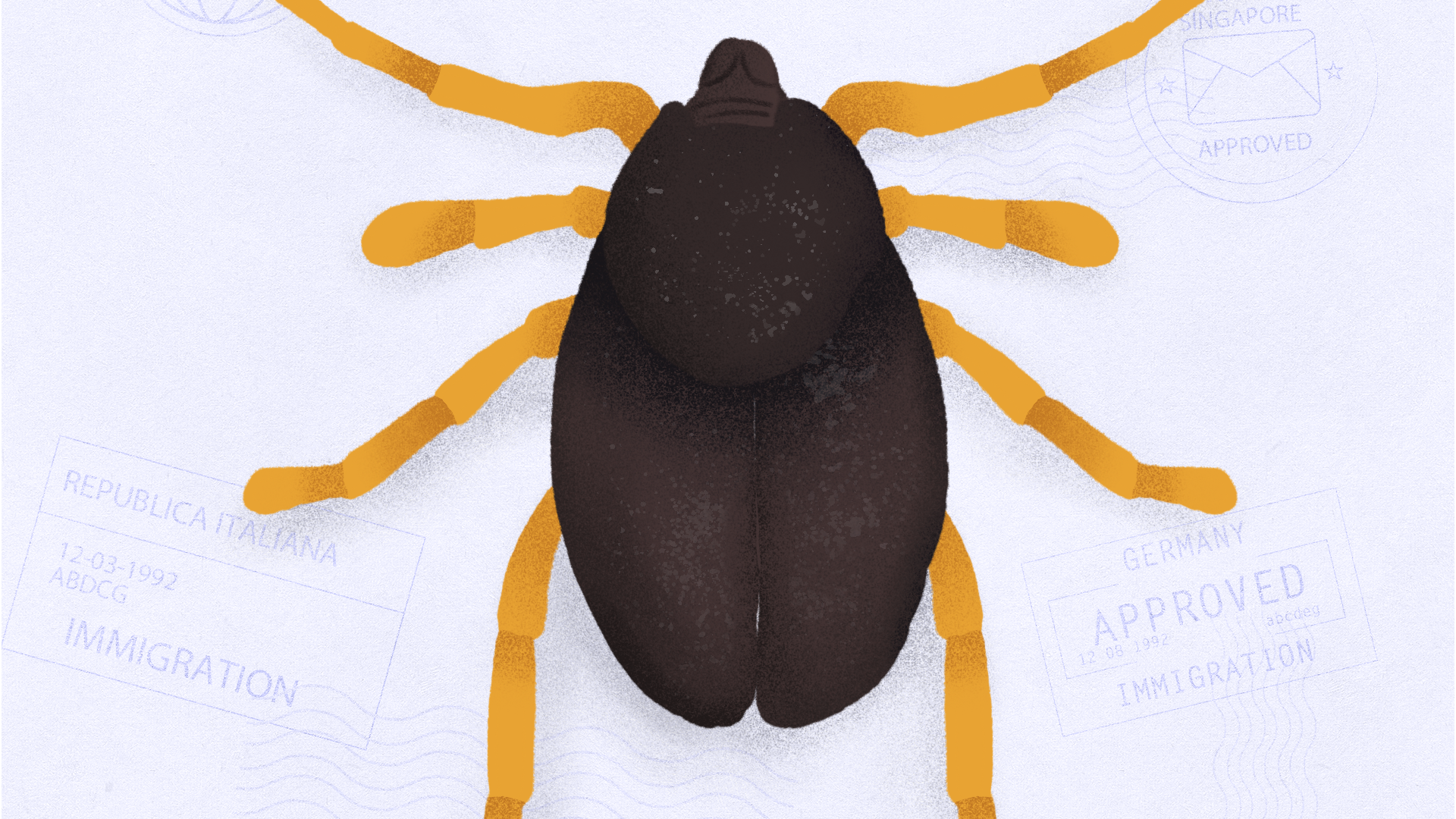Im Sommer 2019 erhielten Tausende Menschen in Frankreich eine ungewöhnliche SMS: Ob sie bereit seien, an einem besonderen Experiment teilzunehmen? Als Teil einer Bürger:innenversammlung im Auftrag von Präsident Emmanuel Macron würden sie Empfehlungen erarbeiten, wie das Land bis 2030 seine Treibhausgasemissionen um 40% reduzieren könne. Und zwar »im Geiste der sozialen Gerechtigkeit«.
Aus dem Pool derer, die sich das vorstellen konnten, wurden schließlich 150 Teilnehmer:innen ausgelost, die Frankreichs Gesamtbevölkerung hinsichtlich des Geschlechts, Alters, Bildungsstands sowie der Herkunftsregion und Berufsgruppe repräsentieren sollten. Die Versammlung tagte an 7 Wochenenden von Oktober 2019 bis Juni 2020, die Teilnehmenden hörten Beiträge von Expert:innen aus Wissenschaft und Wirtschaft, tauschten Meinungen aus.
Schließlich formulierten sie 149 Vorschläge an die Regierung, viele davon überraschend radikal: Ein Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf Autobahnen war darunter, ein Verbot von Inlandsflügen, sofern es eine Bahnverbindung von unter 4 Stunden für dieselbe Strecke gibt, sowie ein Vorschlag für ein Gesetz, das
strafbar macht.
Präsident Macron hatte ursprünglich versprochen, die Empfehlungen der Versammlung nicht zu »filtern«. Dennoch nahm das Parlament im Mai 2021 nur wenige der erarbeiteten Maßnahmen eins zu eins an –
Ist das Experiment gescheitert, Bürger:innen in die Klimapolitik einzubeziehen? Der Politikwissenschaftler Dimitri Courant hat die französische Bürger:innenversammlung
Lenkte das Design der Versammlung die Bürger:innen in eine bestimmte Richtung?
Dimitri Courant:
Die Bürger wurden zu Beginn in 5 Gruppen aufgeteilt: Essen, Wohnen, Arbeiten, Transport und Konsum. Das ermöglichte es ihnen, ihre Erfahrungen als Autofahrer oder Hausbewohner einzubringen. Keine schlechte Idee, aber es produzierte von Anfang an eine sehr individualistische Perspektive auf das Problem. Eine andere Möglichkeit, die Debatte zu beginnen, wäre gewesen, das BIP einzuführen und zu diskutieren,
Der Rahmen dieser Debatte wäre das gesamte Wirtschaftssystem gewesen, das in einer Weise konstruiert ist, die nicht nachhaltig ist.
Wie lenkt man eine Versammlung auf legitime Weise? Es ist einfacher, wenn man ein geschlossenes Problem mit 2 möglichen Ausgängen hat, pro und contra,
Der Klimawandel ist ein offenes Problem mit einer Vielzahl von möglichen Lösungen. Daher ist es sehr schwierig zu erkennen, ob es fair und ausgeglichen präsentiert wird.
Das bedeutet, dass die Organisator:innen viel Macht ausüben, indem sie Expert:innen auswählen?
Dimitri Courant:
Ja. Für die Klimawissenschaft ist es lächerlich, jemanden dafür und jemanden dagegen einzuladen, weil es einen so starken wissenschaftlichen Konsens gibt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es einen starken Konsens
In der Versammlung wurde über die CO2-Steuer geredet, bis die Bürger es satthatten. Ich habe auch schon Debatten mit Experten gesehen, die argumentierten, dass die Besteuerung von Kohlenstoff nicht fair sei, weil reiche Leute weiterhin so viel verschmutzen könnten, wie sie wollen. Deren Vorschlag war, dass jeder ein persönliches Kohlenstoffbudget bekommt – und wenn es aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht.
Warum sollten zufällig ausgewählte Bürger:innen bessere Entscheidungen in der Klimapolitik treffen als gewählte Politiker:innen?
Dimitri Courant:
Wahlsysteme laufen in kurzen Zyklen ab. Das bedeutet, Politiker machen sich vor allem Gedanken darüber, was die Leute, die gerade wählen, auf dem Stimmzettel entscheiden werden. Politiker wollen in der Lage sein zu zeigen: »Das habe ich in den letzten 5 Jahren getan – und ihr könnt den Nutzen davon jetzt spüren.«
Das erschwert radikale Klimapolitik, die kurzfristig zu Einschränkungen führt?
Dimitri Courant:
Wie würde der Wahlslogan dafür lauten? »Das Leben wird in den nächsten 20 Jahren hart, aber in 100 Jahren werden mich die Leute als Helden sehen«? Das ist nicht sehr attraktiv. Die Menschen, die am meisten von der Klimapolitik betroffen sind, sind nicht diejenigen, die jetzt wählen. Junge Menschen neigen dazu, weniger zu wählen als alte, und sehr junge – oder ungeborene – Menschen können nicht wählen. Es ist ihr Leben, das am meisten betroffen sein wird.
Die meisten Bürger haben kein Interesse daran, gewählt zu werden. Und sie sind nicht so sehr in wirtschaftliche Überlegungen verstrickt. Sie müssen nicht darüber nachdenken, ob sie die Automobilindustrie auf ihrer Seite haben. Es gibt auch das Argument, dass Politiker überwiegend aus der sozialen Oberschicht kommen und reiche Leute dazu neigen, mehr zu emittieren – etwa indem sie fliegen oder viel Land besitzen. Leute, die weniger emittieren, sind vielleicht eher bereit, Maßnahmen vorzuschlagen, die den Lebensstil reicher Menschen beeinträchtigen.
Ein Argument für Bürger:innenversammlungen ist also, dass sie immun gegen Lobbyismus seien.
Dimitri Courant:
Lobbyisten waren während der französischen Versammlung nicht sehr präsent, aber sie haben ein kluges Spiel gespielt: Sie wussten, dass die Versammlung vorschlagen konnte, was sie wollte – hinterher konnten sie es doch abwürgen. Nach den Abstimmungen wurden einige Bürger in verschiedene Ministerien in Paris eingeladen, um dort an Gesprächen mit Vertretern der Wirtschaft teilzunehmen. Sie sollten dort ihre Vorschläge verteidigen. Diese Auseinandersetzungen mit den Ministern und Interessenvertretern fanden hinter verschlossenen Türen statt, dabei hätten sie live im Fernsehen übertragen werden müssen.
Ist das Experiment der französischen Bürger:innenversammlung gescheitert?
Dimitri Courant:
Das kommt darauf an, wie man den Erfolg misst. Wenn man fragt, ob die Versammlung gute Vorschläge gemacht hat, dann muss man sich die Vorschläge ansehen und sie objektiv bewerten: Sind sie umsetzbar und ausreichend? Ich bin kein Experte in Sachen Klimapolitik, aber ich denke, sie gehen in die richtige Richtung. Wenn das Bewertungskriterium jedoch lautet: Wurden die Vorschläge umgesetzt? Dann ist es ein Misserfolg. Die meisten Vorschläge wurden verwässert, viele wurden gleich verworfen.
Sollte im Vorfeld einer Bürger:innenversammlung festgelegt werden, was mit den Vorschlägen am Ende passiert?
Dimitri Courant:
In Frankreich existiert keine Bürgerversammlung im Gesetz. Emmanuel Macron hat beschlossen, dass er eine will, und sie dann aus dem Hut gezogen. Es gibt also auch kein Gesetz, das ihn zur Umsetzung gezwungen hätte.
Für mich war das beste Modell
Dort war das Versprechen, dass der Vorschlag der Versammlung als Referendum zur Abstimmung gestellt wird, was ein verfassungsmäßig anerkannter Mechanismus ist. Alle Bedenken, dass die Bürgerversammlung nicht repräsentativ oder nicht legitim sei, wären damit vom Tisch, denn sie selbst entscheidet ja nicht. Das tut die Öffentlichkeit, als der Souverän in einer Demokratie.
Die Öffentlichkeit wird oft als dumm und nicht handlungswillig dargestellt, aber das ist sie nicht. In Frankreich haben Kollegen von mir eine große Stichprobe der Bevölkerung gefragt, was sie von Vorschlägen der Bürgerversammlung halten. Alle Maßnahmen haben mehr als 50% Zuspruch erhalten, bis auf das 100-Stundenkilometer-Limit auf der Autobahn.
In Deutschland gibt es aktuell einen Bürger:innenrat zum Klima,
Die Regierung hat keinerlei Konsequenzen versprochen. Kann das wertvoll sein?
Dimitri Courant:
Bürgerversammlungen sind ein Werkzeug für die Öffentlichkeit und Politiker, um bessere Entscheidungen zu treffen. Aber das Problem ist nicht, dass Politiker nicht genug Informationen hätten, sondern dass sie andere Anreize haben, die in das System eingebaut sind. Vielleicht werden die deutschen Abgeordneten der Bürgerversammlung mehr Respekt entgegenbringen als die französischen Politiker. Ich hoffe es.
Ich hätte erwartet, dass Sie, als Forscher, der sich mit deliberativer Demokratie beschäftigt, Bürger:innenversammlungen positiver betrachten.
Dimitri Courant:
Es gibt einen Namen für Leute wie mich: kritischer Freund. Wir kritisieren Dinge, weil wir wollen, dass sie besser werden. Was ist die Alternative? Die Bürger nicht in die Politik einzubeziehen, weiterzumachen wie bisher? Bürgerversammlungen sind Verbesserungen, so viel steht fest. Sind sie perfekt? Nein, das werden sie vielleicht nie sein und es wird Zeit brauchen. Es hat ein ganzes Jahrhundert gedauert, um die Art von Wahlen zu entwickeln, die wir heute haben – mit Briefumschlag, Urne und Wahlkabine.