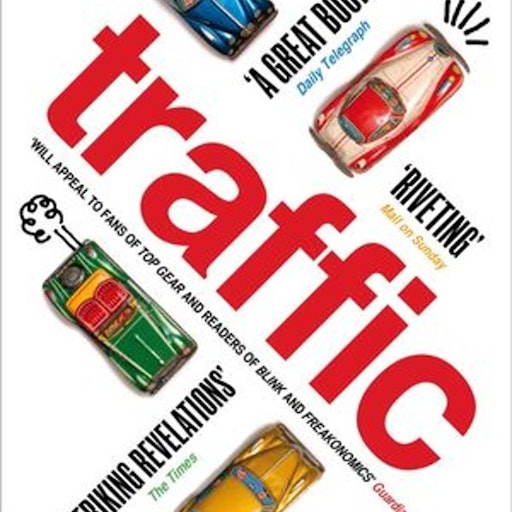Jetzt fahr doch endlich, du §$%&#! Warum wir beim Autofahren so schnell in Rage geraten
Hohe Geschwindigkeiten, eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten und kaum Blickkontakt: Das Autofahren ist eine besondere Situation, in der wir anders reagieren als sonst. So gelingt es dir trotzdem, entspannt zu bleiben.
»Ich bin einfach nicht fürs Autofahren gemacht!«, fluche ich und lasse langsam das Lenkrad los. Erst dabei merke ich, wie fest ich es umklammert hatte. Obwohl das Auto schon steht, rast mein Puls. Ich bin immer noch auf das Motorrad wütend, das mich auf der Landstraße geschnitten hat. Die Fahrt durch die sonnigen Felder war so schön entspannt, bis es von hinten angerauscht kam und mich fast von der Fahrbahn gedrängt hätte.
Auch wenn meine Aussage etwas dramatisch ist, ist sie richtiger, als mir in diesem Moment bewusst ist: Wir Menschen sind wirklich nicht zum Autofahren gemacht. Unser Gehirn entwickelte sich in einer Welt, in der wir zu Fuß durch Wälder streiften und uns dabei mit Lauten oder Blicken verständigten. Dass wir in Blechkisten über Asphaltdecken flitzen, während wir uns mit anderen Blechkisten koordinieren müssen, ist hingegen relativ neu. Zwar gelingt es uns ganz gut, ein so schnelles Fahrzeug durch die Straßen zu steuern, aber das Autofahren bleibt trotzdem eine besondere Situation, in der wir anders reagieren als sonst. Und das führt tatsächlich dazu, dass wir hinter dem Steuer jemand anderes sind.
Falls du dich schon gefragt hast, warum du plötzlich mehr fluchst und öfter Leute beschimpfst, dann weißt du, was ich meine. Auch wenn du dich als Beifahrer:in schon gewundert hast, dass die Person im Fahrersitz ohne Vorwarnung von gelöster Plauderlaune zu ungeduldiger Motzerei umschaltet, kennst du das Problem.
Doch das ist mehr als nur eine Frage der Nerven – es geht hier auch um Sicherheit. Denn Gefühlsausbrüche beim Fahren, Wut und Ärger lenken ab und verführen zu riskanten Manövern. In einer repräsentativen
Warum fährst du nicht ein Stück mit mir und ich erkläre es dir unterwegs?
Wenn wir einander hören könnten, wäre alles viel einfacher
Das Auto rollt an und ich fädele mich in den Stadtverkehr ein. Häuserfronten ziehen vorbei und werden ab und zu von Schaufenstern und bunten Leuchtreklamen unterbrochen. An einer Kreuzung stoppt mich eine rote Ampel. Ich bremse und komme hinter einem weinroten Nissan Micra zum Stehen. Glücklicherweise schaltet die Ampel gleich auf Grün. Ich bin startbereit, aber der kleine rote Wagen bewegt sich nicht.
»Hallo da vorne, siehst du nicht, dass es grün ist?«
Natürlich bekomme ich keine Antwort. Trotzdem probiere ich es noch mal etwas lauter und gestikuliere dabei:
»Hallooo, warum fährst du denn nicht?!«
So wie mir geht es vielen Autofahrer:innen: Obwohl wir wissen, dass sie uns nicht hört, sprechen wir mit der Person im anderen Fahrzeug. Wir wollen verstehen, was sie tut oder denkt. Und das ist völlig normal, weiß die Wissenschaft.
Unter dem Vorwand, dass sie die Wahrnehmung von Geschwindigkeiten und Entfernungen untersuchen wollen, luden der Psychologe Andrew McGarva und seine Kollegin Michelle Steiner
Alle Fragen, Aufforderungen und Beschimpfungen bringen hier nichts. Wir sind auf stumm geschaltet und das ist sehr frustrierend. Könnten wir einander verstehen oder ins Gesicht sehen, wäre die Situation mit einem entschuldigenden Lächeln oder einem »Sorry« schnell entschärft und der Ärger verpufft. Stattdessen regen wir uns weiter auf und unterstellen der anderen Person vielleicht, dass sie uns absichtlich behindert oder gefährdet. In unserem Kopf wird aus der Kleinigkeit ein ganzes Drama, in dem wir das unschuldige Opfer sind, das sich wehren muss. Da uns nur grobe, unspezifische Mittel wie Hupen, beleidigende Gesten oder dichtes Auffahren bleiben, um uns überhaupt bemerkbar zu machen und unseren Ärger mitzuteilen, kann die Situation schnell eskalieren.

Kein Blickkontakt, keine Kooperation
Meine Hand schwebt schon über der Hupe, als sich der weinrote Nissan endlich in Bewegung setzt. Kaum sind wir ins Rollen gekommen, bahnt sich schon das nächste Hindernis an: Ein paar Meter weiter ist ein Zebrastreifen, auf den gerade ein Fußgänger zugeht. Wahrscheinlich möchte er gleich die Straße überqueren.
Ich sollte anhalten.
Ein paar Schritte muss der Mann aber noch laufen, bis er den Straßenrand erreicht. Wenn er allerdings nicht weiß, dass ich ihn gesehen habe, kann er nichts von mir erwarten. Ganz wohl fühle ich mich nicht dabei. Doch ich schaue stur geradeaus und trete aufs Gaspedal.
Und genau das ist der Knackpunkt: Blickkontakt oder der Mangel davon auf den Straßen. Wissenschaftler:innen wie der Psychologe Michael Tomasello gehen davon aus, dass unsere Augen mit dafür verantwortlich sind, dass wir Menschen wesentlich kooperativer sind
Eine
Na, überlegst du jetzt, wie du am besten Augen über der Kaffeemaschine im Büro anbringst?
Dummerweise nimmt die Fähigkeit, Blickkontakt zu halten,
Aber selbst, wenn wir langsamer unterwegs sind, können wir den anderen Verkehrsteilnehmer:innen nur selten ins Gesicht sehen. Meistens fahren wir hintereinander her und sehen dabei nur die Rückseite der anderen Fahrzeuge. Außerdem versperren uns die spiegelnden Glasscheiben, die uns umgeben, die Sicht.
Warum Cabriofahrer seltener hupen
Nächster Abschnitt:
Durch den Kokon aus Blech und Glas, mit dem uns das Auto umgibt, schirmt es mich von der Außenwelt ab. Auch wenn wir im Auto nicht ganz unsichtbar sind, fühlen wir uns doch freier und tun Dinge, die wir sonst in der Öffentlichkeit nicht machen würden: Wir drehen die Musik auf, bewegen uns dazu, singen laut bei unseren Lieblingssongs mit oder bohren ungeniert in der Nase. Das Gefühl der Freiheit und Anonymität kann uns allerdings auch
Niemand weiß, wer wir sind, und die Menschen, denen wir begegnen, sind nur flüchtige Silhouetten für uns. So besteht wenig Anreiz für Höflichkeit und Rücksichtnahme und wir geben eher mal aggressiveren Impulsen nach – etwa dicht aufzufahren oder zu hupen, wenn uns jemand im Weg ist.
Die amerikanische Psychologin Patricia Ellison-Potter und ihre Kollegen
Plötzlich bist du dein Auto
Jetzt drehe ich doch die Musik leiser. Ich muss mich konzentrieren, denn es ist ziemlich voll geworden auf der Autobahn. Ständig muss ich den Lkw ausweichen und jetzt habe ich auch noch diesen dunkelblauen Porsche hinter mir, der so dicht auffährt, dass es mich schon im Nacken kitzelt. Ich würde ja gerne die Spur wechseln und ihm Platz machen, aber der Franzose neben mir gibt mir keine Chance dazu. Merkt der nicht, dass ich rüber will? Französ:innen können wirklich nicht Auto fahren, und der Drängel-Porsche hinter mir könnte sich mal etwas locker machen! Der sieht doch, dass ich nicht auf die andere Spur kann! Dieser $%&§# …
* Jetzt ist es doch passiert und ich habe mich ganz vergessen. Den Rest meiner Schimpftirade gebe ich an dieser Stelle lieber nicht wieder. *
Franzose, Porschefahrer … hast du denn die Schubladen erkannt, worin ich gedacht habe? Wenn wir hinter dem Lenkrad Platz nehmen, geben wir unsere menschliche Identität an das Auto ab. Wer wir sind, wird plötzlich darauf reduziert, was von außen erkennbar ist: unser Fahrzeug, dessen Marke und das Kennzeichen. Gleichzeitig haben wir selbst auch nicht mehr Informationen über die Menschen in den anderen Fahrzeugen. Wir sehen den Porsche, den Holländer, den Berliner – selbst das Geschlecht der Person hinter dem Steuer können wir oft nicht erkennen. Wenn uns nicht gefällt, wie das Auto fährt, finden wir schnell eine Erklärung in den Vorurteilen und Stereotypen, die uns zu Marke, Kennzeichen oder Länderkennzeichen einfallen: Porschefahrer:innen sind rücksichtslos, Französ:innen können nicht fahren und die Einwohner:innen der nahe gelegenen Großstadt sowieso nicht.
Dabei kommen wir gar nicht auf die Idee, nach weiteren Gründen zu suchen, die etwas Empathie und Einfühlungsvermögen fordern würden, etwa dass der Wagen neben uns selbst keinen Platz hat auszuweichen. Wir unterstellen der Person im anderen Pkw lieber, dass sie uns absichtlich provoziert oder unfähig ist. So können wir uns schön weiter aufregen und es ist klar, wer schuld daran ist,
Schnellschlüsse lassen sich nicht vermeiden – doch so fährst du entspannter
Mein kleiner Ausbruch ist mir jetzt ziemlich peinlich. Wenn ich fahre, fällt es mir wirklich schwer, ruhig zu bleiben und das Gute im Menschen zu sehen. Doch meine Schnellschlüsse seien eher normal, sagt Tom Vanderbilt und gibt eine neue Perspektive.
Autofahren ist für viele von uns das Anspruchsvollste, was wir an einem Tag machen.
Die Straße ist eine komplexe und unübersichtliche Umgebung. Wir müssen die anderen Fahrzeuge, Fahrräder und Fußgänger:innen im Blick behalten, voraussehen, wohin sie sich bewegen, und in Sekundenschnelle Entscheidungen treffen. Meist bleibt uns nichts anderes übrig, als Schnellschlüsse zu ziehen. Wir haben weder die Zeit noch die Kapazität, unsere Emotionen zu hinterfragen oder eingehende Analysen anzustellen.
Wie sehr uns das Steuern eines Fahrzeugs beansprucht, können wir selbst testen, indem wir währenddessen ein paar Kopfrechenaufgaben lösen. Auf geraden Straßen geht das noch gut, aber wenn es kurvig wird oder wir uns durch den Stadtverkehr fädeln, finden wir die Lösung nicht mehr so leicht und machen mehr Fehler. Wir merken es auch daran, dass wir bei einem Gespräch beim Fahren wesentlich schneller den Faden verlieren, als wenn wir uns zu Hause bei einer Tasse Kaffee unterhalten.
Doch das muss nicht heißen, dass es nicht auch entspannter zugehen könnte. Wenn du nun verstehst, warum Autofahren so eine spezielle Situation ist, die andere Seiten einer Person hervorbringen kann, hast du die besten Grundlagen dafür. Ertappst du dich beim nächsten Mal dabei, wie hinter dem Steuer deine Emotionen hochkochen, kannst du besser einordnen, woher es kommt. Wie das gelingen kann? Hier eine kleine Hilfestellung:
War die Fahrsituation sehr fordernd? Hast du dich erschrocken? Projizierst du nur Vorurteile und Schubladen auf die anderen Verkehrsteilnehmer:innen? Erwartest du das Schlimmste von ihnen und unterstellst ihnen Absicht?
Du kannst auch ein Spiel daraus machen und deine Gedanken ablenken, indem du überlegst, wer in dem Wagen sitzt, der sich eben noch schnell vor dich geschoben hat. Vielleicht ist es ein Geschäftsmann, der es nicht erwarten kann, seine kleine Tochter aus der Kita abzuholen, oder eine Richterin, die versucht, es noch rechtzeitig zur Besuchszeit ins Seniorenheim zu schaffen. Mit solchen kleinen Geschichten im Kopf wird es dir leichter fallen, geduldig mit den Menschen zu sein, die dir auf der Straße begegnen.
Doch der beste Tipp gegen Gefühlsausbrüche am Steuer ist wohl: von Anfang an dem Stress entgegenwirken. Und das ist wirklich einfach.
Fahre früher los.
Denn wenn du nicht unter Zeitdruck stehst, hast du mehr Raum, rücksichtsvoll zu sein, und siehst die anderen Verkehrsteilnehmer:innen nicht mehr als Hindernisse, sondern als Menschen, die genauso unterwegs sind wie du selbst.
Titelbild: Joshua Wordel - copyright