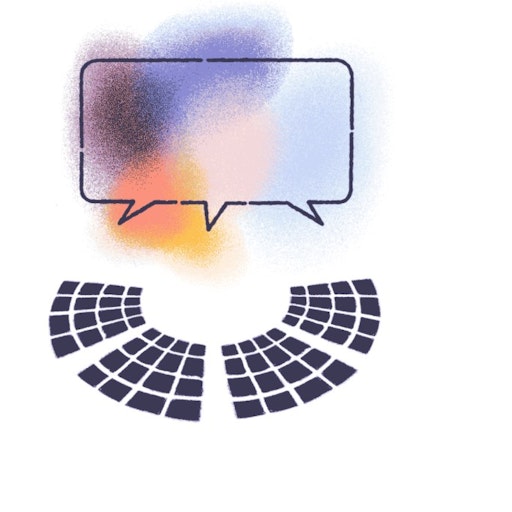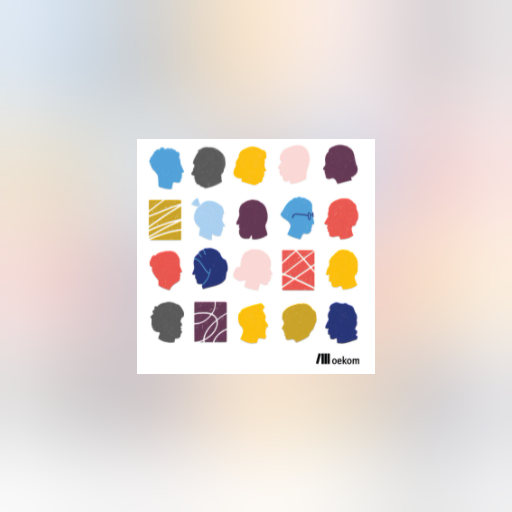Wie wir echte Vielfalt in die Demokratie bringen
Wie können wir konstruktiver diskutieren und bessere Entscheidungen treffen? Katharina Liesenberg und Linus Strothmann bedienen sich einer jahrtausendealten, urdemokratischen Methode.
Im Jahr 1989 lebten in Falkensee ca. 22.000 Menschen. 2020 sind es fast genau doppelt so viele. Falkensee liegt direkt vor den Toren Berlins, grenzt an Spandau und war zu DDR-Zeiten doch so weit entfernt von der Hauptstadt wie Schwerin oder Leipzig. Denn um in den Ostteil Berlins zu kommen, musste man einmal um den Westteil herumfahren. Gut zwei Stunden brauchten die Pendler*innen bis Berlin-Mitte.
Nach dem Mauerfall ändert sich alles. Plötzlich ist Falkensee wieder ein direkter Vorort von Berlin. Heute fährt alle 20 Minuten ein Regionalexpress am Bahnhof ab und ist in einer Viertelstunde am Bahnhof Zoo. Ca. 10.000 Menschen pendeln regelmäßig nach Berlin. Die Bevölkerungsexplosion hinterlässt Spuren. Neben einer rasanten Stadtentwicklung hat sich auch die Zusammensetzung der Bevölkerung verändert. Es sind vor allem Menschen aus der gehobenen Mittelschicht, die nach Falkensee ziehen. Akademiker*innen mit guten Jobs in der Hauptstadt. Der Anteil an Eigenheimen ist groß. Und für viele, die schon vor der Wende da waren, spielt auch die Herkunft der Zugezogenen eine Rolle. Es sind eben viele Wessis.
Als ich, Linus, meine Stelle beginne, kommt all dieses gleich bei einem der ersten Treffen zum Ausdruck. Der Bürgermeister macht sehr klar deutlich, dass er und die Verwaltung eben die Interessen aller Einwohner*innen zu berücksichtigen haben und nicht nur derer, die typischerweise zu
Das Buch: »Wir holen euch ab!«

Dieser Text ist ein Auszug aus dem Buch »Wir holen euch ab! Wie wir durch Bürgerräte und Zufallsauswahl echte Vielfalt in die Demokratie bringen«. Es erscheint am 13. Januar im oekom Verlag.
Bildquelle: oekom VerlagOhne eigene Erfahrung, aber mit dem Wissen um Planungszellen und die
Die erste Beteiligungsphase
Der erste Schritt zur Erstellung des sogenannten INSEK ist eine ausführliche Bestandsaufnahme in Form einer klassischen
Ich beginne mich vorzubereiten, lese mich ein in die verschiedenen Methoden des Auslosens und entscheide mehr oder weniger spontan, dass, wenn sich Leute nicht zurückmelden, ich dann versuche, sie noch mal persönlich zu überzeugen. Das ist für mich zu diesem Zeitpunkt keine besonders bahnbrechende Idee, ich gehe mehr oder weniger davon aus, dass es wohl alle so machen würden. Ich entscheide mich dafür, nach Alterskohorten zu losen und nach Geschlecht. Dann fällt mir auf, dass im INSEK die verschiedenen Stadtteile differenziert behandelt werden sollen, und finde heraus, dass ein Stadtteil so klein ist, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass hier jemand ausgelost wird. Also lose ich noch mal aus jedem Stadtteil eine Frau und einen Mann dazu. Ich spreche das Verfahren kurz mit dem Datenschutzbeauftragten ab, dann bekomme ich anhand meiner Kriterien eine Tabelle mit 40 Personen, die ich im Namen des Bürgermeisters anschreibe.
Es meldeten sich vier zurück. Ich suche mir von denen, die sich nicht zurückgemeldet haben, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen im Internet raus und kontaktiere sie entsprechend. Nachdem ich so nicht alle erreicht habe, beschließe ich, diejenigen, zu denen ich keinen Kontakt herstellen konnte, noch zu Hause zu besuchen. Also mache ich mich das erste Mal auf den Weg. Ich erstelle eine Karte mit allen Adressen und mache mir eine Route. Ich habe absolut keine Ahnung, wie lange es dauern wird, die ca. 30 Adressen abzufahren, aber am Ende schaffe ich es an zwei Nachmittagen. Es zeigt sich, dass Freitagnachmittag die meisten Menschen zu Hause sind. Insbesondere zwei Geschichten sind mir in Erinnerung geblieben.
Wenn die Arbeit keine Zeit für Demokratie lässt
Die erste Person, an die ich mich gut erinnere, war eine Frau, die in der einzigen größeren Plattenbausiedlung lebte. Ich kannte Falkensee bis dahin kaum und mir war nicht mal klar, dass es diese Wohnsiedlung gab.
Sie könne nicht, arbeite im Schichtbetrieb. Sie war ungefähr so beteiligungsfern, wie die Forschung es nahelegen würde. Frau mit Kindern, berufstätig, niedriger Bildungsabschluss. Der Grund, dass sie nicht kam, war aber nicht, dass sie nicht wollte, sondern schlicht, dass sie nicht konnte.
Ich habe das in den folgenden vier Jahren immer wieder erlebt: Es gibt viele Menschen, die Interesse haben, sich zu beteiligen, sich über die Einladung freuen, aber einfach nicht kommen können, weil ihr Alltag selbst einen halben Tag Auszeit nicht zulässt.
Das klingt absurd. Menschen gehen ins Kino, gehen ins Fitnessstudio, treffen sich mit Freund*innen. Aber was diese Frau und andere nach ihr gehindert hat, ist, dass sie ihre Arbeitszeit eben nicht selbstbestimmt festlegt, sondern die Schichten so nehmen muss, wie sie ihr gegeben werden. Einen Samstag freizuhalten, würde bedeuten, einen Urlaubstag zu nehmen. Daran ist auch nicht einfach etwas zu ändern gewesen. Dass im Jahr 2016 Menschen von politischer Teilhabe ausgeschlossen werden, weil sie in Schichten arbeiten, die ihnen zum Beispiel ein regelmäßiges bürgerschaftliches Engagement schon von vornherein unmöglich machen, hat mich damals schockiert. Ich habe zweimal mit ihr gesprochen. Zwei kurze Gespräche und am Ende ist sie nicht gekommen. Trotzdem hat sie mir in gewisser Weise die Augen geöffnet.
Erst Jahre später komme ich auf die Idee, dass, wenn die Menschen nicht in mein Format kommen können, ich vielleicht weitere Formate anbieten muss. Das Format muss zu ihnen! So nehmen wir heute, wenn wir aufsuchen, einen Fragebogen mit oder bieten die Teilnahme über ein Onlinetool an, damit auch die, die aus Zeitgründen nicht kommen können, ihr Feedback geben können.
Wenn das Leben einen gelehrt hat, dass die Meinung nicht gefragt ist
Die zweite Person, an die ich mich aus dieser ersten Zufallsauswahl besonders erinnere, ist gekommen. Herr Schmidt hat mich angerufen. Er war damals 86 Jahre alt. Das heißt, er war 1930 geboren. War 15, als der Zweite Weltkrieg endete, war 31, als die Mauer Falkensee von Berlin trennte, und schon fast 60, als sie niedergerissen wurde. Er war bis zur 8. Klasse in die Schule gegangen und hatte dann eine Bäckerlehre gemacht und sein Leben lang als Bäcker gearbeitet. Er fühlte sich offensichtlich sehr geehrt durch die Einladung des Bürgermeisters. So etwas hatte er noch nie bekommen.
Er war jemand, der die Ereignisse des Geschichtsunterrichts, die für mich sämtlich genau das waren, Ereignisse in Büchern, alle erlebt hatte! Und dabei hatte er vor allem erlebt, dass sie ohne sein Zutun geschehen waren. Ohne seinen Einfluss.
Es erfüllte mich mit einer gewissen Ehrfurcht, dass er diese Stadt doch so viel besser kannte als ich. Das Lustige war, dass er genau diese Ehrfurcht vor mir als Teil eines Staatsapparates empfand. Er sagte, dass er doch zum Thema sicher nichts beitragen könnte (»Falkensee 2035« war der Untertitel des INSEK).
Es ginge doch hier um die Zukunft der Stadt, das würde er doch alles nicht mehr erleben. Ich versuchte, ihn zu überzeugen, dass so ein Wissen, wie er es hatte, uns mit Sicherheit helfen würde. Er wollte sich das überlegen. Könne er vielleicht mal im Rathaus vorbeikommen? Ja, selbstverständlich, sagte ich. Allein das schien ihn schon zu überraschen.
Und er kam tatsächlich. Wir unterhielten uns eine Weile und er sagte, wenn es ihm an dem Tag gut gehen würde, dann würde er versuchen zu kommen.
Etwa eine Woche vor der Veranstaltung kam er dann erneut. Dieses Mal hatte er einfach spontan entschieden vorbeizukommen. Aber er hatte auch ein Anliegen. Ob er den Raum sehen könnte, in dem das Treffen stattfinden würde. Ich zeigte ihm den kleinen Sitzungssaal. Nichts Besonderes. Aber allein das Laufen durch das Rathaus war für diesen Menschen offensichtlich eben doch etwas Besonderes. Von den 86 Jahren, in denen er gelebt hatte, lebte er einen Großteil in Systemen, in denen das, was wir hier taten, völlig undenkbar war. Mich beschleicht beim Erinnern das Gefühl, dass er vielleicht in diesem Moment das erste Mal eine Art Zugehörigkeit zu dem Staat, in dem er lebte, gespürt haben könnte. Natürlich ist das höchst spekulativ.
Was nicht spekulativ ist: Dass ihm zugehört wurde und er den Workshop genoss. Seine Perspektive war eine gänzlich andere auf viele Fragen der Entwicklung. Wesentlich weniger fordernd, was Maßnahmen anging, stattdessen betrachtete er vielmehr das große Thema, wie die Stadt als Stadtgesellschaft wieder mehr zusammenwachsen könnte. Die anderen Teilnehmenden hörten ihm gerne zu.
Es war vielleicht, und auch das ist spekulativ, ein Erleben von Demokratie, das er in 86 Jahren zuvor nicht erleben konnte.
Was mich Herr Schmidt gelehrt hat, ist, dass Demokratie alles andere als selbstverständlich ist und noch viel weniger die Formen der Demokratie, die über eine Wahl hinausgehen. Ich habe aber auch gemerkt, dass es eine Distanz zwischen Mensch und Staat gibt, die Teilhabe verhindern oder zumindest behindern kann. Und mir wurde durch ihn bewusst, dass es doch einen großen Unterschied gibt in der Wahrnehmung und Einordnung von Beteiligung zwischen Ost und West.
Die Ergebnisse des ersten INSEK-Verfahrens
Nun stellt sich die Frage, ob die unterschiedliche Zusammensetzung der Teilnehmenden in einem offenen und einem geschlossenen Format einen Unterschied in den Ergebnissen bedeutet hat?
Ja, das hat sie. Wenn auch weniger, als ich damals erwartet hatte. Dazu aber zunächst ein paar Sätze zur Zusammensetzung der Teilnehmenden. Im offenen Format waren ca. 70 Personen anwesend, wovon sich 50 Personen an der Evaluation per anonymen Fragebogen beteiligten. Das Verhältnis der Geschlechter war ausgeglichen und auch die Altersverteilung war okay. Es gab zwar wenige Menschen im Alter unter 45, jedoch hatte ein Lehrer seine Schulklasse geschickt und einige waren auch gekommen. Frappierend war aber der Bildungsstand. Die Schüler*innen ausgenommen, hatten alle anderen Teilnehmenden mindestens Abitur, die meisten einen Hochschulabschluss. Hingegen war die Verteilung in Bezug auf den Bildungsstand und das Alter bei der relativ kleinen Gruppe von 16 Teilnehmenden im gelosten Format wesentlich heterogener. Das Ziel, hier eine Vielfalt an Perspektiven zu bekommen, wurde also erreicht. Aber hat das die Ergebnisse verändert?
Es ging in den Workshops darum, Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken der Stadtentwicklung zu ergänzen. Das heißt, dass schon die Art der Vorgaben durch die Planer*innen sehr unterschiedliche Interpretationen der Stadtentwicklung beinhaltet hat. Es gab, wenn man so will, wenig Polarisierendes. Dennoch gab es einen maßgeblichen Unterschied in den beiden Gruppen. Während in der offenen Veranstaltung die Grünflächen zwar benannt wurden und auch teilweise diskutiert wurde, wie diese sich verändern sollten, spielten sie in der gelosten Gruppe eine zentrale Rolle. Die Belebung öffentlicher Grünanlagen beziehungsweise öffentlicher Anlagen überhaupt war ein viel wichtigeres Anliegen. Eine sehr einfache Erklärung: Im offenen Format waren überwiegend (evtl. sogar ausschließlich) Menschen, die eigene Gärten besaßen, während dies in der gelosten Gruppe nicht der Fall war. Hier waren diese Menschen in der Minderheit und so hatten die öffentlichen Grünflächen eine gänzlich andere Bedeutung, weil sie viel mehr Funktionen übernehmen. Sei es als Spielfläche für die Kinder, zum Ausruhen oder zum Grillen.
Was bedeutet eigentlich Teilhabe?
Etwa ein Jahr später hatte sich das INSEK als Arbeitspapier weiterentwickelt. Anhand der Analyse wurden Handlungsschwerpunkte identifiziert und diese dann mit Maßnahmen unterlegt. Da eine Kommune aber selbst dann, wenn sich alle einig sind, was alles gemacht werden muss, nicht alles auf einmal machen kann, galt es nun, diese Maßnahmen zu priorisieren. Hierzu fand eine zweite Beteiligungsphase statt (dazwischen hatte es auch noch Fachworkshops gegeben). Die Aufgabe war konkreter und die Auswirkungen realer. Es ging nun darum, dass die Einwohner*innen Stadtentwicklungsmaßnahmen priorisierten!
In diesem Verfahren wurde mir erstmals deutlich vor Augen geführt, was es bedeutet, Teilhabe zu ermöglichen. Wie beim ersten Mal schrieb ich Menschen an und fuhr dann herum. Wie beim ersten Mal hinterließ ich auch dieses Mal einen Brief bei allen, die nicht zu Hause waren. In diesem stand, dass ich da war, aber leider niemanden angetroffen habe und mich über eine Rückmeldung freuen würde. Und dann meldete sich eine Mutter telefonisch bei mir, um abzusagen. Ich fragte sie, warum. Sie erklärte mir,
Es brauchte einiges an Zeit, der Tochter den Sinn des INSEKs zu erklären – insbesondere weil wir über gänzlich andere Dinge wie meine eigenen Kinder, die Büroausstattung oder eine lustige Formulierung sprachen. Nichtsdestotrotz konnte sie gut verstehen, dass Maßnahmen nicht alle gleich wichtig waren. Auch sie hatte eine Meinung dazu, was in der Stadt wichtig war. Womit sie wenig anfangen konnte, war der Leitbildslogan, ein zweiter kleiner Block auf dem Workshop. Wozu brauchte es ein Leitbild, und wozu einen Slogan für die Stadt? Weil sie dazu eh nichts sagen wollte und weil sie sich auch nicht vorstellen konnte, mehrere Stunden am Workshop teilzunehmen, lud ich sie ein, nur zur Priorisierung zu kommen. Da es aber um über 40 Maßnahmen ging, bat sie darum, sich diese mit nach Hause zu nehmen, um sie sich in Ruhe durchzulesen. So druckte ich ihr schließlich die Plakate aus, die wir auch im Workshop nutzten, um die Maßnahmen thematisch geordnet darzustellen, und sie nahm sie mit nach Hause. Und am Workshoptag kam sie dann tatsächlich etwa eine Stunde vor Ende wie angekündigt, um ihre eigenen Punkte auf die großen Plakate zu kleben.
Mich hat diese Erfahrung sehr viel gelehrt. Erstens hat diese Teilnehmerin sehr schnell erkannt, wo ein tatsächlicher Nutzen für sie lag und wo ein Einfluss wirklich gegeben war. Das Priorisieren hat sie nicht der Diskussion über einen Slogan vorgezogen, weil sie keine Lust hatte, über einen Slogan zu diskutieren, sondern weil ihr klar war, dass das eigentlich ohne große Konsequenz bleiben würde. Zweitens habe ich gelernt, dass es letztlich sehr leicht ist zu sagen: »Hier ist Teilhabe nicht möglich« und erheblich schwieriger zu sagen: »Was braucht es, um Teilhabe zu ermöglichen?«. Insbesondere habe ich aber gelernt, dass sich der Aufwand lohnt.
An dieser Stelle kann man einwenden, dass es Zufall war, dass genau dieses Mädchen ausgewählt wurde und doch stattdessen auch jemand anderes hätte kommen können. Aber genau hier liegt der größte Wert eines aufsuchenden Verfahrens. Denn nur wenn ich in jedem Verfahren auch die miteinbeziehe, die eben aufgrund unterschiedlichster Hürden nicht teilnehmen würden, wenn ich sie nicht überrede oder unterstütze, ist die Zufallsauswahl tatsächlich repräsentativ für die Vielfalt der Gesellschaft.
Mit Illustrationen von Aelfleda Clackson für Perspective Daily