Oder-Katastrophe: Wie Europas Flüsse wieder gesund werden können
Viele natürliche Flüsse in Europa mussten breiten Wasserstraßen für Containerschiffe oder Abwasserkanälen weichen. Die Beispiele der Emscher und der Oder zeigen, welche Schäden das verursachen kann – und welche Lösungen es gibt.
Ein Teppich aus toten Fischen, so weit das Auge reicht. Eine halbe Tonne pro Stunde treibt durch den Fluss. Erstickende Fische direkt an der Oberfläche, die Qualen zu erleiden scheinen. Der Gestank muss unerträglich gewesen sein.
Was sich wie der Anfang einer dystopischen Geschichte anhört, geschah erst vor ein paar Monaten
Zwischen Juli und Mitte September wurden mindestens 250 Tonnen toter Fische eingesammelt und die Bilder der Katastrophe gingen durch die Medien. Über 2 Wochen lang blieb das Sterben ein Rätsel, bis der Grund dafür schließlich gefunden war: die Goldalge. In einem Bericht der polnischen Regierung wird das pflanzenartige Lebewesen als direkte Ursache genannt. Die Algen setzen Giftstoffe frei, die die Kiemen von Fischen und

Doch warum blühte die Alge so plötzlich und so heftig auf? Paweł Rowiński, Hydrogeologe am Institut für Geophysik der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN), erklärt: »Dies war die erste Blüte dieser Art in großem Maßstab, was zeigt, dass günstige Bedingungen geschaffen wurden.« Der erhöhte Salzgehalt des Flusses, die unmittelbare Voraussetzung für die Blüte, konnte nur durch Einleitungen von Industrieabwässern verursacht worden sein. Zu den weiteren Bedingungen gehören laut Rowiński unter anderem ein niedrigerer Grundwasserspiegel.
Vom Köttelbecken zurück zur Natur
Ähnlich katastrophal ging es bis vor Kurzem der Emscher im Ruhrgebiet. Mitte des 20. Jahrhunderts galt sie als der schmutzigste Fluss Deutschlands. Sie erhielt den lokalen Spitznamen »Köttelbecke« – also ein Bach, in dem Kot schwimmt.

»In dieser Region sehen wir, wie 2 Flüsse auf jeweils eine Funktion reduziert wurden«, erklärt Tobias Schäfer, Gewässerexperte vom WWF Deutschland. »Die Ruhr brachte das Frischwasser und die Emscher führte das Dreckwasser ab.«
In der Blütezeit der Industrie im Ruhrgebiet verlief die Emscher oberirdisch als offener Kanal in einem Betonbett und sammelte industrielles sowie privates
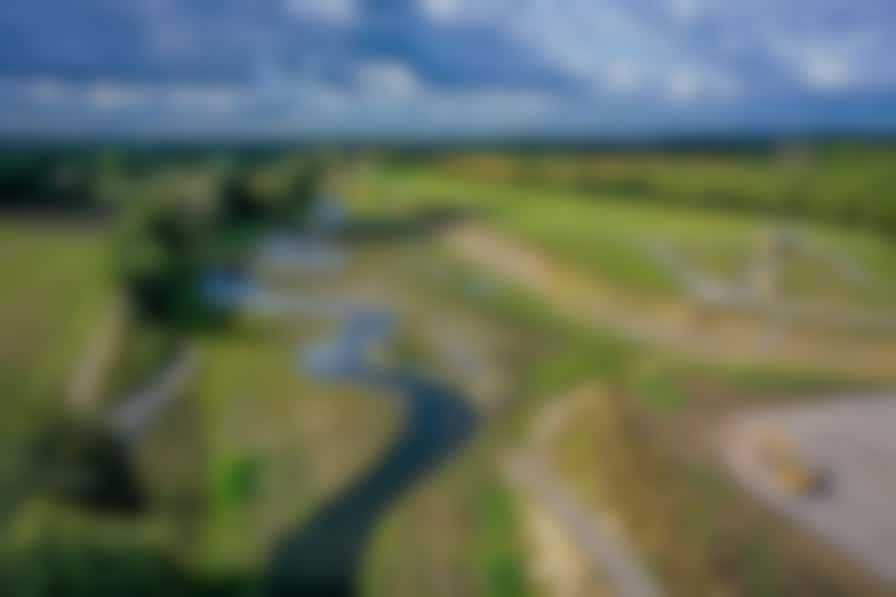
In den 80er-Jahren kam es zu einem Umdenken, erklärt Uli Paetzel, Vorstandsvorsitzender der im Jahr 1899 gegründeten Emschergenossenschaft und Präsident des bundesweiten Dachverbands Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA). Die Emscher sollte renaturiert werden.
30 Jahre Bauzeit waren angesetzt, um mit einem Budget von 9,2 Milliarden DM ein System von 436 Kilometern unterirdischer Rohre zu schaffen – das entspricht etwa der Strecke vom Ruhrgebiet bis nach Paris.

Schritt für Schritt wurden ein unterirdisches Kanalsystem und 4 große Kläranlagen gebaut. Dazu gehören auch mehrere Pumpwerke, um die Höhenunterschiede im Ruhrgebiet zu überbrücken. Gleichzeitig wurden die betonierten Flussbetten aufgebrochen, die Bruchstücke entsorgt und ein natürliches Flussbett geschaffen, sodass die Emscher an vielen Stellen nun nicht mehr geradlinig, sondern in Schlangenlinien verläuft. Zwar entspricht die heutige Form nicht mehr dem ursprünglichen Verlauf der Emscher, trotzdem haben sich die neuen Schlangenlinien von allein gebildet – weil eben dies das natürliche Verhalten eines Flusses ist.
Was macht einen natürlichen Fluss aus?
Durch Erosion, Erdbewegung und Abtragung, aber auch durch verschiedene Fließgeschwindigkeiten des Wassers bilden Flüsse Schlangenlinien. Die Buchten, die dabei entstehen, sind Orte großer Artenvielfalt, da dort beispielsweise Pflanzen und Tiere leben, die eine geringere Strömung brauchen. Ein begradigter Fluss bietet das nicht und fließt meist einheitlich in einer sehr hohen Geschwindigkeit. Gerade im Fall von Wasserstraßen führt das dazu, dass Futtermittel für Fische, die sie normalerweise auf dem Grund finden würden, durch die Strömung und den Sog der Containerschiffe weggewaschen werden.
Ein natürlicher Fluss als multifunktionale Landschaft
Bei der Renaturierung der Emscher ging es aber um mehr als nur darum, einen Fluss aus seinem Betonbett zu befreien. Stattdessen sind in der Region zusätzlich Radwege, Naherholungsgebiete mit Teichen und Naturräume, wie zum Beispiel Gewässerauen, entstanden. Vor allem bei Letzteren handele es sich um Gebiete, die der
Ein Beispiel für einen solchen Artenreichtum ist auch die Oder, oder war es zumindest vor der Katastrophe. Das Flusstal verfügt über Auwälder, deren Artenvielfalt durch das Natura-2000-Gebiet geschützt ist,
Auf die Emscher trifft dies mittlerweile auch wieder zu.
Wir haben beim
Wasserstraßen versus Ökosysteme
Doch der Wiederaufbau eines Ökosystems ist eine akribische Aufgabe, die nicht überstürzt werden darf. Fische dürfen etwa nicht zu schnell eingeführt werden. In einer noch unveröffentlichten Studie des

Piotr Nieznański, Berater beim WWF Polen und Mitglied der
Das heißt, für die Wiederbelebung eines natürlichen Systems durch den Menschen braucht es Fingerspitzengefühl und Geduld. Es gehe um die Wiederherstellung der Wandelbarkeit eines Systems, so Schäfer. Dass Flüsse eben keine geraden Linien seien, sondern sich wänden und in ihrer Breite und Tiefe variierten – das sei das, was das Gewässer als Ökosystem ausmache.
Aber eine solche gerade Linie ist die Oder durch die regionale Nutzung als Wasserstraße für Containerschiffe geworden. »Was wir jetzt auf polnischer Seite sehen, sind Planungen, die den Fluss auf eine Funktion reduzieren wollen, und zwar auf die Funktion der Wasserstraße. Und das hat seinen Preis«, sagt der Experte des WWF Deutschland. Dadurch werde der Fluss zu einem komplett homogenisierten Kanal. Alles, was zum Beispiel Fische bräuchten, werde weggespült und auf null reduziert.

In der Oder gibt es derzeit 23 Staustufen, die die Fischwanderung blockieren und mehr stehendes Wasser schaffen, in dem sich giftige Algen entwickeln können. Mehrere unabhängige Berichte,
Die Idee der polnischen Regierung, Flüsse zu Wasserstraßen zu machen, sei nicht nur schädlich für die Gesundheit der Oder, sondern
Wie viele natürliche Flüsse gibt es in Europa?
Nur noch sehr wenige Flüsse in Europa sind in ihrem Originalzustand und können darum
Die Emscher-Lösung für die Oder?
Aber ob ein mit der Emscher-Renaturierung vergleichbares Konzept für die Oder funktionieren könnte, da ist Paetzel kritisch. Da der Fluss stark für die Schifffahrt genutzt wird, sieht er eine Kollision zwischen ökologisch nachhaltigem Transport einerseits und ökologischer Fluss-Entwicklung andererseits.
Rowiński erklärt zudem, dass sich die Emscher in Bezug auf Größe und Entwicklung von der Oder unterscheide. »Es wird schwierig sein, die Lösungen eins zu eins zu übertragen«, sagt er. Eine vollständige Rückkehr zu einer natürlichen Oder sei unmöglich. »Die Oder ist bereits transformiert, also sollten wir nach innovativen Lösungen suchen, die eine Mischung aus Transformation und Natur darstellen.« Naturnahe Lösungen sind ein solcher Mix – sie enthalten technische Maßnahmen, werden aber von der Natur bestimmt.
In Polen wurden solche naturnahen Lösungen bisher nur an kleinen Flüssen und im Versuchsmaßstab eingeführt, aber ihr Potenzial ist vielversprechend, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Extremeres Wetter birgt auch höhere

Rowiński nennt als weiteres Beispiel neben der Emscher
Inzwischen sind in Polen viele lokale Projekte und Initiativen entstanden:
- Zum Beispiel eine Spendenaktion zur Erforschung und Erstellung eines Wiederaufbauplans für die Oder: Die Koalition
- Der Oder-Stamm (Plemię Odry) ist eine informelle Gruppe von Prominenten (Journalist:innen, Musiker:innen und Schauspieler:innen), die der Oder den Status einer juristischen Person verleihen wollen.
- Die Zeitung Gazeta Wyborcza und Greenpeace Polen haben eine Petition ins Leben gerufen, um einen Nationalpark zu errichten, wo es derzeit einen Landschaftspark Unteres Odertal gibt. Landschaftsparks bedeuten in der Regel weniger Schutz als Nationalparks.
Ungeachtet all dieser Bemühungen sagt Rowiński: »Die Oder ist ein sehr großer, internationaler Fluss, der stark umgestaltet ist und im Moment hauptsächlich der Wirtschaft dient. Jede Aktion einer NGO kann nur ergänzend sein. Die Wiederbelebung erfordert einen sehr integrierten, systematischen Plan und kohärente Maßnahmen. Das ist kostspielig und kann daher nur vom Staat geleistet werden.«
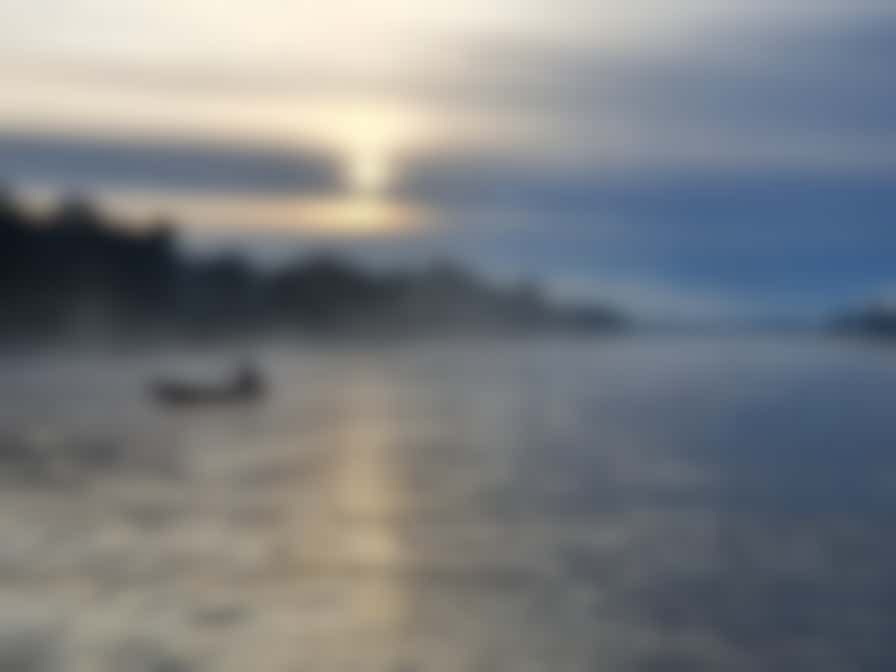
Behörden müssen aktiv werden
Auf Regierungsebene müsse einiges geschehen. Paetzel fordert zum Beispiel ein Monitoring der Gewässerqualität sowie eine strikte Überwachung der Einleitungen mit klaren Genehmigungsverfahren, wer was in welchen Mengen wo einleiten dürfe.
Der erste Schritt bestehe darin, ein ständiges, automatisiertes Überwachungssystem
Darüber hinaus müssten die Rechtsvorschriften über die
Auch Paetzel fordert eine striktere Umweltüberwachung durch die Regierungen:
Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Wir brauchen einen starken Staat, der klare Umweltregulierungen und eine ausreichende Kapazität in der Verwaltung hat. Dafür brauchen wir entsprechend ausreichende Experten. Aber leider erleben wir schon in Deutschland, dass die Umweltverwaltung personell nicht umfangreich genug ausgestattet ist.
Nur dann können aus Wasserstraßen und Köttelbecken wieder gesunde Flüsse werden – so wie die Emscher.
Redaktionelle Bearbeitung: Maria Stich
Titelbild: picture alliance / Rupert Oberhäuser - copyright



