Wie geflüchtete Kinder in den Bergen ein Stück Normalität finden
Mit ihren Eltern flüchten immer noch viele ukrainische Kinder vor dem Krieg – ins Ausland, aber auch in sichere Regionen im Inland, zum Beispiel in kleine entlegene Karpatendörfer in der Westukraine.
Im Herbst regnet es gewöhnlich in den Karpaten. Die Einheimischen lassen sich dadurch nicht stören. Sie bringen die Ernte ein, sammeln im Wald Pilze, hüten das Vieh. An einem kalten Septembertag – das Thermometer zeigt 6 Grad – treffen wir im Dorf Strilky die Projektmanagerin und Ehefrau des hiesigen Priesters Natalka Hrom. Sie lädt uns zu sich nach Hause ein, ins Nachbardorf Mschanets. Wir steigen in ihr E-Mobil ein.
Natalka erzählt, dass die Straße, die wir gerade befahren, zum Symbol für das Aufbegehren der Bürger:innen geworden ist. Sie ist 18 Kilometer lang und verbindet 11 Dörfer. Ein halbes Jahrhundert lang wurde sie nicht renoviert: statt Asphalt waren hier nur noch Schlaglöcher. Für diese 18 Kilometer brauchte man 2 Stunden. 2019 und 2020 protestierten die Menschen gegen diese Zustände. Aber erst, als sie zum drastischen Mittel des Hungerstreiks griffen, gab die regionale Verwaltung nach und machte Gelder für die Sanierung der Straße frei. Heute bewältigt man die Strecke in 15 Minuten.
 Die Projektmanagerin und Aktivistin Natalka Hrom
Die Projektmanagerin und Aktivistin Natalka Hrom  Pater Roman entwickelt hier ein soziales Unternehmen. Die Gemeinde hat Hütten für Touristen gebaut. Die Einkünfte aus der Miete werden für soziale Initiativen ausgegeben.
Pater Roman entwickelt hier ein soziales Unternehmen. Die Gemeinde hat Hütten für Touristen gebaut. Die Einkünfte aus der Miete werden für soziale Initiativen ausgegeben.  Sonntags trifft sich das ganze Dorf Mschanets in der Kirche.
Sonntags trifft sich das ganze Dorf Mschanets in der Kirche. Mschanets ist ein Grenzdorf in der Ukraine, von Polen durch niedrige Berge getrennt. Im Dorf wohnen ungefähr 140 Menschen, das ist die Kirchengemeinde von Natalkas Ehemann Pater Roman. Er betreut als Priester auch die Dörfer Ploske (40 Einwohner:innen) und Haliwka (27 Einwohner:innen). Wir halten in der Nähe von Natalkas Haus.
Niemand dachte, dass der Krieg Realität wird. In den ersten Tagen des Krieges überlegten wir in der Gemeinde, wie und wo wir Flüchtlinge unterbringen könnten. In jedem Dorf hatten wir unsere Koordinatorinnen, die leere, alte Häuser vorbereiteten, sie putzten und renovierten. 3 unserer Dörfer fingen über 200 Menschen auf. Jetzt leben bei uns diejenigen, die kein anderes Zuhause für den Winter haben: in Ploske 4 Familien, in Mschanets sind es 5 oder 6, darunter auch eine kinderreiche Familie aus dem Gebiet Sumy, die für immer in Mschanets bleiben will. Das Haus, in dem sie wohnen, haben ukrainische Mäzene für sie gekauft.
»Wir wollten, dass sie eine gewöhnliche Kindheit haben«
In der Nähe des Pfarrhauses fließt ein Fluss, die Mschanets. Die Brücke über den Fluss führt zur alten Schule. 2 pensionierte einheimische Lehrerinnen, Nadija und Iryna, hielten hier für die geflüchteten Kinder von April und bis Herbst informellen Integrationsunterricht. In den 80er-Jahren gab es noch ca. 700 Schüler in dieser Schule. Die jungen Leute aber zog es nach und nach in Großstädte und auch ins Ausland. So waren 2017 nur noch 5 Schüler da. Also wurde die Schule geschlossen. Sie sollte zu einem Hospiz umgebaut werden. Die Umbauarbeiten wurden aber nicht abgeschlossen.
Kinder auf der Flucht
Durch die russische Invasion sind in der Ukraine über 400 Kinder umgekommen. Die genaue Zahl der Opfer kann wegen der Kampfhandlungen und der noch andauernden Besatzung einiger Gebiete nicht festgestellt werden. Über 2 Millionen Kinder sind vor dem Krieg ins Ausland geflüchtet. 3 Millionen sind zu Binnengeflüchteten geworden.
Wir betreten das Gebäude. Nadija macht die Tür zu einer Klasse auf. Auf dem Fensterbrett steht Spielzeug, überall liegen Bücher und Kinderzeichnungen herum. »Wir haben Kinder im Alter von 3–10 Jahren für die Klasse zusammenbekommen, und dann hat sich herausgestellt, dass es keine Möbel gibt«, erinnert sich Nadija. »Irgendwo fanden wir noch ein paar der alten Schulbänke, auch Tische und Schränke. Der erste Schultag war am 16. April, gerade zur Osterzeit. Wir erzählten über die Osterbräuche unserer Gegend, was für die Kinder, die aus verschiedenen Regionen der Ukraine kamen, sehr spannend war. Insgesamt besuchten 31 Schüler unseren Unterricht. Hin und wieder schlossen sich auch Einheimische an.«
Manchmal gingen wir in den Wald. Vor allem jene Kinder, die Schreckliches erlebt hatten, reagierten schockiert auf unbekannte Geräusche. Die traumatischen Erlebnisse hatten sie ängstlich gemacht. Sie hatten lange Schwierigkeiten, etwas Neues als nicht gefährlich einzuordnen. Einmal kam der 6-jährige Artem aus Pokrowsk zu mir und sagte weinend, dass er kein Ukrainisch kann. Die einheimischen Kinder halfen ihm sofort und begannen, alles Mögliche auch auf Russisch zu erklären. 2 Tage später sagte Artem, dass er das Ukrainische schon viel besser versteht. Dann malte er eine Pizza. Er vermisste die Pizzeria seiner Stadt sehr. Im Unterricht sprachen wir nicht über schmerzhafte Themen. Wir wollten, dass die Kinder eine gewöhnliche Kindheit haben.

Die Lymars
Die Lymars kennen alle in Mschanets: eine Familie aus Sumy mit 5 Kindern. Mit ihrer Ankunft hat sich die Zahl der Kinder im Dorf verdoppelt. Wir betreten den Bauernhof. Hier wird eifrig gearbeitet: Das alte Haus wird renoviert. Auf dem Dach schuftet der Familienvater Wiktor Lymar. Das Haus wurde von der Ukrainischen Katholischen Universität Lwiw für die Familie gekauft. Auf Bitten von Pater Roman sind 25 Freiwillige der Nichtregierungsorganisation Building Ukraine Together (Будуємо Україну разом) gekommen. Sie helfen beim Renovieren. Noch vor dem ersten Frost soll das Dach neu gedeckt und die wichtigsten Innenausbauarbeiten abgeschlossen sein.
 Anja Lymar mit ihrem Sohn Artur
Anja Lymar mit ihrem Sohn Artur  Oleh schreibt Lieder und mag Rap.
Oleh schreibt Lieder und mag Rap.  Wiktor Lymar ist Handwerker.
Wiktor Lymar ist Handwerker. Wiktors Frau Anja hält den jüngsten Sohn auf dem Arm, den einjährigen Artur. Sie erzählt, dass sie Sumy am 11. März verlassen haben. Der letzte Anlass war, dass ein feindliches Flugzeug über ihr Haus flog und 100 Meter weiter eine Bombe auf das Heizkraftwerk abwarf. 2 Tage waren sie bis nach Lwiw unterwegs. Dort hat man ihnen vorgeschlagen, nach Mschanets zu gehen.
Anjas Schwester ist mit ihren Kindern nach Deutschland gegangen. Anja selbst und ihr Mann hatten große Bedenken und auch Angst, mit 5 Kindern in ein fremdes Land zu ziehen. Der älteste Sohn Oleh besuchte die Kadettenschule in Sumy, er sollte Grenzsoldat werden. Dass ihn sein Vater von dort abholen konnte, erinnert an ein Wunder: Eine Stunde nachdem die beiden weg waren, wurde Olehs Schule zerbombt. Heute wollen die Eltern nicht mehr, dass ihr Sohn einen Beruf erlernt, in dem man Uniform trägt.
Die Jermakows und die Selenskis
Die Lymars sind nicht die einzigen, die in den Karpaten ein neues Zuhause gefunden haben. An Mschanets grenzt ein anderes Dorf: Ploske. 49 Geflüchtete leben dort seit Kriegsbeginn. Die Dorflehrerin Natalia Lopuschanska berichtet von 2 Familien aus dem Gebiet Donezk: die Jermakows und die Selenskis. Sie kamen als erste, nämlich schon im März. Sie sind immer noch da und wollen über den Winter in den Karpaten bleiben.
Wir betreten einen kleinen Hof. Die Tür öffnet uns Oleksij Jermakow, der Familienvater. Er stammt aus der Siedlung Staromychajlowka, einer Vorstadt von Donezk. Wir ziehen unsere Schuhe aus und lassen sie im Vorraum. In der Ecke steht ein Eimer Äpfel. Es riecht nach gedünsteten Tomaten. »Kommen Sie herein, bleiben Sie nicht im Gang stehen«, lacht der Mann. »Wir machen gerade Adschika [eine scharfe Soße, Anmerkung der Übersetzerin], und zwar nach dem Rezept meiner Mutter: Man nehme 3 Kilogramm Tomaten, 25 Paprikaschoten, 300 Gramm Knoblauch, 2–5 Chilis.« Oleksijs Frau Angela scherzt: »Eingelegtes ist die große Leidenschaft meines Mannes!«
 Oleksij Jermakow mit seiner Frau Angela und dem Plüschkater Riki. Sie steckten ihn gerade noch ein, als sie ihr Haus verließen. Heute ist es das Lieblingsspielzeug der älteren Tochter.
Oleksij Jermakow mit seiner Frau Angela und dem Plüschkater Riki. Sie steckten ihn gerade noch ein, als sie ihr Haus verließen. Heute ist es das Lieblingsspielzeug der älteren Tochter.  Oleksij kocht Adschika. Auf dem Bett der kleine Sohn, auch er heißt Oleksij.
Oleksij kocht Adschika. Auf dem Bett der kleine Sohn, auch er heißt Oleksij.  Im Dorf gibt es keine Gasheizung. Die Bauern beschaffen Brennholz.
Im Dorf gibt es keine Gasheizung. Die Bauern beschaffen Brennholz. Zum ersten Mal ist die Familie im Jahr 2014 geflüchtet, als der Krieg begonnen hat. Damals sind sie wegen der Kämpfe ins Dorf Krasna Poljana in der Oblast Donezk umgezogen, und dann von dort ins 34 Kilometer entfernte Wuhledar. Dort war Oleksij 16 Jahre lang Bergarbeiter gewesen.
Als Russland im Februar 2022 die Ukraine überfiel, befanden sich die beiden Töchter von Oleksij und Angela an ihren Studienorten: die 18-jährige Ksenia in Charkiw, die 21-jährige Kateryna in Kyjiw. Ksenia flüchtete im März vor den russischen Raketen. Mit einem Evakuierungszug kam sie nach Lwiw. Nun lebt sie zusammen mit den Eltern in Ploske und studiert im Fernunterricht weiter. Kateryna ist nach Westeuropa gegangen und von dort weiter nach Kanada.
Oleksij, seine Frau und der 8-jährige Sohn Oleksij sind bis zum Schluss in Wuhledar geblieben, bis die Russen anfingen, die Stadt zu bombardieren. Im März kamen sie dann nach Ploske in den Karpaten. »Zu Hause ist überall Steppe und Hitze«, sagt Oleksij. »Man geht aus dem Haus und sieht 10 Kilometer weit, alles drum herum. Und hier sind Berge, es ist kalt. Die Luft ist klar. Seltsam, dass es hier keine Aprikosen gibt: Zu Hause lagen sie haufenweise auf den Straßen. Hier aber, hier ist das Apfelparadies und das Pilzparadies.«
Angelas Schwester Halyna Selenska kommt ins Zimmer, gefolgt von ihrem 10-jährigen Sohn Dawyd. Sie wohnen in der Nähe. Halyna trägt ein gelb-blaues Armband. Dawyd und sein Bruder Kyrylo (17) haben vor dem Krieg Ringen im griechisch-römischen Stil betrieben. Alle Medaillen und Auszeichnungen sind zu Hause geblieben.
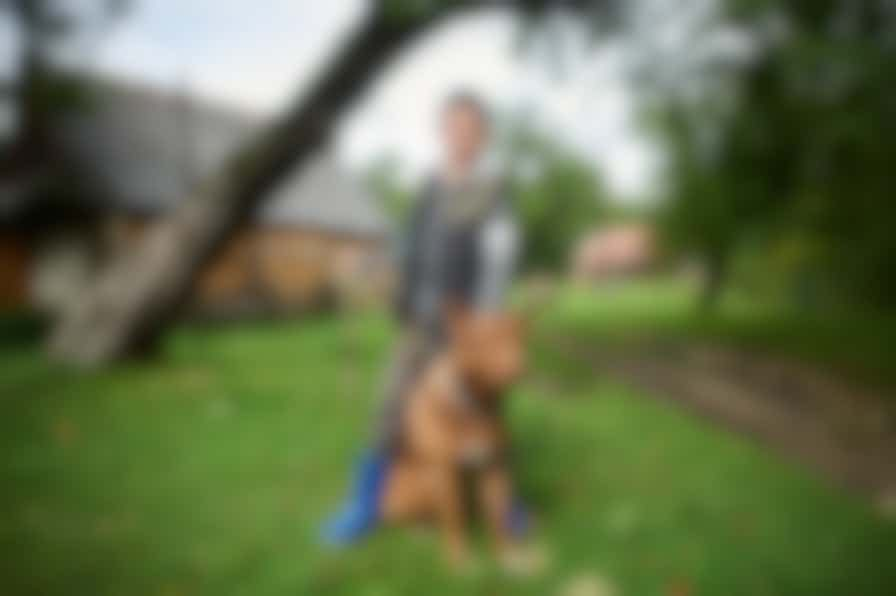
»Mit gefällt es hier im Dorf«, sagt Dawyd. »Auf dem Feld hinterm Laden spielen wir Fußball mit Iwan, Petro und Wassyl, unseren neuen Freunden aus dem Dorf. Nur haben wir uns noch keinen Namen für unsere Mannschaft ausgedacht.« Vor dem Krieg lebte Halyna mit ihrer Familie in Wuhledar. Sie arbeitete als Verkäuferin. Jetzt ist sie Hausfrau. Der Mann ist in den Krieg gegangen.
Wir waren vorher nie in der Westukraine. Es ist schön hier, der Wald ist so schön! Aber im März war Matschwetter, es lag noch Schnee. Das war zuerst ein Schock, weil wir nicht wussten, wie wir hier weiterleben sollen. In Wuhledar hatten wir eine Wohnung. Man hat sich an sein Leben gewöhnt, aber dann wird man plötzlich in eine ganz andere Realität geworfen. Mittlerweile haben wir uns hier eingewöhnt. Wir hacken Holz und bereiten uns auf den Winter vor.
Die Kinder der Jermakows und Selenskis laufen aus dem Haus, weil sie uns bis zum Auto begleiten wollten. Aber sie fragen nichts und schauen uns nur aufmerksam an. Dann fahren wir weiter ins Dorf Strilky, wo in einem Schülerwohnheim noch weitere Menschen untergebracht worden sind, die der Krieg aus ihrer Heimat herausgerissen und auf ungewisse Zeit in die fernen Berge katapultiert hat.
Die Sewastjanows
Tetiana Sewastjanowa stammt aus dem Städtchen Kostiantyniwka, Oblast Donezk. Nach Strilky kam sie im Mai. Derzeit ist sie im Mutterschaftsurlaub. Sie hat 3 Kinder: Antonina (15), Maksym (8) und Illia (4). Wie Hunderttausende ukrainische Geflüchtete kam sie mit dem Evakuierungszug aus dem Kriegsgebiet nach Lwiw. »Im Abteil waren wir zu elft«, erinnert sich Tetiana. »Ich stand die ganze Nacht am Fenster, damit der Kleine, so gut es ging, auf meiner Liege schlafen konnte. Die älteren beiden lagen zu zweit auf der oberen Liege. Wir hatten jeder einen Rucksack und eine gemeinsame Tasche mit Lebensmitteln. Man hat uns gesagt, dass man nur so wenig mitnehmen darf, weil es keinen Platz im Zug gibt. Unsere Nachbarin hatte aber 15 Taschen. Sie sagte: ›Hätte ich meinen Pelzmantel zurücklassen sollen?‹«
Tetiana fuhr ins Ungewisse. In Lwiw hatte sie weder Verwandte noch Bekannte. Die Volontär:innen brachten sie zum Fußballstadion. Dort konnte sie zum ersten Mal seit Tagen ein wenig schlafen. Die letzten Tage vor der Abfahrt stand ihre Heimatstadt unter Dauerbeschuss. Die Familie übernachtete im Keller. »Wir wohnten in einer Grauzone«, sagt Tetiana. »In den letzten 8 Jahren hatten wir uns schon an Explosionen gewöhnt, anders als die Menschen in Lwiw oder Kyjiw, für die Bomben etwas erstaunlich Neues waren.« Als die Familie nach Strilky kam, wurde sie im Wohnheim in einem Zimmer untergebracht, in dem es für 21 Personen und 3 Katzen 18 Betten gab. Nach und nach verließen die Geflüchteten diesen Ort. Tetiana bekam ein eigenes Zimmer. Vor Kurzem kam auch Tetianas Mutter Antonina zu ihnen. Die beiden hatten sich 7 Monate lang nicht gesehen.
 Tetiana mit dem jüngsten Sohn Illia, der wie sein Vater zum Militär will.
Tetiana mit dem jüngsten Sohn Illia, der wie sein Vater zum Militär will.  Antonina mit dem Enkel Maksym. Er will Pilot werden.
Antonina mit dem Enkel Maksym. Er will Pilot werden. Tetiana gießt Tee in die Tassen. Antonina öffnet ein Glas mit geschnittenen Zitronenscheiben. Vitamine, meint sie. Die Kinder halten Sicherheitsabstand hinter Oma und Mama. Schüchtern beobachten sie uns. Hin und wieder greifen sie nach den Pralinen.
Antonina hat 42 Jahre bei der Eisenbahn gearbeitet. Sie überwachte den Betrieb der Bahnstation Kostiantyniwka. In 9 Monaten sollte sie pensioniert werden. »Nun weiß ich nicht, was kommt«, seufzt sie. »Vielleicht werde ich kündigen müssen. Zurück will ich zurzeit nicht. Einmal gab es in der Nacht eine dermaßen starke Explosion, dass die Fenster herausflogen und die Decke einstürzte. Das ist nichts für mein Alter und nichts für meine Nerven! Ich mag meine Arbeit sehr. Aber [sie weint] … hier sind wenigstens die Enkelkinder bei mir. Mein Sohn ist bei Awdijewka, mein Schwiegersohn in Kostjantyniwka. Dort wird überall geschossen. Wir beten, dass alles gut endet. Der Krieg – das ist schrecklich. Es ist besser, nichts davon zu sehen.«
Und Tetiana ergänzt, dass die Kinder während des Krieges erwachsener, ernsthafter geworden seien. »Einmal ging ich mit meinem kleinen Sohn auf der Straße«, erzählt sie. »Wir suchten nach der Hündin Ryzhucha. Da war ein anderer Hund, und Illia warf ihm einen Knochen hin. Da kam auf einmal Ryzhucha und wollte dem anderen Hund den Knochen wegnehmen. Illia sagte: ›Mama, das ist doch unsere Ukraine, und das dort Russland. Jetzt wird sie Russland umbringen. Weil wir stark sind.‹ Das Kind ist 4 Jahre alt. Illia versteht, dass Russland uns überfallen hat, dass Russland uns Unrecht tut.«
Die von der Insel
Ein Stockwerk unter den Sewastjanows wohnt Myron (11). Er singt, mag Jazz und Rap. Myron kommt aus

»Als der Krieg ausbrach, hatten wir keine Lebensmittel«, erinnert sich Olena. »Ein Nachbar fing Fische mit Netzen: 3 Tonnen Karauschen, und die verteilte er dann. Ja, das ist Wilderei. Aber die Menschen mussten doch etwas essen. Die Russen verteilten auch etwas: Hühner, nachdem die lokale Hühnerfarm zerbombt worden war. Es gab kein Futter für sie. Man brachte die Hühner sackweise, und sie haben schon gestunken. Mutter hat sie lange gewässert und dann kräftig mit Gewürzen eingerieben. Wir haben das gegessen, weil wir Hunger hatten. Aber seither mögen wir kein Geflügel mehr.«
Myron zeigt auf dem Handy ein Foto seines Stadtviertels. »Das ist unser Haus, das fünfte«, erklärt er. »Das ist die Brücke. Und das da ist Omas Haus. Die Russen sind mit ihren Panzern in unseren Hof gefahren. Das große Metalltor haben sie dabei herausgerissen.« Am 12. April verließen Olena und ihr Sohn das besetzte Gebiet. Damals hat es noch keinen russischen Checkpoint gegeben. An diesem Tag ist ungefähr die Hälfte der Leute von Ostriw weggegangen. Vor dem Krieg wohnten dort ungefähr 4.000 Menschen.
Olenas Mann und
Ab und zu ruft Myron seine Freunde in Cherson an. »Mein Freund Jaroslaw sagt, dass eine Dose Cola in Cherson jetzt 83 Hrywnja [etwa 2,30 Euro] kostet«, sagt Myron.
Und dann gibt es noch meine Freunde Kyrylo und Maksym. Kyrylo ist jetzt in der Oblast Odesa. Er passt auf Omas Entenküken auf, damit sie nicht ins Maisfeld rennen, und er jagt die Hunde von den Küken weg. Mein allerbester Freund aber ist Maksym. Er ist jetzt in Zhowti Wody. Wir werden uns treffen, wenn der Krieg zu Ende ist. Dann gehen wir auf unserer ganzen Insel spazieren. Mein größter Traum ist, meinen Hund Baffi wiederzusehen. Er sagt nämlich ›baff‹ statt ›wau‹. Ich träume jeden Tag, dass wir nach Hause fahren. Und zum Meer.
Übersetzung: Olha Sydor
Diese Recherche entstand dank einer Förderung durch Journalismfund.eu. Dieser Text ist zuerst beim deutsch-tschechisch-slowakischen Onlinemagazin Jádu erschienen, das mit dem Projekt EXIL ЕКЗИЛЬ Geflüchteten aus und in der Ukraine eine Stimme gibt.
Mit Illustrationen von Frauke Berger für Perspective Daily

