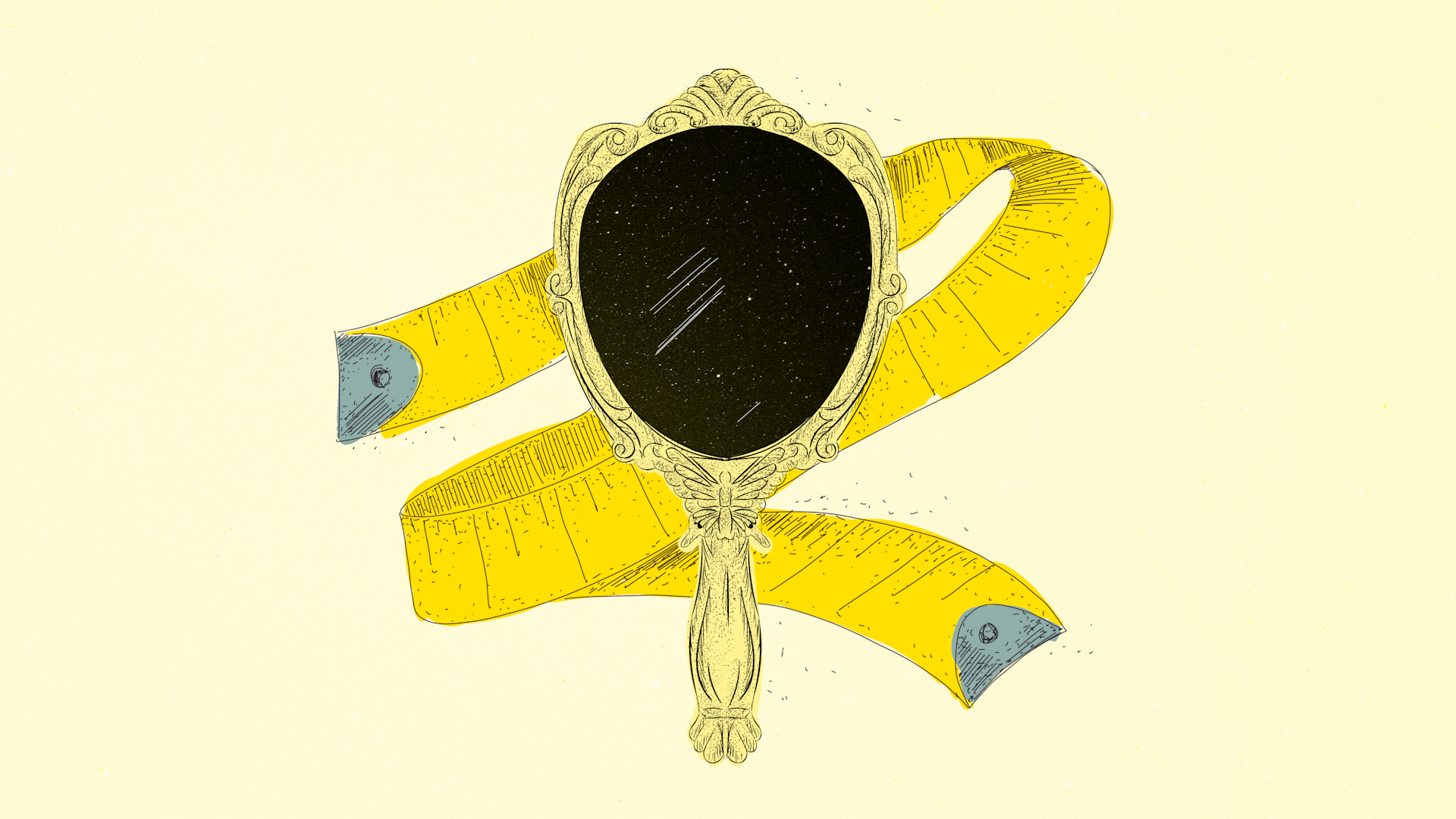Bin ich »normal«?
Hat mein Körper eine normale Form? Habe ich zu wenig Sex – oder zu viel? Menschen sind von Fragen wie diesen besessen. Dabei hat die Sehnsucht nach Vergleichen und Normen auch eine dunkle Seite.
Die Geschichte des Normalen, wie wir es kennen, begann am Neujahrstag 1801, als der italienische Priester und Astronom Giuseppe Piazzi bei der Suche nach einem Planeten zwischen Mars und Jupiter am Himmel einen neuen Stern entdeckte. Bis zum 11. Februar verfolgte Piazzi die Bewegungen des Sterns – den er nach der römischen Göttin des Ackerbaus Ceres nannte –, dann verlor er ihn durch die zunehmende Nähe zur Sonne aus den Augen. Im Oktober (vor der Erfindung des Internets verbreiteten sich Neuigkeiten sehr viel langsamer als heute) erreichten die von Piazzi veröffentlichten Daten den 24-jährigen deutschen Mathematiker Carl Friedrich Gauß.
Sarah Chaney: Bin ich normal?

»Bin ich normal? Warum wir alle von dieser Frage besessen sind und wie sie Menschen abwertet und ausgrenzt« erschien am 5. April 2023 im Goldmann Verlag. Dieser Text ist ein gekürzter Auszug des ersten Kapitels.
Bildquelle: Goldmann VerlagNachdem es Piazzi nicht gelungen war, genügend Messungen vorzunehmen, um Ceres’ Umlaufbahn zu bestimmen, errechnete Gauß mithilfe einer mathematischen Formel einen Durchschnitt, den er in einem Graphen darstellte. Die so entstandene glockenähnliche Kurve hatte eine abgerundete Kuppe in der Mitte und lief zu beiden Seiten flach aus. Gauß behauptete, dass Ceres an dem Punkt wieder auftauchen würde, der exakt in der Mitte dieser Kurve liege. In der nächsten klaren Nacht zeigte sich, dass der junge Mathematiker recht hatte. Schon bald verband man den Namen des deutschen Sternsuchers mit der Glockenkurve, und noch heute wird sie manchmal als Gauß-Verteilung bezeichnet. Zu Beginn jedoch nannte man sie die »Fehlerkurve«.
Jahrhundertelang waren sich Astronomen darüber im Klaren gewesen, dass die Messungen in ihrem Fachgebiet fehleranfällig waren. Diesem Problem begegneten sie, indem sie dieselben Messungen viele Male durchführten. Kleinere Abweichungen kamen häufiger vor als große, so entstand die Glockenform der von Gauß aufgezeichneten Kurve. So weit, so gut. Eine sehr einfache Variante dieser Vorgehensweise haben Sie vielleicht selbst schon beim Aufbau eines Regals oder Ähnlichem angewandt, indem Sie die Messungen immer und immer wieder überprüft haben, bevor Sie die erforderlichen Löcher gebohrt haben. Ich liege trotzdem unweigerlich immer ein paar Millimeter daneben. Aber was haben die Bemühungen von Astronomen – und Hobbyschreinern – um die exakten Messungen von Entfernungen mit den Normen des menschlichen Lebens zu tun?
Diesen Widerspruch verdanken wir einem umtriebigen belgischen Statistiker: Adolphe Quetelet, der 1796 in Gent geboren wurde. Am früheren Standort der königlichen Sternwarte von Brüssel, die mehr als 40 Jahre lang Quetelets Zuhause war, wurde eine Straße nach dem Wissenschaftler benannt. Ich habe die alte Sternwarte vor ein paar Jahren besucht, und die ehrenamtlichen Hilfskräfte wunderten sich bestimmt, wieso jemand ihren Arbeitsplatz fotografierte. Place Quetelet war eine ganz gewöhnliche Straße. Unauffällig. Normal.
1835, fünf Jahre nach der Belgischen Revolution, veröffentlichte Quetelet sein berühmtestes Buch: »Über den Menschen und die Entwicklung seiner Fähigkeiten, oder Versuch einer Physik der Gesellschaft«. Quetelet, der nach dem jüngsten Umbruch Ordnung in der menschlichen Gesellschaft suchte, nahm die Fehlerkurve der Astronomen und übertrug sie auf die Vermessung des Menschen. Angesichts des signifikanten Unterschieds in der Art seiner Daten war es nicht selbstverständlich, dass dies auch funktionieren würde.
Die exakte Position eines Sterns zu bestimmen ist nicht dasselbe, wie beispielsweise die menschliche Größe zu ermitteln. Es gibt kein »richtiges« Ergebnis, nur einen Durchschnitt, der sich aus dem in der Bevölkerung am häufigsten vorkommenden Maß ergibt. Vor allem aber darf man nicht vergessen, dass der astronomische Hintergrund von Richtig und Falsch bedeutete, dass das Normale beim Menschen von Anfang an mit der Vorstellung verknüpft war, das Normale sei nicht nur ein Durchschnitt, sondern korrekt. Diejenigen, die dem normalen Ideal nicht entsprachen, wurden zu Fehlern – aber diesmal nicht Fehler der Astronomen, sondern Fehler Gottes oder der Natur.
So begann mit einer simplen Kurve die geradezu obsessive Beschäftigung der Wissenschaft mit dem Normalen. Bis heute ist die Glockenkurve in den Lebens- und Sozialwissenschaften weitverbreitet, vielleicht erinnern Sie sich noch aus Ihrer Schulzeit daran. Aber ihre Herkunft zeigt deutlich, wie weit sich die Normalverteilung von ihrer ursprünglichen Funktion entfernt hat. Schließlich gibt es, anders als bei der Positionsbestimmung von Sternen, viele Faktoren, die Messungen beim Menschen beeinflussen.
Diejenigen, die dem normalen Ideal nicht entsprachen, wurden zu Fehlern – aber diesmal nicht Fehler der Astronomen, sondern Fehler Gottes oder der Natur
Zum Beispiel die Größe:
Natürlich umfassen 95% der Bevölkerung nicht einmal ansatzweise jeden. Über drei Millionen Briten fallen aus diesen Parametern heraus: Das ist mehr als die Gesamtbevölkerung von Barbados, Brunei, Dschibuti, Luxemburg und Malta zusammen. Und was ist mit genderfluiden oder nichtbinären Personen? Sie werden in solchen Studien einfach ausgeblendet; und das ist nur ein erstes Beispiel dafür, wie die normale Statistik bestimmte Definitionen einer Bevölkerung bevorzugen kann – und dies auch tut.
Außerdem verändern sich die Grenzwerte und die Form der Glockenkurve je nachdem, welche Gruppe vermessen wird. Würden wir alle Geschlechter in einer Skala zusammenführen, dann wäre das Ergebnis ein
So wird schnell deutlich, dass ein vermeintlich objektives Maß wie die Normalgröße sehr viel weniger eindeutig ist, als es auf den ersten Blick erscheint. Trotzdem wird die Glockenkurve noch immer regelmäßig verwendet, um bestimmte Merkmale einer Bevölkerung zusammenzufassen – obwohl ihre Schöpfer, als sie durch ihre Teleskope spähten, sich niemals hätten träumen lassen, dass sie eines Tages zum Abbild menschlicher Eigenschaften, geschweige denn zum Maßstab von Normalität werden könnte.

Der Durchschnittsmensch
Wie und warum begannen die Menschen also, sich selbst als »normal« zu betrachten? Vor 1820 benutzte niemand das Wort »normal«, um sich oder andere zu beschreiben; auch Wissenschaftler oder Ärzte verwendeten es nicht in Bezug auf die Bevölkerung. »Normal« war ein mathematischer Begriff, der sich auf Winkel, Gleichungen und Formeln bezog. Nicht Menschen waren normal, sondern Linien und Berechnungen.
Es gab vielleicht einige Hinweise darauf, dass sich die Bedeutung von »normal« allmählich zu ändern begann. Als ich vor ein paar Jahren Gent besuchte, auf der Suche nach den Anfängen der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Normalen, wohnte ich ganz in der Nähe der Normaalschoolstraat. Natürlich machte ich ein Selfie mit dem Straßenschild.
Quetelets großes Konzept war der »Durchschnittsmensch« (l’homme moyen). Ausgehend von seinen statistischen Analysen hielt er den Durchschnittsmenschen für das wahrheitsgetreueste Abbild der Menschheit. Im Gegensatz zu uns, die auf Mittelmäßigkeit herabschauen, war »durchschnittlich« für Quetelet gleichbedeutend mit »perfekt«. »Jede Eigenschaft, innerhalb angemessener Grenzen betrachtet, ist ihrem Wesen nach gut«, schrieb er, »nur in ihren extremen Abweichungen vom Mittel wird sie schlecht.«
Um Durchschnittswerte zu ermitteln, brauchte er eine ausreichend große Stichprobe – und eine Armee lieferte ihm die perfekte Grundlage für seine Untersuchungen. Der belgische Statistiker nutzte die veröffentlichten Daten zum Brustumfang von 5.738 schottischen Soldaten. Die voneinander abweichenden Maße dieser Soldaten, erklärte er, folgten auf einem Graphen der gleichen Kurve, wie es 5.738 leicht fehlerhafte Messungen ein und desselben Mannes tun würden. Durch diese Analogie wurden die realen schottischen Soldaten zu Fehlern in der Fehlerkurve. Sie waren nicht einfach nur Abweichungen vom Durchschnitt, sondern unperfekte Kopien des idealen Mannes, »als seien die vermessenen Brustkörbe nach demselben Typus, demselben Individuum geformt worden«.
Die Fehlerkurve war von einer statistischen Wahrscheinlichkeitsrechnung zu einem Naturgesetz geworden. Jede Verschiebung weg vom Normalen war grundsätzlich ein Fehler, eine Abweichung von der perfekten menschlichen Form, die der Schöpfer gestaltet hatte. (Denn anders als viele spätere Verfechter des Normalen war Quetelet kein Atheist.)
Obwohl Quetelet stets behauptet hatte, der Durchschnittsmensch sei ein Abbild der Natur, begannen sich die Europäer nach ihm Gedanken zu machen über die Diskrepanz zwischen den klassischen Idealen von Größe, Körperbau und Erscheinung und dem, was sie um sich herum erblickten. Normal, erklärten sie voller Abscheu, war nicht länger der Durchschnitt einer Bevölkerung (immer vorausgesetzt, das sei er jemals gewesen), sondern das, was existieren sollte, aber es nur selten tat. Während Quetelet der Auffassung gewesen war, der ideale Körper des »Durchschnittsmenschen« ginge einher mit einem moralisch vollkommenen Geist, sahen diese späteren Autoren in ungewöhnlichen Körpern Unmoral, Idiotie und Krankheit.
Indem Quetelet menschliche Körpermerkmale in einer Fehlerkurve abbildete, übertrug er nicht nur das Studium statistischer Durchschnittswerte auf soziale Phänomene. Er begründete auch die Idee, dass jegliche Abweichung vom Zentrum der Glockenkurve eine Art Fehlentwicklung sei. Sein »Durchschnittsmensch« war der erste »normale« Mensch. Dabei war der Durchschnittsmensch an sich eine Art Paradox. Er war gleichzeitig ein Abbild der realen Natur und ein Ideal, auf das die Menschheit hinarbeiten sollte, makellos in Körper und Geist und der Inbegriff vollkommener Gesundheit.

Die Vermessung der Gesundheit
Was ist das Gegenteil von normal? Nun, das hängt vom Kontext ab. Wenn wir unter normal durchschnittlich verstehen, dann könnte das Gegenteil extrem oder außergewöhnlich sein. Wenn normal üblich bedeutet, dann wäre das Gegenteil ungewohnt oder fremd.
Diese Paarung fand erst in den 1820er-Jahren Eingang in die Medizin und entwickelte sich von da an zur Grundlage des ärztlichen Verständnisses von Gesundheit und Krankheit.
Es ist womöglich dieser Bereich, in dem die Frage, was eigentlich normal ist, für uns die verstörendsten Konsequenzen hat. Wenn wir nicht normal sind, bedeutet das dann, wir sind krank? Die Sorge um Gesundheit und Krankheit der Bevölkerung war auch einer der Hauptgründe für den rapiden Anstieg statistischer Datensammlungen im frühen 19. Jahrhundert. Erstmals griff diese Besessenheit von Zahlen während der verheerenden Choleraepidemie um sich, die Europa heimsuchte, nur wenige Jahre bevor Adolphe Quetelet den »Durchschnittsmenschen« auf die Welt losließ.
Am 15. September 1832 erreichte die
Als der Ausbruch endete, zählte man 837 diagnostizierte Ansteckungen, und über die Hälfte der Patienten (421) war an der Krankheit gestorben. Aus der Zahl der angefertigten Särge schließt McDowall jedoch, dass die Zahl der Toten eher bei 550 lag: mehr als 5% der Stadtbevölkerung.
Die Auswirkungen der Epidemie, unter der Dumfries gelitten hatte, waren nicht ungewöhnlich. Neu war jedoch die genaue Erfassung der Fallzahlen. In ganz Europa veröffentlichte man Aufzeichnungen über die Choleraopfer als Teil dessen, was der Philosoph Ian Hacking als eine »Lawine gedruckter Zahlen« bezeichnete, die die 1820er- bis 1840er-Jahre gekennzeichnet habe. Von der Volkszählung bis hin zu Daten über Verbrechen, Schulwesen, Wahnsinn und Krankheit wurden statistische Informationen in jener Zeit weithin genutzt und interpretiert.
Die gewaltigen bürokratischen Apparate, die die Erhebung dieser Daten möglich machten, waren zentral für die Herausbildung des »Normalen«. Der »Durchschnittsmensch« basierte auf einer Kombination aus statistischen Analysen und riesigen Mengen an Bevölkerungsdaten. Während die unterschiedlichen Methoden zur Datenerhebung in den einzelnen Ländern weiterhin für Diskussionen sorgen – wie zuletzt in der Frühphase der Coronapandemie 2020 –, wird die Tatsache, dass die Zahlen grundsätzlich wichtig sind, von niemandem mehr bestritten. Und das war vor dem 19. Jahrhundert schlichtweg nicht der Fall.
Natürlich war Quetelet in diesem Zeitalter der Statistik nicht der Einzige, der dem Durchschnittlichen oder Gewöhnlichen Bedeutung zumaß. In den 1820er-Jahren strömte das Pariser Publikum in die Vorlesungen des französischen Mediziners François Joseph Victor Broussais, in denen er die Unterschiede zwischen einem normalen Gesundheitszustand und Krankheit beschrieb. Es gebe keine eigentlichen Krankheiten, erklärte der flammende Revolutionär und Liberale seinen Zuhörern, jede Erkrankung sei auf ein Übermaß oder einen Mangel an Reizung der entsprechenden Gewebe zurückzuführen.
Vielleicht sind Sie in den sozialen Netzwerken auch schon einmal über Memes gestolpert, in denen die Gründe aufgelistet werden, die zu einer Einweisung in viktorianische Irrenanstalten führen konnten:
Trotzdem führen sie uns vor Augen, dass ungewöhnliches Verhalten stets vor dem Hintergrund der sozialen Codes einer bestimmten Zeit interpretiert wird. Lernen – und insbesondere die Lektüre medizinischer oder alter Texte – galt bei Frauen als ein besonders gefährliches Verhalten, was mich
Im Spektrum von Exzentrik und Wahnsinn, Gesundheit und Krankheit richtete sich das Augenmerk nicht nur auf Einzelpersonen. Etwa um die gleiche Zeit setzte ein düstereres Kapitel in der Geschichte des Normalen ein, und die Vorstellung davon, wer normal war – und welche Verhaltensweisen und Überzeugungen akzeptiert wurden –, wurde auf ganze Gruppen und Gemeinschaften ausgedehnt. Die Geschichte des Normalen ist auch eine Geschichte von Ausgrenzung, und in ihrem Streben nach einer »Konsolidierung und Präzisierung soziologischer Gesetze«, um die moralischen und intellektuellen Funktionsweisen der Menschheit erst zu verstehen und später zu kontrollieren, orientierten sich Wissenschaftler häufig an Klassenzugehörigkeit, Ethnie, Geschlecht und Religion.

Die Grenzen des Normalen
Am 20. Dezember 1899 stieß der Schriftsteller William Corner in der Times zu seiner großen Freude auf eine Anzeige, in der Freiwillige für den Kriegsdienst in Südafrika gesucht wurden. Obwohl er eigentlich schon zu alt war, und zwar »mehr Jahre, als ich zuzugeben geneigt bin, jenseits der Schwelle, die das Kriegsministerium als zulässig oder mit Effizienz vereinbar festgelegt hat«, meldete er sich unverzüglich.
Nach ein paar kleineren bürokratischen Hürden – darunter die Schließung eines Meldebüros, dessen Mobiliar nicht eingetroffen war – wurde er schließlich zum Gespräch zugelassen. Es folgten eine medizinische Untersuchung sowie eine Schieß- und eine Reitprüfung. »Ein paar gute Männer blieben dabei auf der Strecke«, bemerkt Corner, der spätere Gefreite Nr. 6243, in seiner Geschichte der 34. Kompanie (Middlesex) der Imperial Yeomanry. Das »war schade, denn weder Ärzte noch Feldwebel auf dem Schießstand oder Reitlehrer sind unfehlbar, und es gibt so viele Fertigkeiten in Bezug auf Tauglichkeit oder Untauglichkeit im aktiven Dienst, die dies ausgleichen könnten«. Es wurde, schloss er, »einem willigen Mann so schwer gemacht, seinem Land zu dienen«.
William Corners medizinische Untersuchung umfasste zweifellos die Messung seiner Größe und seines Brustumfangs. In Kriegszeiten wurden die üblichen militärischen Anforderungen an die Rekruten gesenkt, weil mehr von ihnen benötigt wurden – das war vermutlich auch bei Corners Alter der Fall. 1861 verlangte man von angehenden Soldaten eine Mindestgröße von 1,72 Meter, 1900 war es nur noch 1,60 Meter. Und trotzdem erreichten nicht alle dieses Mindestmaß, wie Corner notierte.
Einige Kommentatoren sahen darin den Beweis, dass das Leben in den Industriestädten zu einer Degeneration der Körper von Männern der Arbeiterklasse geführt habe. Der Polemiker Arnold White berichtete, zwischen Oktober 1899 und Juli 1900 hätten in Manchester 11.000 Männer versucht, sich zum Dienst im Burenkrieg zu melden. Ganze 8.000 seien von vornherein abgelehnt worden, und von den restlichen 3.000 erfüllten weniger als die Hälfte »die bescheidenen Anforderungen der Militärbehörden an Muskelkraft und Brustumfang«. Beispiele wie dieses belegten angeblich den »charakteristischen physischen Typus des Stadtbewohners: kleinwüchsig, schmalbrüstig, schnell erschöpft«.
Whites Zahlen – für die er keine Quellen nannte – wurden später infrage gestellt, und nicht einmal alle damaligen Leser akzeptierten sie unwidersprochen. Er war in politischen Kreisen als Unruhestifter bekannt, und in seinem Buch Efficiency and Empire breitet er seine antisemitischen und eugenischen Ansichten unangenehm detailliert aus. Dennoch führten Sorgen über den Körperbau der britischen Männer während der Rekrutierungsphase für den Burenkrieg zu Fragen im Parlament und veranlassten eine Untersuchung durch die Regierung.
Die Gefahr körperlicher Degeneration, insbesondere der ärmeren Bevölkerungsschichten, schürte eine moralische Panik, die schon mehrere Jahrzehnte zuvor eingesetzt hatte, was zeigt, wie Veränderungen in Körpergröße und Statur seit der Mitte des 19. Jahrhunderts benutzt wurden, um weitreichendere Befürchtungen um den Zustand der Gesellschaft zu veranschaulichen oder zu begründen.
In den Arbeiten des viktorianischen Universalgelehrten Francis Galton trafen die wissenschaftliche Beschäftigung mit körperlicher Degeneration und die Wissenschaft des Normalen aufeinander. Galton – Charles Darwins jüngerer Cousin – gehörte zu den Ersten, die die Fehlerkurve als »Normalverteilung« bezeichneten (1877), und das war nur einer seiner vielen Beiträge zur Wissenschaft.
Er entwickelte und verbreitete einflussreiche Theorien zur Statistik, begründete psychometrische Testverfahren und lieferte Beiträge zur Fingerabdruckanalyse. Außerdem prägte er den Begriff Eugenik.
Galtons selbst ernannte »Rassenkunde« sollte den Bevölkerungsbestand des Landes verbessern, indem die »Tauglichen« (er selbst und seine wohlhabenden Freunde) dazu ermutigt wurden, mehr Kinder in die Welt zu setzen, während die »Untauglichen« (die Arbeiterklasse, People of Color und jeder, der willkürlich festgelegten körperlichen oder geistigen Maßstäben nicht entsprach) weniger Kinder haben, manche vielleicht sogar ganz davon abgehalten werden sollten, sich fortzupflanzen.
Mit solchen Überlegungen stand er nicht allein da: Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert hielt die Eugenik Einzug in weite Teile der westlichen Wissenschaft und Medizin. Und bis mindestens 1950 – als dieser Name endlich geändert wurde – beherbergte das hoch angesehene University College London (UCL) ein Galton-Labor für National-Eugenik.
Galtons Interesse an Statistik, Normalität, Identität und Vererbung war eng mit seinen Überlegungen zur Eugenik und seinem Engagement auf diesem Feld verbunden. Dieser Punkt wird häufig übersehen.
Galton war so fest davon überzeugt, dass Herkunft und Genie zusammenhingen, dass er behauptete, eine Normalverteilung von »Begabungen« aus seiner eigenen Forschung zeige exakt das gleiche Ergebnis wie eine Verteilung der sozialen Klassen anhand der Zahlen des Industriellen und Sozialreformers Charles Booth. Wenn aber Klasse und Begabung deckungsgleich seien, sagte er (eine haarsträubend lächerliche Behauptung), dann sei die Klassenstruktur der viktorianischen Gesellschaft sowohl naturgegeben als auch, Sie ahnen es, normal.
Galtons Schüler Karl Pearson, der in seiner Jugend noch sozialistische und feministische Positionen vertreten hatte, stimmte ihm dahingehend zu, dass »sehr arme Menschen, die von gelegentlichen Einkünften leben«, auch diejenigen mit den geringsten Begabungen und »im Sinne des bürgerlichen Wertes … unerwünscht« seien. Wieder einmal führten »normale« Standards dazu, dass ganz beiläufig festgestellt wurde, wer ein wertvoller Mensch war und wer nicht. Basierend auf rein zufälligen äußeren Umständen.
Kinder und ihre fürchterliche Neigung, mit zunehmendem Alter zu wachsen, stellten für Statistiker lange ein Problem dar
Aber was war für Francis Galton und seine Anhänger überhaupt normal? Man darf nicht vergessen, dass Galton bereits eine recht genaue Vorstellung des Normalen hatte, bevor er damit begann, es in einer Glockenkurve abzubilden. Eine Tendenz, die wir immer wieder beobachten können: Galton und seine Kollegen entfernten aus ihren Zahlen Datensätze, die sie für ungeeignet hielten, bevor sie sich daranmachten, die Normen zu berechnen. Kinder und ihre fürchterliche Neigung, mit zunehmendem Alter zu wachsen, stellten für Statistiker lange ein Problem dar. Aber auch Frauen. Galton passte die Daten von Frauen, die er gesammelt hatte, so an, dass sie mit denen der Männer unmittelbar vergleichbar waren – die Größe von Frauen musste beispielsweise mithilfe einer von ihm entwickelten Gleichung hochgerechnet werden, damit die Ergebnisse weiterhin einer Glockenkurve entsprachen.
Diese Umrechnung war nicht nur ein statistisches Hilfsmittel, um Vergleichbarkeit zu erzielen. Sie führte auch dazu, dass ein bestimmter Standard gesetzt wurde: Männer waren die biologische Norm, an die weibliche Daten angepasst werden mussten. Und natürlich waren weiße Männer die Norm, mit der Angehörige anderer Ethnien verglichen wurden. In der spätviktorianischen Zeit wurde der weiße Mittelschichtakademiker zum neuen Durchschnittsmenschen. Er – denn der normale Standard blieb auch weiterhin männlich – war Arzt, Wissenschaftler, Schriftsteller, Bankier, Kaufmann, Anwalt oder Geschäftsmann. Statistisch betrachtet war er nicht unbedingt der am weitesten verbreitete Typus, dennoch galt er als das gesunde Ideal, an dem alle anderen gemessen wurden.
Umgekehrt galt das »Scheitern« der Angehörigen gewisser sozialer Klassen oder ethnischer Gruppen, die ideale Größe, das ideale Gewicht, den idealen Brustumfang des Mittelschichtakademikers zu erreichen, als ein gesellschaftliches Problem. Viele Viktorianer glaubten, ein unterdurchschnittliches Wachstum sei keine Folge von Umgebung und Lebensumständen, sondern beruhe auf biologischer Vererbung und moralischem Versagen. Daher mussten gewisse Leute, der eugenischen Logik folgend, daran gehindert werden, Kinder zu bekommen.
Während in Großbritannien nie amtliche Heiratsgenehmigungen eingeführt wurden – obwohl zahlreiche Ärzte, Wissenschaftler, Politiker und sonstige Kommentatoren dafür plädierten –, traten in den Vereinigten Staaten und Europa in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zunehmend gesetzliche Regelungen zu Heiratsbeschränkungen und Sterilisationen in Kraft. Das weltweit erste Gesetz zur Zwangssterilisation wurde 1907 in Indiana erlassen, um Menschen, die als körperlich oder geistig »ungeeignet« galten, davon abzuhalten, eigene Kinder zu bekommen.
Diese Besessenheit von körperlichem Verfall war untrennbar mit Diskriminierung und Ängsten in Bezug auf race und Klasse verbunden. Wissenschaftler verglichen »degenerierte« weiße Engländer mit sogenannten »primitiven Rassen«.
Während Galtons Theorien zur Eugenik glücklicherweise inzwischen verworfen wurden – wenn auch erst viel später, als man erwarten würde –, gilt in weiten Teilen von Wissenschaft und Medizin, ebenso wie in den Tabellen und Maßen, mit denen wir heute noch arbeiten, weiterhin die präskriptive hierarchische Vorstellung einer weißen, männlichen, cisgender Norm. Sie hat Vorurteile und Stereotype befördert, die uns im Internet und in unseren Social-Media-Feeds nach wie vor ständig begegnen. Und einige der Standards, die wir unhinterfragt akzeptieren, gründen auf stark verzerrten Studien des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Welches Gewicht oder welcher Blutdruck als gesund gelten, wurde beispielsweise in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts anhand der Daten amerikanischer Versicherungsunternehmen ermittelt, deren Policen hauptsächlich von wohlhabenden weißen Amerikanern abgeschlossen wurden. Erst in jüngster Zeit hat man erkannt, dass die gesundheitlichen Auswirkungen des BMI je nach Körpertyp unterschiedlich sind: Ein BMI, der für weiße Europäer als »normal« gilt, kann für Menschen mit asiatischer Herkunft ein erhöhtes Risiko für Diabetes und Herzerkrankungen bedeuten, während schwarze Frauen auch bei höheren Werten ein geringeres Risiko für Herzprobleme aufweisen.
Die Galton-Sammlung ist heute in einem unscheinbaren Schrank verstaut, wie man ihn beispielsweise für Büromaterial verwendet. Der Großteil von Galtons schriftlichem Nachlass und seinen Fotografien befindet sich in den Spezialsammlungen der Bibliothek des UCL, in diesem Schrank liegen die Überbleibsel, die in kein Archiv passen – der Inhalt von Galtons Schreibtisch zum Zeitpunkt seines Todes, Gerätschaften, die mit seinen wichtigsten Entdeckungen verbunden sind, und eine willkürliche Ansammlung persönlicher Gegenstände.
Andere, düsterere Objekte kamen später hinzu, und sie erzählen vom verheerenden Erbe der Eugenik. Auf einer länglichen Blechbüchse klebt ein unscheinbares Etikett mit der Aufschrift »Haarfarbentafel von Prof. Dr. Eugen Fischer«. Darin befinden sich 30 unterschiedliche Kunsthaarsträhnen, jeweils akkurat mit einer Nummer versehen. Der deutsche Wissenschaftler Fischer benutzte diese Haarfarbentafel 1908 in Namibia, um den »Grad der Weißheit« der mixed-race Bevölkerung unter der kolonialen Herrschaft zu bestimmen. In seiner Studie vertrat er einen dezidiert eugenischen Ansatz. Er riet zu einem Verbot gemischter Ehen und unterstützte den Genozid an den Herero und Nama im damaligen Deutsch-Südwestafrika.
Als Reaktion auf Fischers Empfehlungen wurde 1912 die Heirat zwischen Angehörigen unterschiedlicher »Rassen« in allen deutschen Kolonien verboten. Seine Förderung der Eugenik war eine der Inspirationsquellen für Adolf Hitlers Mein Kampf, und seine Arbeiten dienten als wissenschaftliche Grundlage für die antisemitischen Nürnberger Gesetze, die letztlich in den Holocaust mündeten. 1940 trat der Wissenschaftler offiziell in die NSDAP
Das Labor für National-Eugenik des UCL blieb auch nach dem Zweiten Weltkrieg bestehen. Genau wie die eugenischen Sterilisationsprogramme in Teilen Europas und Nordamerikas, mit denen verhindert werden sollte, dass als »abnorm« beurteilte Gruppen Kinder in die Welt setzten. In der Tschechoslowakei, um nur ein Beispiel zu nennen, begann die Zwangssterilisierung von Romnja erst 1971, der letzte bekannte Fall stammt aus dem Jahr 2007.
Der viktorianische Universalgelehrte Francis Galton und der nationalsozialistische Wissenschaftler Eugen Fischer mögen sehr unterschiedliche Menschen gewesen sein, die in sehr unterschiedlichen Kontexten arbeiteten. Aber ihre Geschichten und ihr Vermächtnis zeigen, wie gefährlich das Konzept des »Normalen« sein kann – und welche Macht damit verbunden ist. Sowohl Galton als auch Fischer nutzten ihr Interesse an der Klassifizierung von Körper und Geist, um darüber zu entscheiden, wer normal war. Sie marginalisierten diejenigen, die diesen Kriterien nicht entsprachen, (und Schlimmeres) und zeigten finstere Wege auf, wie die Menschheit bewusst verändert werden könnte, um einem weißen, elitären Ideal zu entsprechen: ein erschreckendes Kapitel in der Geschichte des sogenannten Normalen.

Bin ich normal?
Als ich 1997 die Schule verließ, verspürte ich eine immense Erleichterung. Endlich kam ich weg von den Kleinstadt-Mobbern und stumpfsinnigen Konformisten meiner Jugend. Ich zog nach London, um dort zu studieren, eine magische Stadt, wo die Menschen in meiner Vorstellung tun und lassen konnten, was sie wollten, ohne dass irgendjemand auch nur mit der Wimper zuckte. Als ehrfürchtiger Teenager war ich beeindruckt von der Vielfalt, die mich umgab. Und als weiße heterosexuelle Frau war ich vermutlich zu einem großen Teil blind für den Rassismus, die Homophobie, die Behindertenfeindlichkeit und die Transphobie, die mich umgaben.
Manchmal habe ich wahrscheinlich sogar unbewusst selbst dazu beigetragen. Ich hatte noch keine Ahnung vom Erbe des Kolonialismus oder der Eugenik, und mir war nicht klar, wie rassistische Normen nach wie vor die Strukturen unserer Gesellschaft bestimmen. Meine Vorstellung von Normalität war individuell, naiv und egozentrisch. Ich weigerte mich sogar, mich als Feministin zu bezeichnen.
London, so dachte ich damals, war ein Ort, an dem jeder sein konnte, was und wer er wollte; eine Stadt der Vielfalt und doch gehüllt in den beruhigenden Mantel der Anonymität. Für jeden war etwas dabei, und die unaufhörlich strömenden Menschenmassen boten Sicherheit. Ich liebe London noch immer, und es fühlt sich für mich auch noch immer auf eine Weise nach zu Hause an, wie ich es in der kleinen Stadt in Kent, in der ich aufgewachsen bin, nie erlebt habe. Aber meine romantischen Erwartungen wurden jäh zerstört, als ich in einen Hochhausblock in South Woodford zog. »Praktisch Essex!«, da waren meine Kommilitonen und ich uns einig. Ich lebte auf einer Etage mit zwölf anderen 18-, 19-jährigen Mädchen.
Aus irgendeinem Grund hatte ich gedacht, sie würden mich freundlicher aufnehmen als meine früheren Mitschüler. Aber das taten sie nicht. Sie tratschten und kicherten und machten abfällige Bemerkungen – manchmal in meiner Gegenwart, manchmal hinter den zerschrammten alten Türen und dünnen Wänden des Wohnheims. Selbst diejenigen, die nicht zur Clique gehörten, verstummten mitten im Gespräch und sahen mich vorwurfsvoll an. »Du bist so still!«, war ihr üblicher Spruch. Es fühlte sich an wie eine grausame Zurechtweisung, ein Zeichen, dass ich nicht so war wie sie. Ich habe mich nie getraut auszusprechen, was ich wirklich antworten wollte: »Na und?«
Das Alberne an der Sache war, dass ich genau wusste, dass einige dieser Mädchen, die eine Menge Make-up trugen und oberflächlichen Klatsch liebten, sich ebenso viele Gedanken darum machten, ob sie wohl dazugehörten, wie ich. Nachdem meine Nachbarin aus dem Nebenzimmer tagsüber mit den anderen gekichert und gelästert hatte, weinte sie sich abends bei ihrem Freund aus. »Es ist so furchtbar hier!«, konnte ich sie durch die Wand schluchzen hören. Nach nur einem Semester brach sie das Studium ab. Am Ende des Jahres erkannte ich, dass überraschend viele meiner Mitstudierenden diese Gruppe, die ich für so beliebt gehalten hatte, gar nicht mochten. Vielleicht entsprachen sie ja doch nicht dem Ideal?
Doch obwohl ich all das wusste, änderte es nichts an meinen Ängsten. Der Wunsch, normal zu sein, war stärker als die Erkenntnis, dass meine Peinigerinnen die gleichen Sorgen und Ängste kannten wie ich und dass diejenigen, die ich für »normal« hielt, nicht besonders beliebt waren. Sogar nachdem ich stark genug geworden war, um mich gegen sie abzugrenzen, blieb der Drang bestehen, mich selbst zu »korrigieren«.
Unsere Vorstellungen von Normalität liegen irgendwo zwischen dem Wunsch nach Individualität und unserem Bedürfnis, als Teil einer Gruppe akzeptiert zu werden. Dazuzugehören kann wertvoll sein, auch wenn es vielleicht nicht immer möglich ist und manchmal sogar unserer geistigen und körperlichen Gesundheit schadet. Offenbar reicht nicht einmal ein aufkeimendes Bewusstsein dafür, dass die Normen unserer Kindheit und Jugend gar nicht so allgemeingültig sind, wie wir immer dachten, um unseren Glauben an das Normale zu erschüttern. Aber vielleicht vermag es ja ein Blick in dessen Geschichte.
Als schüchterne 18-Jährige hätte es mich sicher überrascht zu erfahren, dass die Menschen die Welt nicht immer in normal und unnormal eingeteilt haben. Im 17. Jahrhundert hat sich ein Fischer aus Cornwall vielleicht mit anderen örtlichen Fischern verglichen, mit seiner Familie oder mit den Nachbarn, aber ganz sicher hat er sich keine Gedanken darüber gemacht, ob er in irgendein übergreifendes System von Normen passt. Zu erfahren, dass die Menschen vor gerade einmal zwei Jahrhunderten das Wort »normal« noch nicht benutzten, um menschliche Eigenschaften oder Erfahrungen zu beschreiben, schränkt die Macht dieses Begriffs zumindest ein bisschen ein.
Redaktionelle Bearbeitung: Katharina Wiegmann
Mit Illustrationen von Claudia Wieczorek für Perspective Daily