Soziale Ängste: Was hilft, wenn jedes Gespräch zur Extremsituation wird
Menschen mit einer sozialen Phobie haben ständig Angst, sich seltsam zu verhalten. Was diese psychische Erkrankung ausmacht und welche neuen Wege Forschende finden, um Betroffenen zu helfen.
Gehe ich normal? Habe ich gerade etwas Komisches gesagt? Habe ich mein Geld an der Kasse eben schnell genug gefunden?
Mit Fragen wie diesen analysiert sich
Das ist so anstrengend für die 26-jährige Illustratorin, dass sie einem Gespräch irgendwann nicht mehr folgen kann. Dann vergisst sie Worte und verhaspelt sich, wird rot und hat Angst, überhaupt einen Ton zu sagen. Meistens hilft dann nur noch die Flucht aus der Situation. Auch für diesen Artikel schildert sie ihre Situation lieber schriftlich als im persönlichen Gespräch – das fällt ihr leichter.
Die Gefühle und Symptome, die Hanna erlebt, sind typisch für eine soziale Phobie, auch soziale Angststörung genannt. Sie gehört in Deutschland zu den häufigsten psychischen Erkrankungen.
Hannas Angst schränkt ihr Leben so stark ein, dass sie an manchen Tagen gar nicht erst das Haus verlässt. Obwohl die Erkrankung erhebliche Auswirkungen auf ihr Leben hat, reagierte ihr Umfeld früher häufig verständnislos: Sie sei »einfach nur schüchtern« und mache sich zu viele Gedanken. Doch eine soziale Phobie ist mehr als das.
Was es mit der Erkrankung auf sich hat und was Betroffenen wirklich hilft, erfährst du in diesem Text.
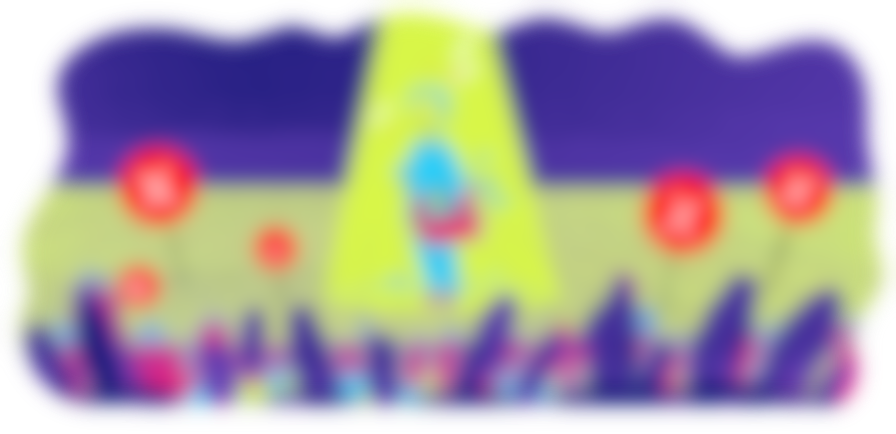
Die Symptome: Von Schwitzen über Zittern bis zur Panik
Die soziale Phobie gehört zu den häufigsten
In diesen sozialen Situationen malen sich Betroffene die Gedanken ihres Umfelds aus: »Warum braucht der so lange, um sein Kleingeld rauszuholen?«, »Was hat die eigentlich für komische Sachen an?« oder »Wieso trinkt der sein Getränk so seltsam?«.
»Diese Gedanken haben sehr viel mit der Selbstsicherheit der Betroffenen zu tun«, erklärt Peter Zwanzger. Der Psychiater und Psychotherapeut ist Vorsitzender der Gesellschaft für Angstforschung und leitet den Forschungsbereich »Angst« an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).
Sobald sich das Gedankenkarussell dreht, reagiert auch der Körper. Die Betroffenen fangen an zu zittern oder zu schwitzen, werden rot oder haben Herzrasen. Im Ernstfall kann sich daraus eine Panikattacke entwickeln. Die einzige Lösung ist dann oftmals, die Situation fluchtartig zu verlassen.
Die Konsequenz: Sozialer Rückzug
»Um den befürchteten Angstsymptomen nicht noch mal ausgesetzt zu sein, entscheiden sich die Betroffenen oft für das sogenannte Vermeidungsverhalten«, sagt Psychotherapeut Zwanzger. Dies sei für alle
Das hilft zunächst, kann irgendwann jedoch zum sozialen Rückzug führen. »Erkrankte, die sämtliche sozialen Interaktionen vermeiden, trainieren sie auch nicht mehr«, sagt Zwanzger. Das mache das Ganze noch schlimmer.
Wie häufig sind soziale Phobien?
Der letzten offiziellen Erhebung zufolge hatten in Deutschland im Jahr 2014 rund 1,7 Millionen Menschen im Alter von 18–79 Jahren eine akute
Die Pandemiezeit war deshalb für Betroffene heikel: Soziale Kontakte zu meiden, war selten einfacher. In ersten Studienergebnissen zeigt sich, dass die letzten 3 Jahre nicht spurlos an Menschen vorbeigezogen sind, die soziale Ängste haben. Ein Team aus Forschenden hat beispielsweise in einer Metaanalyse verschiedene Studien aus den letzten Jahren zum Thema analysiert: Ihnen zufolge hatten Menschen mit sozialen Ängsten während der Pandemie
Auch Hanna hat diese Zeit als schwierig erlebt: »Während der Pandemie war es logischerweise einfacher, sozialen Begegnungen aus dem Weg zu gehen. Allerdings haben die Kontaktbeschränkungen auch dazu geführt, dass ich nicht in Übung geblieben bin.« Nach den Lockdowns sei es für sie schwieriger gewesen, diese Situationen wieder herauszufordern.
Was hilft?
Wenn die Angst vor anderen Menschen das Leben bestimmt, können Betroffene ihre Furcht allein kaum überwinden. Psychiater:innen und Psychotherapeut:innen können dann helfen. »Generell kann man sagen, dass die Beschwerden einer sozialen Phobie sehr gut behandelbar sind. Bei den meisten Patienten lässt sich ein vollständiger Rückgang der Symptome erreichen, in Einzelfällen kann das aber länger dauern«, so Zwanzger. Bei manchen ginge der Heilungsprozess schnell, bei anderen dauere es mehrere Monate. Rückfälle seien dafür sehr selten, wenn sich die Therapie an Leitlinien orientiere, erklärt der Psychotherapeut weiter.
Doch damit sich Betroffene professionelle Hilfe suchen können, müssen sie erst einmal erkennen, wo das Problem liegt. Auch deshalb sind verharmlosende Kommentare wie »Du bist doch nur schüchtern« ein Problem. Die vermeintlich ermutigenden Worte degradieren die psychische Erkrankung zu einem Persönlichkeitsmerkmal.
Schüchternheit ist keine soziale Phobie
Dabei unterscheiden Dauer und Stärke der Angstsymptome eine soziale Phobie maßgeblich von einer »normalen« Schüchternheit. Menschen, die schüchtern oder introvertiert sind, können trotzdem ihren Alltag bewältigen, Betroffene einer sozialen Phobie nicht. Ihre Angst schränkt sie oft so stark ein, dass ein normaler Alltag nicht mehr möglich ist. Und das über Wochen oder Monate.
Hannas soziale Phobie äußert sich immer phasenweise, bleibt 2 oder 3 Monate und flaut dann wieder ab. In dieser Zeit muss sie häufig abwägen, wie sie ihre Energie nutzt:
Halte ich die gefürchtete Situation einfach aus und flüchte im Notfall oder höre ich auf meine Bedürfnisse und bitte meine Mitmenschen um Verständnis, indem ich erkläre, warum das Alltägliche für mich gerade nicht möglich ist?
Die Diagnose einer sozialen Phobie ist wie bei anderen psychischen Erkrankungen dadurch erschwert, dass keine
Für eine Diagnose müssen potenziell Betroffene unter anderem ihr Angstlevel, aber auch ihr Vermeidungsverhalten in verschiedenen Situationen einschätzen.
Um diese Situationen geht es:
Für die Diagnose einer sozialen Phobie wird unter anderem die Liebowitz Social Anxiety Scale genutzt. Sie fragt ab, wie sehr Betroffene versuchen, die folgenden Situationen zu vermeiden und wie viel Angst sie vor den jeweiligen Szenarien haben (auf einer Skala von 0=keine bis 3=schwer):
- In der Öffentlichkeit telefonieren
- An einer Aktivität in einer kleinen Gruppe teilnehmen
- In der Öffentlichkeit essen
- Mit anderen etwas trinken
- Mit einem:r Vorgesetzten sprechen
- Vor einem Publikum schauspielern, etwas aufführen oder sprechen
- Auf eine Party gehen
- Arbeiten, während man beobachtet wird
- Schreiben, während man beobachtet wird
- Jemanden anrufen, den man nicht sehr gut kennt
- Ein persönliches Gespräch mit jemandem führen, den man nicht sehr gut kennt
- Fremde treffen
- In einer öffentlichen Toilette urinieren
- Einen Raum betreten, wenn andere bereits Platz genommen haben
- Sich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen
- In einer Besprechung das Wort ergreifen
- Eine Prüfung der eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kenntnisse ablegen
- Jemandem, den man nicht sehr gut kennt, seine Unzufriedenheit oder Ablehnung mitteilen
- Jemandem, den man nicht sehr gut kennt, direkt in die Augen schauen
- Einen vorbereiteten mündlichen Vortrag vor einer Gruppe halten
- Versuchen, jemanden mit dem Ziel einer romantischen/sexuellen Beziehung kennenzulernen
- Waren in einem Geschäft zurückgeben, um sein Geld zurückzuerhalten
- Eine Party veranstalten
- Einem aufdringlichen Verkäufer widerstehen
Je nachdem, was die Befragten antworten,
Vor ein paar Jahren hat Hanna wegen ihrer Depression eine Verhaltenstherapie angefangen. Ihre damalige Therapeutin diagnostizierte dann auch die soziale Phobie.

Was eine soziale Phobie begünstigt
Es gibt Risikofaktoren, die die Entstehung einer Angststörung wahrscheinlicher machen, auch wenn die genauen Ursachen noch nicht abschließend geklärt sind. Folgende Punkte können laut Angstforscher Zwanzger das Risiko zu erkranken erhöhen oder verringern:
- Genetische und hormonelle Faktoren: Beispielsweise zeigen Studien, dass
- Funktionsweise des Gehirns: Aktuell gehen Mediziner:innen davon aus, dass die Interaktion zwischen bestimmten Gehirnbereichen und Neurotransmittern durch ein komplexes Zusammenspiel aus genetischen Faktoren, der Neurobiologie und den Lebensereignissen des Menschen gestört werden kann und dieses eine soziale Phobie begünstigt.
- Psychologische Faktoren: Das sind die positiven und negativen Lebenserfahrungen eines Menschen. Nach Zwanzger können nicht nur konkrete Ereignisse oder Kindheitstraumata eine soziale Phobie begünstigen, sondern auch eine zu hohe Belastung im Alltag.
Wie wird eine soziale Phobie behandelt?
Haben Betroffene herausgefunden, dass sie eine soziale Phobie haben, gibt es verschiedene
- Psychotherapie: Vor allem die kognitive Verhaltenstherapie mit einer Kombination aus Gesprächen und praktischen Übungen hat sich als wirksam herausgestellt.
- Pharmakotherapie: Antidepressiva können Patient:innen helfen, die es aufgrund ihrer Angstsymptome noch nicht zur Verhaltenstherapie schaffen.
Können Apps helfen?
Neben der Psychotherapie gibt es mittlerweile eine weitere Option, die Betroffenen helfen kann:
Sie sind besonders dann hilfreich, wenn Patient:innen der regelmäßige Termin beim Therapeuten oder bei der Therapeutin schwerfällt oder sie noch Zeit überbrücken müssen, bis ein Platz zur Therapie frei wird.
Wichtig: Die Apps sollten im offiziellen DiGA-Verzeichnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte stehen, nur dann ist sicher, dass sie auch eine wissenschaftliche Grundlage haben und ausreichend geprüft wurden. Manche Apps sollen dabei auch ohne zusätzliche Psychotherapie funktionieren, andere nur in Kombination.
Diese Apps helfen bei einer sozialen Phobie:
Zum Zeitpunkt meiner Recherche führte das DiGA-Verzeichnis 2 Apps, die bei einer sozialen Phobie helfen können:
So sieht die App velibra bei der Anwendung aus:

Johanna Schüller erforscht und prüft solche Apps. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und testet aktuell eine neue Version der
Bisher gibt es diese App bereits zur Behandlung von Panikstörungen und Platzangst auf Rezept, die neue Version soll auch bei sozialen Phobien helfen. Gerade läuft eine Studie zur Wirksamkeit der Anwendung, die mit darüber entscheiden wird, ob die neue Mindable-Version auch Teil des DiGa-Verzeichnisses
So funktioniert Mindable:
Zunächst vermittelt die App Wissen über Verhaltensweisen, die sich Betroffene oft als Reaktion auf die Phobie aneignen – und die es unmöglich machen, die Phobie zu überwinden. Zum Beispiel:
- Sicherheitsverhalten: Das kann das Einüben von Sätzen sein oder das Tragen eines Schals, um das Rotwerden zu verstecken. »Dieses Sicherheitsverhalten verhindert, dass die Patient:innen ihre Befürchtungen überprüfen können. Es bestätigt ihnen vielmehr, dass Situationen nur wegen ihrer Vorbereitung gut gelaufen sind«, so Schüller.
- Selbstaufmerksamkeit: Betroffene kriegen in sozialen Situationen kaum mit, was um sie herum passiert. Sie achten nur auf sich selbst und wie sie sich verhalten. So merken sie zum Beispiel nicht, dass niemand sie permanent beobachtet.
In der App lernen Betroffene, was es mit den schädlichen Verhaltensweisen auf sich hat – dann üben sie, wie sie diese vermeiden können. Das wiederum hilft ihnen, neue positive Erfahrungen in sozialen Situationen zu sammeln. »Die App zeigt den Patient:innen, dass ihre Befürchtungen in sozialen Situationen nicht eintreten«, erklärt Schüller. Das läuft folgendermaßen ab:
- Die App stellt den Patient:innen verschiedene soziale Situationen zur Auswahl. Dann sollen sie eintippen, was sie befürchten und wie ihr normales Sicherheitsverhalten aussehen würde. Die App fragt sie außerdem, zu wie viel Prozent die Patient:innen erwarten, dass ihre Befürchtungen eintreten.
- Die Patient:innen planen ausgewählte Situationen in der App, üben sie dann aber in der Realität. Dabei sollen sie auf das Sicherheitsverhalten verzichten und sich stattdessen aktiv auf die Umgebung konzentrieren.
- Bei der abschließenden Auswertung in der App sollen die Nutzer:innen eintippen, wie die Leute wirklich reagiert haben und zu wie viel Prozent ihre Befürchtungen eingetreten sind. Ein:e Psychotherapeut:in kann dabei helfen, Schlussfolgerungen aus dem Erlebten zu ziehen.
Schüller weiß auch, in welchen Fällen Apps besonders hilfreich sein können – und wann sie an ihre Grenzen geraten. »Ob eine App wirkt, hängt unter anderem vom Schweregrad der sozialen Phobie ab und davon, ob die Nutzer:innen an weiteren Erkrankungen leiden«, sagt Schüller. Andere Faktoren, die eine Rolle spielten, seien die Ressourcen der Nutzer:innen, deren soziales Umfeld und die Motivation, mit der App zu üben.
Hanna wusste bisher nicht, dass Digitale Gesundheitsanwendungen eine Option sind: »Diese Möglichkeit wird von Therapeut:innen und Psychiater:innen wenig bis gar nicht kommuniziert«, sagt sie. Sie könne sich vorstellen, dass eine solche Anwendung den Therapieeinstieg leichter machen könnte. Ihren Therapieplatz würde sie derzeit aber nicht gegen eine App eintauschen wollen.
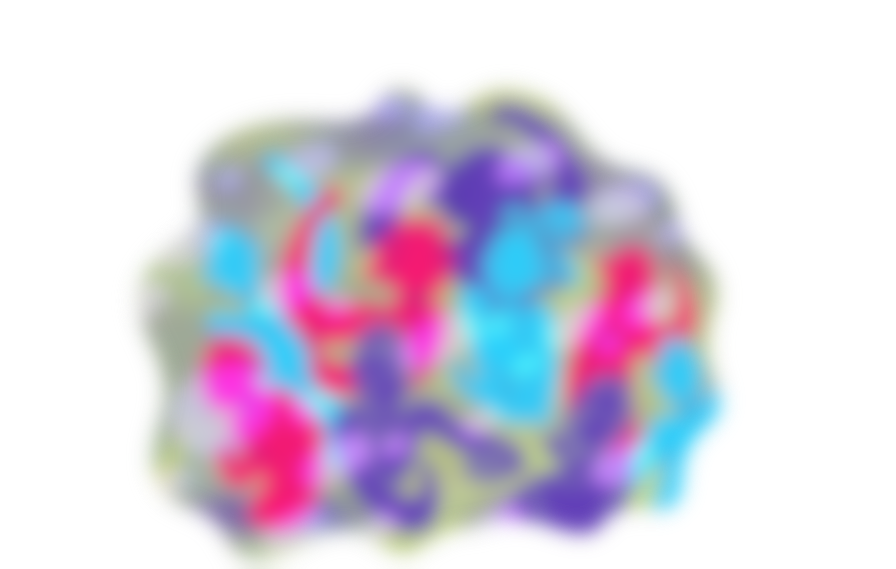
Hanna hat gelernt, sich ihren Ängsten zu stellen
In der Therapie übt Hanna unter anderem, mit der Angst umzugehen: »Ich überlege mir in Angstsituationen zum Beispiel eine Farbe und suche dann alle Objekte dieser Farbe in meiner Umgebung. Dann nehme ich eine neue Farbe.« Außerdem nimmt Hanna Antidepressiva – auch wegen ihrer Depression.
Zwischendurch trainiert sie soziale Interaktionen gezielt. Dafür geht sie auf Konzerte oder besucht Klubs: »Die Menschen um mich herum achten hier meistens auf die Band oder den DJ. Das sind zwar immer noch energieraubende Extremsituationen, aber wenn ich sie übe, fallen sie mir irgendwann leichter«, sagt sie. Seit dem Ende der Pandemiemaßnahmen ist dieses Training wieder möglich – und nötig.
Menschenmengen auf der Straße oder ein Spaziergang im Park sind für Hanna noch herausfordernder als ein Klub-Besuch. »Manchmal merke ich nach ein paar Metern, dass ich nicht mehr weiß, wie man läuft«, berichtet sie. Dann analysiert sie ihre Gangart und fühlt sich beobachtet und bewertet. »Irgendwann wird mein Körper ganz steif, ich fange an zu stolpern oder laufe viel schneller als sonst«, sagt sie.
Das können Bezugspersonen tun
Wegen ihrer Symptome haben Menschen, die an einer sozialen Phobie leiden, häufig Hemmungen, sich überhaupt ärztliche Hilfe zu suchen. Unter Umständen können sich Erkrankte nicht einmal gegenüber ihren engsten Bezugspersonen öffnen. Dabei können gerade diese eine große Hilfe sein. Doch was hilft, wenn jemand den Verdacht hat, eine nahestehende Person könnte eine soziale Phobie entwickelt haben – vielleicht auch infolge der Pandemiezeit?
Psychotherapeut Peter Zwanzger nennt 3 wichtige Punkte, woran sich Bezugspersonen orientieren können:
- Professionelle Hilfe vermitteln: Die therapeutische Behandlung einer sozialen Phobie ist immer das A und O. Bezugspersonen können Erkrankte dabei unterstützen, diese in Anspruch zu nehmen.
- Verständnis haben: Damit Erkrankte sich ernst genommen fühlen, hilft Verständnis. Aber auch Grenzen sind wichtig: Werden Betroffene über die Maße beschützt und von sozialen Interaktionen abgehalten, sorgt das eher dafür, dass sich die Symptome verschlechtern.
- Interesse zeigen: Bezugspersonen können Erkrankte am besten unterstützen, wenn sie sich mit der Krankheit auskennen und sie ernst nehmen.
Auch Hannas Umfeld hat gelernt, sie zu unterstützen: »Es hilft schon sehr, wenn Freund:innen und Familie meine Grenzen akzeptieren oder in sozialen Situationen ein Auge auf mich haben und meine potenzielle Not erkennen, aus der ich mich manchmal nicht selbst befreien kann«, sagt Hanna. Ihr Umfeld verstehe heute, dass ihr Stillsein nichts mit Desinteresse zu tun habe, sondern eine Reaktion auf ihre sozialen Ängste sei.
Und auch wenn Hanna weiterhin mit ihrer sozialen Phobie kämpft, kann sie ihrer Angst mittlerweile auch etwas Positives abgewinnen: »Meine Unsicherheit hilft mir dabei, den Zustand meiner Mitmenschen besser einzuschätzen und empathischer zu sein.« Etwas, was sie gern bewahren möchte – nur eben ohne Angstschweiß, Zittern und Panik.
Redaktionelle Bearbeitung: Lara Malberger
Mit Illustrationen von Frauke Berger für Perspective Daily

