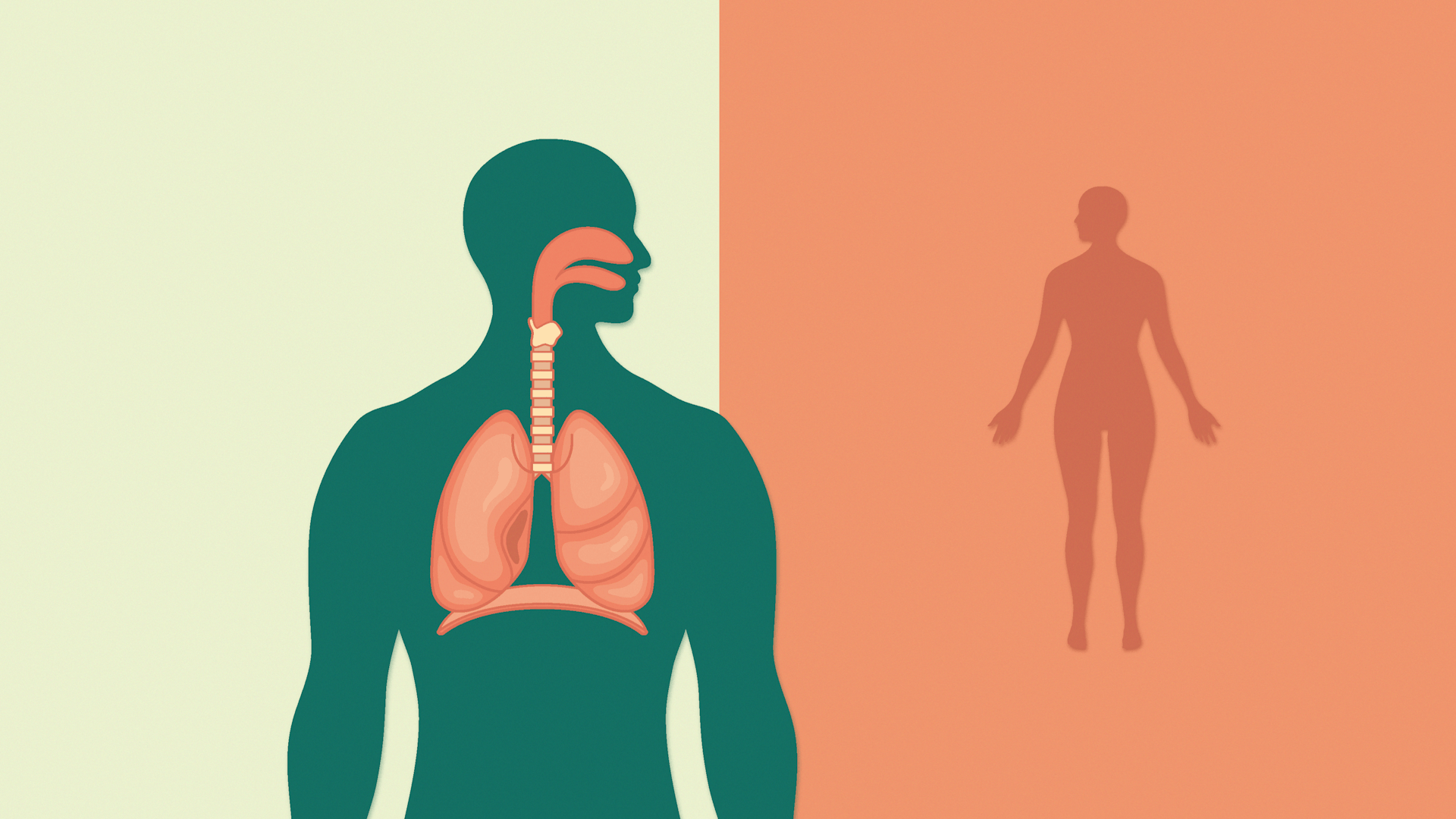Wenn Gleichbehandlung lebensgefährlich wird
Die Medizin ist auf Männer zugeschnitten. Dabei müssen Frauen beim Arzt anders behandelt werden. Wie sich der Unterschied zeigt und was sich ändern muss.
Schweißausbrüche, Bauchschmerzen und Übelkeit – bei diesen Symptomen denken viele Menschen zunächst an eine Lebensmittelvergiftung. Ein Fehler, denn bei Frauen können sie Anzeichen für einen Herzinfarkt sein. Dass nicht nur Betroffene, sondern auch Ärzt:innen weibliche Krankheitsbilder teilweise falsch deuten, kann Leben kosten – oder sie auf den Kopf stellen. Medizinische Fehler können arbeitsunfähig machen, ein Loch in die Finanzen reißen und ganze Familien zerstören.
Die Anwältin Michaela Bürgle kennt viele solcher Schicksale. Sie hat sich auf Arzthaftungsrecht spezialisiert, seit 20 Jahren vertritt sie Menschen vor Gericht, die nach einer ärztlichen Behandlung kränker waren als zuvor. 3–4-mal im Jahr sind Mandantinnen darunter, die aufgrund ihres Geschlechts falsch diagnostiziert wurden. »Auch Schlaganfälle werden bei Frauen häufig zu spät erkannt und stattdessen als Migräne gewertet«, weiß Bürgle.

Ihre Fälle sind schwierig. »Verschlechtert sich der gesundheitliche Zustand nach einer Behandlung, muss der oder die Patient:in beweisen, dass ein ärztlicher Fehler die kausale Ursache dafür war«, erklärt die Juristin. Lediglich bei groben Behandlungsfehlern, wie beispielsweise der Fehldiagnose eines Herzinfarkts, ist die Beweislast umgekehrt.
Die Fehldiagnosen haben eine gemeinsame Ursache
Das Leid von fehldiagnostizierten Patientinnen hat eine gemeinsame Ursache: die Gender-Data-Gap, auf Deutsch: Geschlechter-Datenlücke. Diese Lücke zwischen Theorie und Praxis entsteht, weil medizinische Studien seit den 60er-Jahren vor allem
Was tun bei Behandlungsfehlern?
Wer von einem Medizin- oder Behandlungsfehler betroffen ist, kann sich an Selbsthilfegruppen wenden. Die
Der Fokus auf Männer war unter anderem eine Reaktion auf den Contergan-Skandal. Das 1957 eingeführte Beruhigungsmittel mit dem Wirkstoff Thalidomid störte die Wachstumsentwicklung ungeborener Kinder.
In der Folge wurde zwar einerseits die Prüfung von Arzneimitteln in Studien verschärft – auf der anderen Seite wurden Frauen faktisch von klinischen Studien ausgeschlossen. Arzneimittelentwickler wollten selbst das theoretische Risiko einer unerkannten Schwangerschaft nicht eingehen, unter anderem aus Angst vor Schadensersatzklagen, sollte sich ein Medikament auf das ungeborene Kind auswirken.
Geschlechtssensible Medizin
Die geschlechtssensible Medizin berücksichtigt Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Dabei denkt sie das biologische (englisch: sex) und psychosoziale Geschlecht (englisch: gender) zusammen. Bislang fokussiert sich auch die geschlechtssensible Forschung vor allem auf die binäre Vorstellung von Mann und Frau. Wenn wir im Artikel von »Frauen« sprechen, beziehen wir uns deshalb vor allem auf das biologische Geschlecht. Um andere Geschlechtsidentitäten einzubeziehen, fehlt dringend noch Forschung. Das zu ändern ist ein weiteres Ziel von Befürworter:innen der geschlechtssensiblen Medizin.
Frauen sind für Pharma-Forschende aber auch aus einem weiteren Grund unattraktiv: Sie haben häufig einen Zyklus, der mit monatlichen hormonellen Unterschieden einhergeht. Dadurch ist die Wirkung von Medikamenten und Nebenwirkungen schwerer nachzuweisen.
Warum es ein Problem ist, wenn Frauen von Studien ausgeschlossen werden
Doch die Symptome, der Verlauf von Krankheiten und die Verstoffwechselung von Medikamenten sind genauso individuell wie Menschen selbst. Die Vernachlässigung von Frauen bei der Datenerhebung kann zu falschen Diagnosen und unerwünschten Nebenwirkungen führen. Erst seit Beginn des 21. Jahrhunderts spielen auch Frauen wieder eine größere Rolle in medizinischen Studien. Doch auch wenn es erste positive Entwicklungen gibt – die Versäumnisse der Vergangenheit zu beheben, braucht Zeit.
Weil lange so wenig an Frauen geforscht wurde, spielten weibliche Besonderheiten auch in der medizinischen Ausbildung häufig eine untergeordnete Rolle. Das Problem: Nur wer an der Universität geschlechtssensibel ausgebildet wird, kann später auch entsprechend behandeln und forschen – und sein Wissen an die nächste Mediziner:innen-Generation weitergeben.
Wie groß das Problem an Uni-Kliniken in Deutschland ist, hat eine
Dabei wurde deutlich: Obwohl das Thema für die meisten Befragten relevant ist, bestehen große strukturelle Defizite. Insbesondere fehlen Personen, die die Entwicklung eines Problembewusstseins vorantreiben. Ob geschlechtssensible Lernziele Teil des Lehrplans sind, steht den Unis auch heute noch frei. Die Lehrstühle entscheiden also selbst, ob und in welchem Maße gelehrt wird, dass Herzinfarkt-Symptome bei Frauen anders aussehen als bei Männern oder dass weibliche Patientinnen auf Schmerzmittel und Psychopharmaka intensiver reagieren und sogar Schmerz anders empfinden können.
Chirurgie und Kardiologie sind besonders betroffen
Laut der Studie werden speziell in der Lehre der medizinischen Männerdomänen Chirurgie, Kardiologie oder Notfallmedizin die Unterschiede zwischen Männer- und Frauenkörpern oftmals zu wenig beachtet. Einige der Befragten gaben an, dass in diesen Bereichen nach wie vor ein »feministischer Ideologieverdacht« gegen die geschlechtssensible Medizin herrsche.
Wer entscheidet über Veröffentlichungen? Männer!
Dass es besonders in der Lehre noch Defizite gibt, bestätigt auch die Medizinerin Bettina Pfleiderer, die aktuell an der Universität Münster lehrt. Seit 20 Jahren forscht sie zu den geschlechtlichen Unterschieden in der Medizin und gilt als Expertin auf dem Gebiet. Weltweit engagiert sich Pfleiderer in unterschiedlichen Verbänden und Netzwerken, die sie teilweise selbst aufgebaut hat. In den Jahren 2016–2019 war sie Präsidentin des Weltärztinnenbundes.

Laut Pfleiderer fand die geschlechtssensible Medizin lange Zeit nur wenig Anklang. »Die Forschung hat ein strukturelles Problem«, erklärt sie. Einerseits fehle es an Forschungsprojekten, andererseits an finanzieller Förderung – ein Teufelskreis. Um einen Wandel in der Medizin zu erreichen, müssten Studien zur geschlechtssensiblen Medizin in hochrangigen Journals mit großer Reichweite veröffentlicht werden, sagt Pfleiderer. Die Entscheidungsmacht darüber, welche Paper es in diese Journals schafften, liege bei den Editor:innen – und das seien im Laufe von Pfleiderers Karriere häufig Männer gewesen, die geschlechtssensible Medizin als neumodischen Feminismus abtäten. »Es wurde verkannt, dass es sich in Wahrheit um ein Qualitätsmerkmal handelt«, kritisiert die Medizinerin.
Doch langsam ändert sich diese Denkweise auch bei alteingesessenen Kritiker:innen: Insbesondere seit Beginn der Coronapandemie habe sich das Interesse am Thema noch einmal vergrößert, beobachtet Pfleiderer.
Als Männer zwischen 50 und 60 Jahren schwerer erkrankten als andere Teile der Bevölkerung, wurde unter anderem vom Robert Koch-Institut Wert auf eine Aufschlüsselung der Daten nach Geschlecht gelegt.
Dass sich das Bewusstsein für geschlechtsspezifische Unterschiede erst dann weiterentwickelt, wenn Männer unter einer Schlechterstellung leiden, hat einen bitteren Beigeschmack. Dennoch hofft Pfleiderer, dass die lang vernachlässigte Forschung zu Frauen von der Aufmerksamkeit profitiert. Ideen dazu, wie sich der Gender-Data-Gap in der Medizin überwinden lässt, gibt es nämlich genug – dabei zeigt auch ein Blick ins Ausland, wie es anders gehen kann.

Diese 5 Maßnahmen können helfen, die Gender-Gap in der Medizin zu schließen
1. Lehrende müssen die Unterschiede zwischen Geschlechtern beachten – ob sie wollen oder nicht
Laut Pfleiderer hat die Coronapandemie deutlich gemacht, dass auf dem Gebiet der geschlechtssensiblen Medizin mehr Expert:innen benötigt werden. Auch die Studie der Berliner Charité hat ergeben, dass es zu wenige Lehrpersonen mit entsprechenden Kenntnissen gibt. Teilweise zeigen die Ergebnisse der Studie auch positive Entwicklungen: Es gaben 92% der befragten Fachvertreter:innen an, dass sie Studierende mittlerweile über unterschiedliche Symptome eines Herzinfarktes bei Männern und Frauen aufklärten.
Eine regelmäßige Weiterbildung von Ärzt:innen und Professor:innen an medizinischen Fakultäten werde von den Forschenden deshalb dringend empfohlen – denn in welchem Maße geschlechtssensible Inhalte in die Ausbildung einflössen, könnten die Lehrenden oft selbst entscheiden. Dabei betont Pfleiderer, dass geschlechtssensible Lehrinhalte ihrer Meinung nach kein eigenes Studienfach bilden sollten: »Ich kämpfe dafür, dass eine geschlechtssensible Betrachtungsweise in jedes bereits bestehende Gebiet der Medizin einfließt.«
In diesem Bereich ist etwa Kanada Deutschland einen Schritt voraus: Hier werden Kurse und Materialien zur geschlechtssensiblen Medizin verpflichtend angeboten.
2. Medizinische Lehrmaterialien dürfen Frauen nicht länger ausblenden
Wichtig, um Wissenslücken zu schließen, seien nicht nur sensiblere Lehrpersonen, sondern auch passende Lehrmaterialien. Symptome, die nur oder vor allem von Frauen gezeigt würden, dürften darin nicht länger als »atypisch« bezeichnet werden – genau das sei nämlich aktuell der Fall. Dabei machten Frauen die Hälfte der Bevölkerung aus.
Außerdem müsse auch die bildliche Darstellung von Frauen in Lehrbüchern angepasst werden, fordert Bettina Pfleiderer. Denn auch hier finde eine Diskriminierung statt. Gemeinsam mit anderen Forschenden führte die Medizinerin 2022 eine
Das Ergebnis: 2/3 der Abbildungen in Lehrbüchern zeigen Männer, und dies insbesondere bei der Darstellung des Bewegungsapparats. Frauen werden dagegen vor allem dann abgebildet, wenn es um Fortpflanzungsorgane geht. »Häufig werden sie in passiven Posen oder von unten gezeigt«, bemerkt Pfleiderer. Diese Lehrmaterialien vermitteln Studierenden einen ersten Eindruck von Medizin – und verursachen so ganz unbewusst eine Voreingenommenheit: Beschwerden von Frauen, die mit ihrem biologischen oder soziokulturellen Geschlecht zu tun haben, werden weniger ernst genommen.
Onlineplattformen, die in der medizinischen Ausbildung zunehmend an Bedeutung gewinnen, wollen gegensteuern. Wie die Studie ergab, ist das Verhältnis hier umgekehrt: 2/3 der Abbildungen zeigen weibliche Körper – und zwar in allen möglichen Zusammenhängen. Dies könnte laut Autor:innen darin begründet sein, dass Onlineinhalte schneller überarbeitet werden könnten als gedruckte Lehrbücher.
Frauen in der Medizin: Aus den Augen, aus dem Sinn
Forschende analysierten fast 4.000 Abbildungen in medizinischen Lehrbüchern und Atlanten sowie auf E-Learning-Plattformen. Ihr Ergebnis: Frauendarstellungen kommen seltener vor als Abbildungen von Männern.
Neben der unterschiedlichen Darstellung beider Geschlechter stellten die Forschenden auch fest, dass
3. Geschlechtssensible Medizin muss zum Standard werden
Um geschlechtssensible Medizin auf Dauer zu verankern, brauche es langfristige Pläne, sagt Pfleiderer. Das Forschungsfeld dürfe dabei nicht von einzelnen »Leuchtturmfiguren« abhängen, mit deren Eintritt in den Ruhestand der Fortschritt stagniere. Ebenso wenig dürfe die aktuelle politische Lage über die Förderung geschlechtssensibler Medizin entscheiden. Mit dem im November 2021 geschlossenen Koalitionsvertrag hat die Ampel-Regierung zwar die
Auch konkrete Gesetze oder deren Entwürfe gibt es bislang nicht. In einem
4. Bessere Förderung für geschlechtssensible Forschungsprojekte
In anderen Ländern gibt es bereits deutlich konkretere Regeln als in Deutschland, die geschlechtssensible Forschungsprojekte fördern sollen.
In Italien wurde etwa schon 2018 ein
Auch die USA seien Deutschland laut Pfleiderer voraus: Dort müssten Forschende das Geschlecht in ihre Studien einbeziehen, um überhaupt Fördermittel beantragen zu können. »Für bereits abgeschlossene Studien wurden außerdem Fördermittel zur Verfügung gestellt, um nachträglich geschlechtssensible Aspekte des Forschungsthemas zu untersuchen«, sagt Pfleiderer.
Zwar sind auch Arzneimittel-Hersteller:innen in der EU mittlerweile
Datenbanken helfen, das Wissen zu verbreiten
Um die Wissenslücke in Deutschland zu schließen, hat Pfleiderer selbst vor 7 Jahren die
Das Problem: Die Finanzierung für Pfleiderers Projekt war nur auf ein Jahr ausgelegt. Bis heute führt sie die Website in Eigenregie weiter und übersetzt Paper ins Englische, um sie für Studierende und Mediziner:innen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Eine langfristige staatliche Förderung könnte diese Arbeit erleichtern.
5. Austausch und Vernetzung zwischen Universitäten
Neben dem Ausbau von Informationsplattformen sei laut Pfleiderer auch die bundesweite und internationale Vernetzung von Instituten und Universitäten wichtig. Gemeinsam mit anderen Lehrstuhlinhabenden habe sie im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen das
Auch Studierende wollen etwas ändern
Lösungsansätze gibt es nicht nur von fertig ausgebildeten Mediziner:innen. Sebastian Paschen und Moritz Roloff sind Medizinstudierende an der Universität Greifswald und Ärzte der nächsten Generation.
»Ich habe eine Pflegeausbildung gemacht, Basti ist gelernter Rettungssanitäter«, erzählt Roloff. Auf der Intensivstation habe er eine Frau gepflegt, die von ihrem Hausarzt mit einem nicht erkannten Herzinfarkt nach Hause geschickt worden war. Und ihm fiel auf: Das ist kein Einzelfall. »Die Diskrepanz zwischen Praxis und Lehre war erschreckend«, sagt Roloff. Die Studierenden bekamen das mulmige Gefühl, auf die Hälfte ihrer zukünftigen Patient:innen nicht richtig vorbereitet zu werden. Auch sie sind sich einig:
Wenn Frauen, und damit 50% der Weltbevölkerung, in unseren Lehrbüchern als atypisch bezeichnet werden, haben wir ein gedankliches und sprachliches Problem.
Gemeinsam mit einer Kommilitonin gründeten sie deshalb das studentische Projekt »Geschlecht in der Medizin«. Ihr Ziel: eine Ringvorlesung zu organisieren, die sich mit genau dieser Thematik auseinandersetzt. »Wir haben einfach alle Dozierenden an unserer Fakultät angeschrieben, die Wahlfächer anbieten«, erzählt Sebastian Paschen. Dabei seien sie auf einige offene Ohren gestoßen: »Viele haben gesagt, sie würden gerne etwas zu dem Thema machen oder hätten sogar schon etwas parat.« Andere Dozierende seien selbstständig auf sie zugekommen. Schnell kamen Vorträge für ein ganzes Semester zusammen. Da es der Projektgruppe gelang, ihre Vortragsreihe bei der Ärztekammer anzumelden, konnten auch bereits approbierte Ärzt:innen Weiterbildungspunkte für die Teilnahme erhalten.

Die Veranstaltungen waren besser besucht als manch andere Medizinvorlesung: »In jeder Sitzung hatten wir bis zu 120 Teilnehmende«, erzählen die Organisatoren stolz. Ihr langfristiges Ziel gleicht dem Pfleiderers: geschlechtssensible Lerninhalte verpflichtend in die Lehre aufzunehmen. Hierfür müsste der Nationale Kompetenzbasierte Lernzielkatalog Medizin, kurz NKLM, überarbeitet werden. Er entscheidet darüber, welche Themen für Medizinstudierende prüfungsrelevant sind.
Wie auch Pfleiderer wollen die Studierenden aus Greifswald ausdrücklich kein neues Studienfach zur geschlechtssensiblen Medizin im Lehrplan installieren. »Das würde das Studium nur noch mehr überladen. Wir wünschen uns, dass jedes einzelne Fach geschlechtsspezifische Aspekte mitdenkt und in seinen Bereich integriert«, stellt Sebastian Paschen klar.
Bis dieses Ziel erreicht ist, legen Paschen und Roloff ihren Fokus weiter auf die Vernetzung unter Studierenden. Ihre Idee trugen sie an die Bundesvertretung der Medizinstudierenden heran. Daraufhin wurde im Mai 2022 auch ein nationales Projekt zu »Geschlecht in der Medizin« ins Leben gerufen. In Heidelberg, Erlangen und Witten haben sich weitere Lokalgruppen gegründet, die sich für geschlechtssensible Lehre an ihren Universitäten einsetzen. Sebastian Paschen und Moritz Roloff stimmt das zuversichtlich. »In den nächsten 10 Jahren wird es einen Generationswechsel unter Chefärzt:innen und Professor:innen geben. Jetzt geht es darum, in den neuen Leuten, die diese Positionen besetzen werden, ein Bewusstsein für geschlechtssensible Medizin zu generieren«, sagt Roloff.
Redaktionelle Bearbeitung: Lara Malberger
Titelbild: Claudia Wieczorek | Depositphotos - copyright