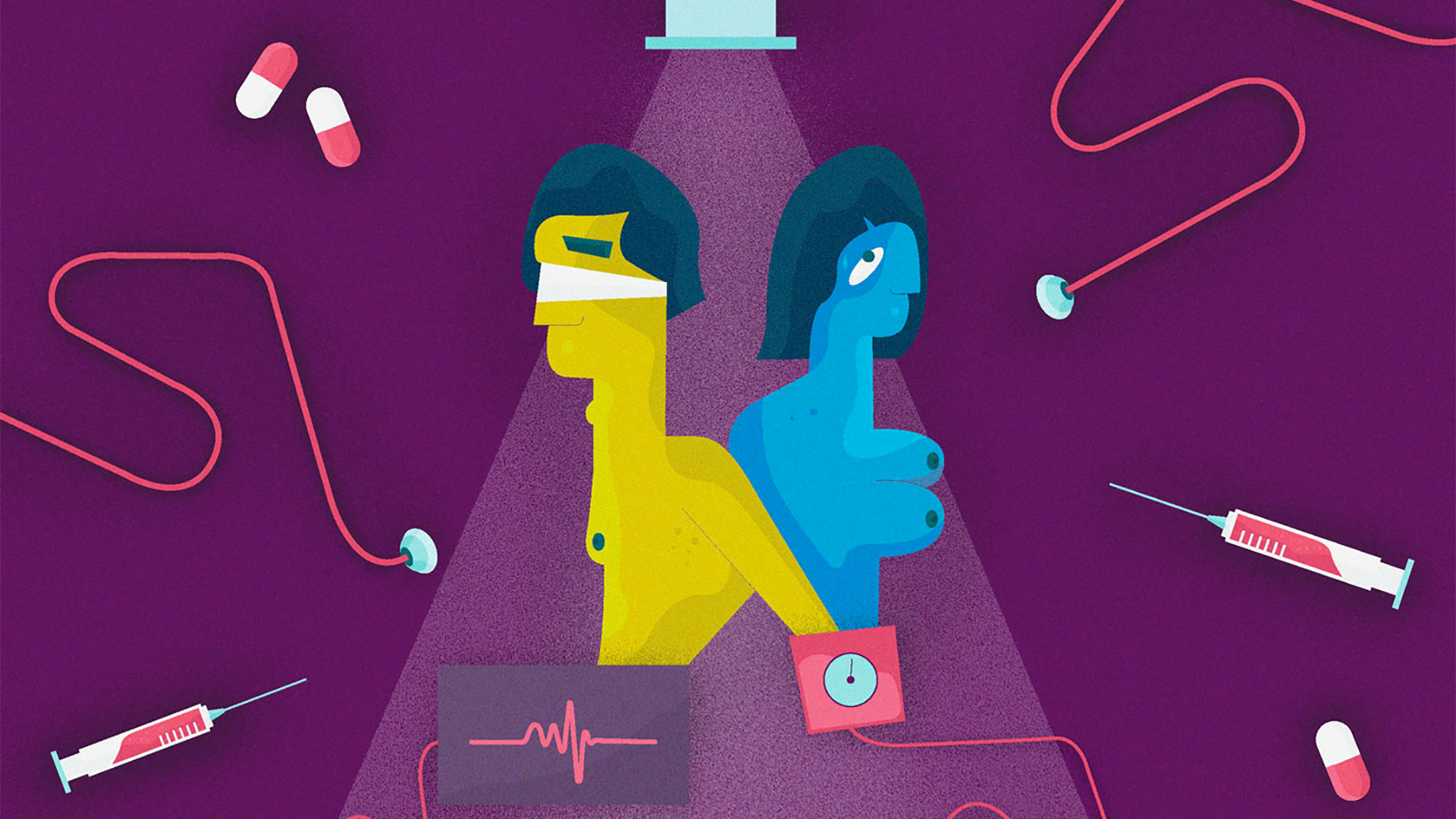Krebs bei jungen Menschen? Wie eine missverstandene Studie verunsichert
Die Zahl der Krebsfälle bei unter 50-jährigen Menschen ist laut einer viel zitierten neuen Studie seit 1990 um 80% gestiegen. Doch die Studie sagt etwas anderes. Worum es wirklich geht und wo viele Medien versagt haben.
Oftmals sind es kurze Momente des Alltags, die das ganze Leben verändern können. So wie bei Daniela, die eines Morgens unter der Dusche einen Knoten in ihrer Brust ertastet. Ein Zufallsfund: Zuvor hatte sie sich keine Gedanken darüber gemacht, dass sie sich regelmäßig abtasten sollte. Daniela bleibt ruhig. »Wird schon von allein wieder weggehen«, denkt sie sich.
Doch der Knoten verschwindet nicht. Schließlich will sie den Fund abklären lassen – bei der Gynäkologin, die sie regelmäßig besucht, aber die sie nie auf die einfache Maßnahme der Selbstuntersuchung hingewiesen hatte.
Mehrere Wochen Wartezeit. Als es endlich so weit ist, ergeben 2 verschiedene Untersuchungen unabhängig voneinander: Verdacht auf ein Fibroadenom, eine gutartige Neubildung im Brustgewebe, die bei vielen Frauen auftritt. Der Knoten hat klare Gewebegrenzen zum umliegenden Körpergewebe. Entwarnung, zunächst.
Allerdings verändert sich der Knoten innerhalb von 3 Monaten. Er wird größer, schmerzt. Sie lässt sich im nahe gelegenen Brustzentrum erneut untersuchen. Nun ist der Knoten nicht mehr abgegrenzt, eher blumenkohlartig. Danielas Diagnose wird neu formuliert: Es handle sich doch um Brustkrebs.

Jedes Jahr erhalten in Deutschland mehr als 11.000 Frauen im Alter von 15–49 Jahren Danielas Diagnose. Nach einer im vergangenen September erschienenen Studie, die im 2022 gegründeten medizinischen Fachjournal »BMJ Oncology« publiziert wurde, sind die Krebs-Fallzahlen in dieser Altersspanne global steigend.
Und zwar in alarmierendem Ausmaß: Im Vergleich zu 1990 sind 2019 um die 80% mehr Krebsfälle bei unter 50-Jährigen gezählt worden. Der Großteil entfällt auf Brustkrebs. Doch auch bei Luftröhren- und Prostatakrebs sind der Studie zufolge deutliche Zunahmen feststellbar.
All das klingt bedrohlich. Schließlich denkt man bei Krebs meist eher an alte, gebrechliche Menschen. Warum sind nun scheinbar vermehrt auch junge Menschen betroffen?
Hat vielleicht unser Lebensstil damit zu tun? Führt er dazu, dass sich die tückische Krankheit in den vergangenen Jahrzehnten auch in jüngeren Altersgruppen ausbreitet?
Steigende Krebszahlen – Statistik für Anfänger:innen
Auch wenn die neuen Zahlen zu Krebserkrankungen bei unter 50-Jährigen auf den ersten Blick alarmierend klingen, ist es wichtig, nach dem ersten Schreck genau hinzusehen. Wie kam es zum Anstieg von 80% in dieser Altersgruppe?
Der Analyse liegt die

Hansjörg Baurecht sieht die Zahlen mit anderen Augen. Der Statistiker forscht am Institut für Epidemiologie und Präventivmedizin der Universität Regensburg unter anderem zum Einfluss des Lebensstils auf Erkrankungen und sagt: »Die Studienautoren haben ihre Ergebnisse ein bisschen
Also der Reihe nach: Im Jahr 1990 wurden weltweit 1,28 Millionen Krebserkrankungen gezählt, bei einer Weltbevölkerung von 5,32 Milliarden Menschen.
Bei der um 80% gestiegenen Fallzahl ist also zu bedenken, dass auch die Anzahl der Menschen um 46% gewachsen ist. In der Studie wurden jedoch einfach absolute Zahlen miteinander verglichen, ohne sie in Relation zur gewachsenen Weltbevölkerung zu setzen.
Eine einfache Rechnung sorgt für Aufklärung: 1990 erhielten 34,2 von 100 Millionen Menschen die Diagnose, 2019 waren es 42 von 100 Millionen. Das entspricht einem Anstieg von 23%. Das alarmierend klingende Studienergebnis ist damit zu einem deutlichen Teil im Bevölkerungswachstum begründet.
Das bedeutet natürlich nicht, dass hier kein negativer Trend zu beobachten ist. Auch ein Anstieg von »nur« 23% ist durchaus ernst zu nehmen – wenngleich dieser weit weniger drastisch ist, als es die Studienautor:innen und viele Medien in ihren Schlagzeilen suggerieren.
Woran liegt es also wirklich, dass die Krebsfälle speziell in der Altersgruppe unter 50 Jahren zu steigen scheinen?
Nicht nur Alte erkranken an Krebs
In der Studie fällt auf, dass reichere Länder bei Menschen im Alter von 15–49 mehr neue Krebsdiagnosen verzeichnen als ärmere. Möglicherweise spielen hier die großen Fortschritte bei medizinischen Diagnosemethoden eine Rolle, die dazu beitragen, dass Krebsfälle früher erkannt werden als in der Vergangenheit – und dann auch besser behandelt werden können.
Aber nicht nur das hat sich seit 1990 verändert. »Es ist eine Überlagerung mehrerer Faktoren«, sagt Baurecht. Die weltweite Armut sei in diesem Zeitraum gesunken. Zugleich sei in weiten Teilen der Welt eine Angleichung an einen »westlichen Lebensstil« erfolgt, bei der die klassischen Risikofaktoren für Krebserkrankungen stärker zum Tragen kommen: weniger körperliche Aktivität, Tabakkonsum, Alkohol, mehr rotes Fleisch in der Ernährung und Übergewicht.
Wie viel von der 23%-igen Steigerung der Fallzahlen nun aber genau auf verbesserte Diagnosemethoden oder den westlichen Lebensstil zurückgehen, kann niemand genau sagen.
Junge Krebskranke in Deutschland
Also alles kein Grund zur Sorge? Leider nein. Denn unabhängig von der genauen Zunahme der Fallzahlen ist jede Krebsdiagnose eine traurige Nachricht – insbesondere für junge Menschen, die selten mit einer solchen rechnen.
Auch hier in Deutschland erkranken Jahr für Jahr über 42.000 Menschen zwischen 15 und 49 an Krebs. Aber haben die Zahlen hierzulande zugenommen? Das zu beantworten ist schwierig, denn die Datenlage zur Entwicklung der Fallzahlen seit 1990 ist lückenhaft.
Das Zentrum für Krebsregisterdaten im Robert Koch-Institut führt
Findet sich in den vorhandenen Daten ein als alarmierend einzustufender
In der Altersgruppe 15–49 Jahre zeigt sich in den Jahren 1999–2011 tatsächlich ein Anstieg der Fallzahlen. In den Folgejahren bis 2019 ist dann ein Abfall zu verzeichnen. Insgesamt sind die Fälle zwischen 1999 und 2019 schwach gestiegen.
Krebs unter 50: Das sagen die Zahlen
Das Diagramm zeigt die Inzidenz der Krebserkrankungen (Fälle auf 100.000 Einwohner:innen) in Deutschland in der Altersgruppe 15–49 pro Jahr.
Der Anteil an krebserkrankten Frauen überwiegt in dieser Altersgruppe: Bei 15–49-Jährigen ist Brustkrebs auch in Deutschland die häufigste Krebserkrankung, 11.000 Frauen erkranken jährlich. Das ist etwa 1/4 der 42.000 jungen Krebspatient:innen. Die meisten Fälle treten zwischen 40 und 49 Jahren auf, Tendenz leicht steigend.
Die Gründe für den leichten Anstieg? Schwer zu sagen, urteilt der Epidemiologe Baurecht. Seit 2005 habe die moderne Medizin technologisch große Fortschritte gemacht. »Bei Tumoren spielt die molekulare Diagnostik eine immer wichtigere Rolle.
Und wie schwer wiegt ein ungesunder Lebensstil rund um Risikofaktoren wie Alkohol, Rauchen, wenig Bewegung, schlechte Ernährung, Übergewicht? Umwelteinflüsse wie Luftverschmutzung und krebserregende Bestandteile in Kosmetika, Haushaltsreinigern und hochverarbeiteten Lebensmitteln?
Baurecht betont, dass Krebs immer eine multifaktorielle Krankheit darstellt, also nicht auf den einen Grund allein zurückzuführen ist. Was das heißt, erklärt er anhand eines Beispiels: Stellen wir uns vor, wir erhalten bei der Geburt einen genetischen Rucksack, und je nachdem, in welcher Umwelt wir uns befinden und wie wir leben, können verschiedene Inhalte des Rucksacks zum Tragen kommen oder nicht, sowohl mit positiven als auch negativen Auswirkungen.

Doch wie damit umgehen, wenn der Rucksack zu schwer geworden ist – und tatsächlich Krebs ausbricht?
Wie umgehen mit Krebs?
Daniela, die wir zu Beginn des Artikels kennengelernt haben, ist 33, als sie die Diagnose erhält: Triple-negativer Brustkrebs. Das ist eine von mehreren Arten Brustkrebs,
Diese Form von Brustkrebs tritt vermehrt in der Altersgruppe unter 40 auf, gilt als eher aggressiv und kann nicht mit herkömmlichen Antihormontherapien behandelt werden. »Die Frage nach meinen Überlebenschancen wurde komplett ignoriert«, erinnert sich Daniela an das Gespräch mit ihrer Ärztin.
Nach der Diagnose fährt sie allein mit dem Auto nach Hause, eine undefinierbare Leere in ihr. »Mir ist gar nichts durch den Kopf gegangen«, erinnert sie sich. Erst als sie ihre Mutter informiert, beginnt sie zu begreifen und überlegt, wen sie darüber hinaus noch einweihen sollte – aus Angst, ihre Mitmenschen mit ihrer Diagnose zu überfordern.

»Generell ist eine Krebsdiagnose ein tiefer Einschnitt in die Lebensbiografie«, sagt Claudia Reuthlinger, Psychoonkologin in der Krebsberatungsstelle Ingolstadt der Bayerischen Krebsgesellschaft, »aber unter 50-Jährige nimmt sie aus allen Lebensplänen heraus. Je jünger die Patient:innen, desto stärker.«
Neben körperlichen, sozialen und psychischen Auswirkungen gehe es vor allem um Fragen der weiteren Berufstätigkeit, Erwerbsfähigkeit und um finanzielle Einbußen. Häufig vergessen werde auch der bürokratische Aufwand, dem Betroffene gegenüberstehen, wie Reuthlinger betont.
Für junge Menschen wiegt die Diagnose doppelt schwer
Bei jungen Erwachsenen seien außerdem die Themen Partnerschaft und Fertilitätserhalt relevant. Davon erzählt auch Daniela. Sie erinnert sich an den Moment, als sie mit der Diagnose nach Hause kommt. »Mein Freund war auf der Arbeit. Die meiste Angst hatte ich davor, wie die schlechte Nachricht bei ihm ankommt: Wie sage ich es ihm? Und was ist dann? Was macht es mit der Beziehung?«
Alltägliche Abläufe im Leben Betroffener verändern sich schlagartig, Rollen wandeln sich, so Reuthlinger. Wie der Krebs selbst seien auch die Belastungen, die mit der Erkrankung einhergingen, multifaktoriell. In der Krebsberatung werde deshalb ein Fokus auf emotionale Entlastung gelegt.
Es gehe aber auch oft um Fragen der Kommunikation, wie Daniela sie beschreibt. »Krebstherapien sind enorme Eingriffe in die körperliche Integrität«, sagt Reuthlinger. Es sei wichtig, das eigene Körperbild zu stärken, um im Rahmen der Möglichkeiten wieder einen Zugang zu Intimität und Sexualität zu erlangen. Das müsse angesichts von Scham, Libidoverlust und Prioritätenverschiebungen gemeinsam mit Partnerpersonen besprochen werden.
In der psychoonkologischen Beratung würden genau diese Veränderungen normalisiert werden. »Wir nehmen den Erwartungsdruck heraus«, sagt Reuthlinger. Vieles, was Betroffene empfänden, sei völlig normal. Es entlaste, das im Gespräch herauszuarbeiten.

Niemand muss allein damit klarkommen
Daniela erzählt ihrem Partner ohne Umschweife von der Diagnose. Ihre Angst ist, wie sich herausstellt, unbegründet. »Wir sind erst einmal eine Stunde heulend, in den Armen liegend, auf der Couch gesessen, und dann wusste ich: Er ist für mich da«, sagt Daniela.
Diese Art der Konfrontation ohne Aufschub, der nüchternen und realistischen Betrachtungsweise, ist die Basis für ihre Bewältigung der Krankheit. Viel Unterstützung erfährt sie außerdem von ihrer Familie. Sie habe sich sehr getragen gefühlt.
Professionelle Hilfe – wie von einer Krebsberatungsstelle geboten – sucht sie deshalb nicht, instruiert aber ihre Familie, auf psychische Veränderungen zu achten, und ihr Bescheid zu geben, falls ihnen etwas auffallen sollte.
Wer innere Hürden verspürt, sich Hilfe zu holen, könne sich erst einmal auf rein informative Fragen beschränken, so Reuthlinger. »Betroffene sind oft nicht informiert, welche sozialrechtlichen Möglichkeiten auf Unterstützung sie haben«, sagt sie.
Dazu zählen Fragen, wer Behandlungskosten, Hilfsmittel und Fahrtkosten trägt ebenso wie die Verfügbarkeit von Rehamaßnahmen,
Es gebe keine Beratung nach Rezept. Die Inhalte bestimme immer die betroffene Person. Manchmal beobachte sie, dass emotionale Themen erst dann angesprochen würden, wenn der faktische Informationsbedarf gestillt sei. Reuthlinger, die auch systemische Therapeutin ist, hebt einen besonderen Vorteil dieser Beratung hervor: Betroffene hätten darin den Raum, einfach nur an sich zu denken, nicht an die Bedürfnisse einzelner Familienmitglieder, könnten frei äußern, was in ihnen vorgehe.
Sie rät hingegen davon ab, in Internetforen nach Hilfe zu suchen, da dort oft nur eine negativ gefärbte Perspektive von Menschen mit hohem Leidensdruck zu finden sei. Wer sich online informieren wolle,
So macht es auch Daniela. Sie hält Abstand von Internetforen, liest viel, holt sich fachlichen Rat von einem in der Pharmabranche beschäftigten Familienmitglied. Heute beschreibt sie sich als »mündige Patientin«, die Therapieentscheidungen gemeinsam mit ihrem ärztlichen Team trifft.
Ihre Krebsbehandlung ist mittlerweile 7 Jahre vorbei, die Krebserkrankung ist überstanden, sie ist wieder in der Vorsorge.
Wie Krebs vorbeugen?
Claudia Reuthlinger ermutigt alle, Früherkennungsuntersuchungen in Anspruch zu nehmen – auch jene, die sich rundum gesund fühlen. »Krebserkrankungen können wirklich jeden treffen. Es geht aber nicht darum, Angst zu machen, sondern früh genug draufzukommen«, sagt sie. Dazu gehörten regelmäßige hausärztliche und gynäkologische Untersuchungen sowie die Hautkrebsvorsorge. Bei jüngeren Patient:innen sei die Heilungschance sehr hoch.
Wichtig: Auch in Sachen Früherkennung gibt es ein »zu viel«. Ärzt:innen müssen stets individuell abwägen, wann welche Methoden Sinn ergeben und ratsam sind, sonst kann es durch etwaige falschpositive Befunde zu Übertherapie und unnötiger Belastung für Patient:innen kommen.
Was es rund um Früherkennung zu bedenken gilt, liest du hier:
Eine gesunde Lebensführung sei essenziell für die Vorbeugung, sagt Dr. Hansjörg Baurecht. Die gute Nachricht: Dafür braucht es keine Raketenwissenschaft. Hier sind vor allem die Klassiker hervorzuheben: regelmäßige Bewegung, kein Tabakkonsum, Alkohol vermeiden, ausgewogene Ernährung, Gewichtskontrolle
»Körperliche Aktivität ist aber auch in der Tertiärprävention wichtig«, also für Krebspatient:innen, die die Lebensqualität während der Therapie und die Heilungschancen erhöhen sowie das Risiko des Fortschreitens der Erkrankung oder des Wiedererkrankens reduzieren möchten.
Auch nach erfolgreichem Abschluss ihrer Therapie sorgt sich Daniela oft, dass die Krankheit zurückkehren könnte. Besonders dann, wenn Teile ihres Körpers ohne unmittelbar erkennbare Ursachen schmerzen. Mit der Zeit lernte sie jedoch wieder, was normal und zu tolerieren ist – und was nicht.
Schwierig werde es, wenn sie etwas spüre, was sie noch nicht kenne, was neue Ängste in ihr auslöse. »Dann lasse ich es aber relativ zeitnah abklären«, sagt sie. Die ständige Unsicherheit brauche ich nicht mehr in meinem Leben.«
Daniela hat ihre Erlebnisse in einem persönlichem Blog festgehalten. Diesen findest du hier.
Infos zur Krebsfrüherkennung
Die erste Anlaufstelle für Früherkennungsangebote sind die Hausärzt:innen.
Hier ein Überblick der vom
- Männer ab 18: monatlich Hoden selbst abtasten
- Frauen ab 20: einmal jährlich innere und äußere Geschlechtsorgane
- Frauen ab 30: einmal jährlich Brust und Achselhöhlen abtasten, monatlich selbst abtasten (Zeitpunkt abhängig von Zyklus und Wechseljahren)
- ab 35: alle 2 Jahre Haut-Untersuchung
- Männer ab 45: einmal jährlich Prostata- und Lymphknoten-Untersuchung
- ab 50: einmal jährlich Test auf Blut im Stuhl
- Männer ab 50 und Frauen ab 55: Darmspiegelung alle 10 Jahre
- Frauen ab 50 bis 69: Mammografie (Brust-Röntgen)
- Außerdem empfiehlt die STIKO für Kinder ab 9 die HPV-Impfung als Krebsvorsorge.
Redaktionelle Bearbeitung: Chris Vielhaus
Transparenzhinweis: In der ursprünglichen Version des Textes war von »weltweit 1,28 Millionen Krebserkrankungen« im Jahr 1990 die Rede. Korrekt sind 1,82 Millionen. Der Zahlendreher wurde nachträglich korrigiert.
Mit Illustrationen von Frauke Berger für Perspective Daily