Warum du alle Prognosen für 2025 vergessen kannst
Was uns ein alter Militärstratege und eine misslungene Gehirnoperation über die Grenzen des Vorhersehbaren lehren.
Der Januar ist nicht nur eine Zeit übereifrig gefasster Vorsätze. Er ist auch eine Zeit übereifriger Prognosen. Am Ende des alten und zu Beginn des neuen Jahres wagen allerlei Expert:innen einen Blick in die Glaskugel und geben ihre Einschätzung dazu ab, was uns wirtschaftlich, politisch oder kulturell in den nächsten Monaten erwartet.
All diese Prognosen mögen unterhaltsam sein – viel mehr aber auch nicht. Wer hätte Anfang 2024 beispielsweise gedacht, dass Donald Trump wirklich ein zweites Mal die
Ob der Krieg in der Ukraine, die Coronapandemie, die Wirtschaftskrise 2008 oder die Erfindung des Internets: Ereignisse, die die Welt von Grund auf verändern, sind von Natur aus unvorhersehbar. Von einigen wissen wir, dass sie eintreten können – andere wiederum kommen komplett aus dem Nichts.
Es gibt bekanntes Bekanntes; es gibt Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Wir wissen auch, dass es bekannte Unbekannte gibt: Das heißt, wir wissen, es gibt Dinge, die wir nicht wissen. Aber es gibt auch unbekannte Unbekannte – Dinge also, von denen wir nicht wissen, dass wir sie nicht wissen.
Das sagte der damalige US-Verteidigungsminister Donald Rumsfeld, kurz nachdem die USA als Antwort auf die Terroranschläge vom 11. September einen Krieg in Afghanistan begonnen hatten und wenige Jahre bevor sie einen weiteren Krieg im Irak anstoßen würden. Die Medien verspotteten die Äußerungen Rumsfelds, der dafür bekannt war, auf Reporter:innenfragen nur schwammig zu antworten. Doch diesmal hatte er mit seiner Aussage tatsächlich einen Nerv getroffen und eine Denkhilfe erschaffen, die nützlich ist, um Dinge, die wir wissen, und solche, die wir nicht wissen, einzuordnen. (Und um schließlich einzusehen, dass wir letztlich fast nichts wissen.)

Rumsfelds Worte lassen sich gut in einer kleinen Matrix anordnen, inzwischen bekannt als die »Rumsfeld-Matrix«. Auch wenn das

»Bekanntes Bekanntes«: Wovon wir wissen, dass wir es wissen
Was die »bekannten Bekannten« angeht, fasse ich mich kurz: Das ist offensichtlich das, was du weißt.
Oder tust du das wirklich? Wir haben viele Dinge im Kopf, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Unseren Geburtstag, den Namen der Bundeskanzlerin oder die Anzahl der Monde, die um unsere Erde kreisen. Einige der Prognosen, die wir treffen können, sind trivial, zum Beispiel welcher Wochentag morgen ist. Andere sind wichtig für unser Leben: Etwa dass wir in den nächsten Monaten ein Kind bekommen – vorausgesetzt, wir sind schwanger.
Bei einigen dieser Gewissheiten in unserem Kopf können wir allerdings ins Zweifeln geraten, wenn wir noch mal genauer darüber nachdenken. Dann entdecken wir Lücken in unserem vermeintlichen Wissen. Ist Vilnius wirklich die Hauptstadt von Lettland – oder war es doch Litauen?
»Bekanntes Unbekanntes«: Wovon wir wissen, dass wir es nicht wissen
Wäre es nicht eine willkommene Abwechslung, wenn Gäste in deutschen Talkshows einfach mal sagen würden:
PD-Classic
Dieser Artikel erschien zuerst im Dezember 2020. Vor Neuveröffentlichung haben wir den Text und seine Quellen noch einmal gründlich überprüft und kleinere Änderungen vorgenommen.
In diese Kategorie fallen besonders viele beliebte Prognosen. Jede:r scheint Antworten auf Fragen parat zu haben wie: Wie werden die Aktienmärkte 2025 aussehen? Wo wird es im neuen Jahr große wissenschaftliche Durchbrüche geben? Und was wird der neue heißeste Trend in den sozialen Medien?
Eigentlich müssten hier alle, die bei rechtem Verstande sind, antworten: »Ich weiß es nicht!« Ein wenig zu spekulieren, kann durchaus Spaß machen, und mit Unwissenheit können natürlich keine Sonderausgaben in Funk und Fernsehen gefüllt werden – doch seriös sind derartige Prognosen nicht.
Die Coronapandemie, die das Jahr 2020 und darüber hinaus bestimmte, war eine klassische »bekannte Unbekannte«. Denn wir wissen seit Langem, dass es früher oder später zu einer Pandemie kommen würde;
Von manchen Ereignissen wissen wir, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten werden, wir können nur den genauen Zeitpunkt nicht vorhersagen. Andere Dinge können wir grob abschätzen: Wie groß ist das Universum? Wie viele Sandkörner liegen in der Sahara? Doch wir wissen: Genau wissen können wir es nicht.
Weiter geht es in unserer Matrix eine Zeile tiefer. Hier wird es richtig interessant … und auch ein bisschen schräg.
»Unbekanntes Bekanntes«: Wovon wir nicht wissen, dass wir es wissen
Können wir etwas wissen, von dem wir gar nicht wissen, dass wir es wissen? Können also geheime, unbemerkte Fähigkeiten in uns schlummern, von denen wir keine Ahnung haben? Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir das Wort »Wissen« interpretieren.
Es gibt einen Mann, der dafür bekannt ist, dass er versteckte Talente an sich entdeckte – und zwar immer und immer wieder aufs Neue. Es geht um den tragischen Fall von Henry Molaison, besser bekannt als Patient H.M. Henry litt seit seiner frühen Jugend an Epilepsie. Über die Jahre wurden seine Epilepsieanfälle schlimmer, bis zu dem Punkt, an dem er nicht mehr arbeiten konnte und seine Eltern die Fürsorge für ihn übernehmen mussten, obwohl er längst ein erwachsener Mann war.
In dem verzweifelten Versuch, ihn von seinem Leid zu befreien, führten Ärzte im Jahr 1953
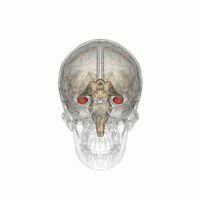
Nach der OP war Henry nicht mehr in der Lage, neue Erinnerungen zu erschaffen. Für Henry war fortan jeder Tag wie der erste Tag nach seiner Operation. Er würde sich nie mehr daran erinnern können, dass die OP stattgefunden hatte. Die Menschen um ihn herum mussten ihm ein ums andere Mal erzählen, was geschehen war.
Er konnte nach wie vor wunderbar lebhafte Geschichten aus seiner Vergangenheit vor der OP erzählen – nur um sie 15 Minuten später noch einmal mit demselben Esprit kundzutun, als hörte sein Publikum sie zum ersten Mal, hatte er doch komplett vergessen, sie gerade erst erzählt zu haben. Henry war in der Zeit gefangen.

Nicht lange nach seiner OP weckte Henry das Interesse von Wissenschaftler:innen, die von den Einblicken in die Funktionsweise des menschlichen Gehirns fasziniert waren. Trotz Henrys tragischem Zustand fanden sie heraus, dass er doch eine gewisse Art von Erinnerungen erschaffen konnte.
Um das herauszufinden, brachten sie ihm einige besondere Fähigkeiten bei: Eine davon bestand darin, vor einem Spiegel präzise Zeichnungen anzufertigen. Dafür sollte er mit einem Stift eine Reihe von Punkten verbinden, während er seine Hand, den Stift und die Punkte jeweils nur in einem Spiegel beobachten konnte. Beim ersten Mal fiel ihm das schwer, weil alles spiegelverkehrt war.
Hätte Henry keinerlei neue Erinnerungen speichern können, hätte er bei dieser Übung Tag für Tag gleich schlecht abschneiden müssen. Und er erinnerte sich natürlich nie daran, schon einmal an diesem eigenartigen Experiment teilgenommen zu haben. »Woher sollte ich das können?«, fragte er. »Ich habe das noch nie gemacht!« Doch Tag für Tag überraschte Henry nicht nur die Forscher:innen, sondern auch sich selbst damit, wie er
Er wusste also, was er da tat – ohne sich darüber im Klaren zu sein, dass er es konnte. Mit anderen Worten: Henrys Spiegel-Zeichenkünste waren eine »unbekannte Bekannte«.
Wir haben ein Gedächtnis, das das Wissen speichert, worauf wir direkt und bewusst zugreifen können, dessen Inhalt wir anderen mitteilen können. »Ich weiß, was am 11. September 2001 geschah, ich weiß, wie die Straßenverkehrsordnung funktioniert, und ich weiß, wie man Badminton spielt (einigermaßen zumindest).«
Das Gedächtnis, das es uns ermöglicht, Dinge zu tun, ist ein anderes als das, das uns (schlaue) Dinge aussprechen lässt. Wir können nicht wirklich beschreiben, wie wir einen Badmintonball treffen sollten, damit er möglichst stark im gegnerischen Feld aufschlägt, oder
»Unbekanntes Unbekanntes«: Wovon wir nicht wissen, dass wir es nicht wissen
Der wichtigste Ausruf in der Wissenschaft, jener, der neue Entdeckungen ankündigt, ist nicht etwa ›Heureka‹ (Ich habe es gefunden!), sondern ›Das ist ja merkwürdig …‹.
Jetzt kommen wir zum interessantesten Part, den »unbekannten Unbekannten«. Hier, im vierten und letzten Feld unserer kleinen Matrix, tragen sich die ganz entscheidenden Ereignisse zu. Hier wird Geschichte geschrieben – im Guten wie im Schlechten.

Die wichtigsten Ereignisse der Geschichte sind für gewöhnlich die am wenigsten vorhersehbaren. Es sind die Dinge, von denen wir uns nicht vorstellen können, dass sie passieren – bis sie passieren. Die großen Erfindungen, von der Dampfmaschine bis zum Internet, sind solche großen Sprünge auf dem langen Weg des Fortschritts, die wir niemals hätten erahnen können. Auch die größten wissenschaftlichen Entdeckungen waren meistens jene, wonach wir überhaupt nicht gesucht hatten.
Die Entdeckung des Antibiotikums begann mit einer unerwünschten Schimmelschicht in einer Petrischale, in der Experimente mit Bakterien durchgeführt wurden. Die Dampfmaschine entstand durch die Kombination vieler Teile und Erfindungen, die ursprünglich ganz anderen Zwecken dienen sollten und wovon niemand dachte, dass sie einmal das Rad der Geschichte derart nach vorn drehen würden. Im ersten Automobilmotor war ein Sprühsystem verbaut, womit ursprünglich Malaria bekämpft werden sollte (als Menschen noch davon ausgingen, die Krankheit übertrüge sich durch die Luft).
Aus der Retrospektive erscheinen derartige Entdeckungen und Durchbrüche oft offensichtlich, als hätten sie sich geradezu aufgedrängt. Der Pfad scheint vorgegeben gewesen zu sein. Doch das liegt nur daran, dass Historiker:innen – und Menschen im Allgemeinen – den Drang haben, verschiedene, einzelne Ereignisse zu einem Gesamtnarrativ zu verweben. So machen wir es auch mit unserem eigenen Leben. Diese Narrative sind der magische Sternenstaub, woraus viele Quacksalber:innen die Prognosen für die Zukunft formen.
Natürlich können wir aus der Geschichte lernen und Schlüsse ziehen; es vermeiden, wieder und wieder dieselben Fehler zu begehen. Doch um die Zukunft vorherzusagen, taugen historische Narrative, die oft auf sehr begrenzten Informationen beruhen und hochkomplexe Zusammenhänge selten in Gänze erfassen, reichlich wenig. Die Zukunft steckt voller »unbekannter Unbekannter« – einige davon wunderbare Überraschungen, andere schreckliche Hiobsbotschaften.
Wie können wir uns – gerade auf Letzteres – vorbereiten? Das Einzige, was wir tun können, ist, für alles besser gewappnet zu sein.
Wenn du in den nächsten Wochen also Prognosen für das Jahr 2025 hörst oder liest, solltest du sie mit einer gehörigen Portion Skepsis genießen. Denn es gibt eine »bekannte Bekannte«, derer du dir sicher sein kannst: Die Person, die hier orakelt, weiß es auch nicht.

