Warum uns die Täter mehr interessieren als ihre Opfer
Oder an welche Namen denkst du, wenn du Breitscheidplatz und NSU hörst? So werden die Opfer zu lauten Stimmen.
Ein Jahr ist vergangen, seitdem der Tunesier Anis Amri einen polnischen Lkw-Fahrer tötete und dessen Fahrzeug in den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz lenkte. Als der Sattelschlepper
Ein Jahr später ist klar, dass die Behörden genug belastendes Material gehabt hätten, um Amri bereits vor seiner Tat zu verhaften – zwar nicht allein wegen terroristischer Aktivitäten, aber
Immer wieder fügen Sonderermittler und Ausschüsse weitere Puzzleteile zu einem Bild hinzu. Am Ende wird es vielleicht einmal zeigen, wer wie viel Schuld daran trägt, dass der behördenbekannte Amri von niemandem an seiner Terrorfahrt gehindert wurde. (So wurde erst vor anderthalb Wochen bekannt, dass das nordrhein-westfälische Landeskriminalamt Ende Oktober 2016 seine Berliner Kollegen fragte, wo Amri sich aufhalte – die Nachfrage aber
»Ja – Berlin. Das war so eine Idee von mir gewesen. Ich hatte meiner Mutter den Vorschlag gemacht: Wie sieht’s denn aus? Hättest du mal Lust, nach Berlin zu reisen? Und dann habe ich ihr die Reise geschenkt.«
So
Der Anschlag auf dem Breitscheidplatz hat Deutschland erschüttert und verändert – ein Jahr später finden Weihnachtsmärkte in der ganzen Bundesrepublik hinter schweren Betonblöcken statt. Aber wie geht Deutschland mit den Opfern um, für die sich in dieser Nacht alles geändert hat?

Ibrahim Arslan ist Opfer, ohne passiv zu sein
Kaum jemand hat sich so intensiv mit dieser Frage beschäftigt wie Ibrahim Arslan: Vor 25 Jahren warfen Neonazis Molotowcocktails ins Haus seiner Familie in der norddeutschen Kleinstadt Mölln – seine Großmutter rettete ihn vor den Flammen, starb dann aber selbst beim Versuch, seine Schwester und seine Cousine zu retten,
Über die Ereignisse dieser Nacht spricht Ibrahim Arslan seit 2 Jahren an Schulen in ganz Deutschland. Mittlerweile haben schon 10.000 Schüler an seinen Zeitzeugengesprächen teilgenommen. Am Telefon habe ich ihn gefragt, was die wichtigste Aussage dieser Gespräche ist:
Ich versuche, den Schülern immer wieder die Opferperspektive näherzubringen. Die Schülerinnen und Schüler merken nach der Veranstaltung immer wieder, dass sie sich bisher nur mit dem Täter befasst haben, und genauso sind wir in der Gesellschaft.
Wenn er zum Beispiel frage, wer
Wir sind eine Täter-Gesellschaft und schauen uns jeden Tag an, was der Täter gemacht hat, wie er aussieht, was er anzieht, was er trinkt. Aber wir kümmern uns überhaupt nicht darum, was das Opfer ausmacht.
Sind die Täter in unserer Gesellschaft tatsächlich viel präsenter als die Opfer? Auch dieser Text hat mit dem Attentäter vom Breitscheidplatz begonnen. Wenn du magst, kannst du den Text noch einmal neu anfangen –
schalte hier um und lies einen Einstieg, der die Opfer in den Mittelpunkt stellt.
Du willst noch einmal zu dem Einstieg, der den Täter in den Mittelpunkt stellt? Schalte
hier
Wie sollte die Gesellschaft also mit den Opfern von Anschlägen umgehen? »Wir müssten das Ganze einmal umdrehen und über die Opfer reden statt über die Täter«, sagt Arslan. »Dann würde sich vieles ändern in unserer Gesellschaft.«

Die sehr verschiedenen Opfer vom Breitscheidplatz
Opfer zu sein, der Begriff kennt viele Abstufungen.
Daraus ergibt sich bereits, dass man keine allgemeinen Richtlinien zum richtigen Umgang mit Opfern festlegen kann, die uneingeschränkt gelten. »Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf eine solche emotionale Situation«, sagt Beck. »Wenn eine junge Frau beide Eltern verloren hat, ist sie in einer anderen Situation als jemand, der nur einen Elternteil verloren hat.«
In der vergangenen Woche hat Beck seinen

Denn auch wenn statistisch betrachtet
»Der Amri und andere Terroristen greifen ja nicht jene ganz bestimmten Personen an, sondern diese Gesellschaft«, sagt Kurt Beck. »Die Angehörigen sagen natürlich zurecht, der Staat war angegriffen, also muss er uns auch in besonderer Weise zur Seite stehen.« Diesen Beistand leistet Beck, seitdem er im März dazu beauftragt wurde – ansonsten kam von der Bundesregierung wenig. Darüber waren die Hinterbliebenen vom Breitscheidplatz zeitweise so frustriert, dass sie einen offenen Brief an Angela Merkel verfasst haben:
In Bezug auf den Umgang mit uns Hinterbliebenen müssen wir zur Kenntnis nehmen, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie uns auch fast ein Jahr nach dem Anschlag weder persönlich noch schriftlich kondoliert haben. Wir sind der Auffassung, dass Sie damit Ihrem Amt nicht gerecht werden.
Immerhin hat sich die Kanzlerin am Vorabend des Jahrestags mit den Angehörigen getroffen – »das wird von vielen als zu spät eingeordnet«, sagt Beck. Sonst ist nicht üblich, dass die Bundeskanzlerin auf Offene Briefe reagiert, insofern kann diese Einladung als Versuch der Wiedergutmachung nach einem Fehler verstanden werden.
Lange verdächtigt, spät entschädigt: die Opfer des NSU
Eine besonders drastische Geschichte, voller öffentlicher Vorverurteilung und jahrelangem Warten auf Anerkennung und Entschädigung, verbindet die Hinterbliebenen der NSU-Mordserie: Zwischen 2000 und 2007 tötete die rechtsextreme Terrorgruppe »Nationalsozialistischer Untergrund« 10 Menschen in deutschen Großstädten,
Ich weiß, dass sich die meisten Medien nicht entschuldigt haben. Es hat sich auch die Polizei nicht entschuldigt – es gab nur einen Fall, dass ein Polizist noch mal angerufen hat, bei
Das sagte mir Barbara John, die kurz nach dem Auffliegen des NSU von der Bundesregierung beauftragt wurde, die Opfer als
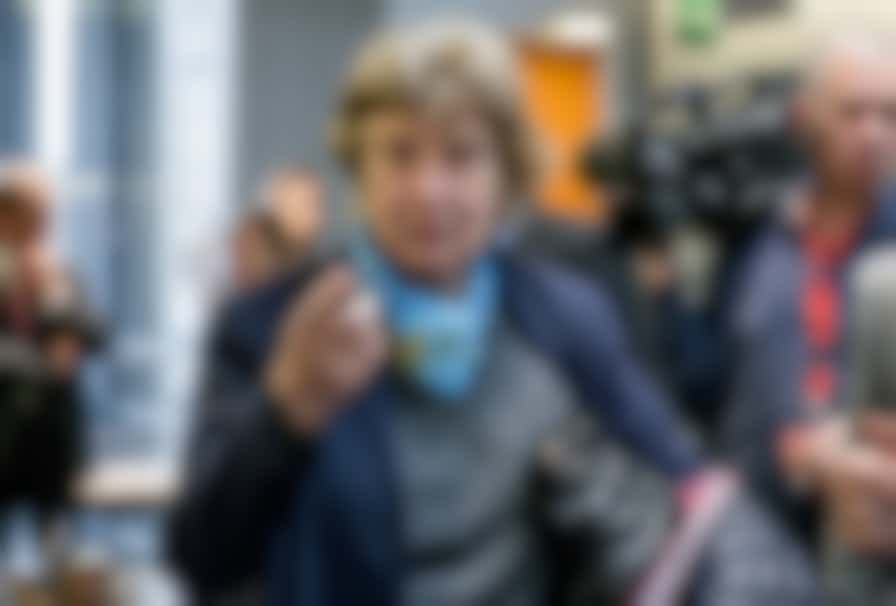
Einige der Opfer besaßen Läden, und die Hinterbliebenen mussten Lieferanten und Vermieter weiterbezahlen. Dazu kamen Begräbniskosten, teilweise auch die Überführung in die Türkei. Barbara John organisierte seit der Enttarnung des NSU viele Treffen der Angehörigen untereinander. Um die Kosten für Fahrten und Unterkünfte zu decken, sammelte sie Spenden von der Zivilgesellschaft, insgesamt gingen 120.000 Euro auf dem Konto ein. So konnten die Treffen auch ohne zentrales Budget stattfinden.
»Es ist selbstverständlich, dass da in großzügiger Weise geholfen werden muss und nicht für jede Hilfestellung ’zig Formulare ausgefüllt werden müssen.« Das, sagt Barbara John, habe sie über die vielen Jahre gelernt – »und wenn ich das Gutachten von Herrn Beck richtig gelesen habe, hat er das in dem einen Jahr auch gelernt.«
Mölln, NSU, Breitscheidplatz – was hat Deutschland daraus gelernt?
Tatsächlich lautet ein konkreter Vorschlag in Becks Abschlussbericht, die Härtefall-Leistungen – also jene Zahlungen, die keiner komplizierten Begründung bedürfen –

Als besonders wichtig dürften sich Kurt Becks strukturelle Vorschläge erweisen: Er fordert, wie schon erwähnt, Opferbeauftragte dauerhaft einzusetzen – und zwar parallel beim Bundesjustizministerium und bei den Ländern. So soll im Fall des Falles ein Ansprechpartner sofort zur Verfügung stehen; die Angliederung ans Ministerium hätte den Vorteil, dass man schnell auf zusätzliches Personal zurückgreifen könnte. Beck zeigte sich mir gegenüber optimistisch, dass alle seine Vorschläge umgesetzt
Ich bin zuversichtlich, dass wir aus dieser Situation lernen und dass wir für die Zukunft, aber ich hoffe auch für die jetzt Betroffenen zumindest materiell eine bessere Situation herbeiführen können.
Was ist noch zu tun?
In Deutschland gibt es zwar NGOs wie den »Weißen Ring«, die Opfern umfangreiche Unterstützung zuteilwerden lassen. Einen dauerhaften Verband, eine Interessenvertretung der Opfer selbst gebe es jedoch noch nicht, sagt Barbara John: »Was wir dringend brauchen, ist eine Selbstvertretung der Opfer rechtsradikaler Anschläge.« Dasselbe könnte es auch für die
Es ist ganz wichtig, aus der Extremsituation nicht nur in die Normalität zurückzukommen, sondern aus der Opfersituation eine Mitmachsituation zu machen. Sich einzulassen auf eine Gesellschaft, in der diese Probleme eine Rolle spielen, in der sie aber auch bewältigt werden können. Je aktiver diese Familien mitmachen, desto überzeugender ist das auch für die Wahrnehmung der Opfer in der Gesellschaft.
Frankreich und Spanien wären Deutschland da schon ein Stück voraus, findet John: Dort gibt es solche Foren. Auch eine EU-Arbeitsgruppe namens
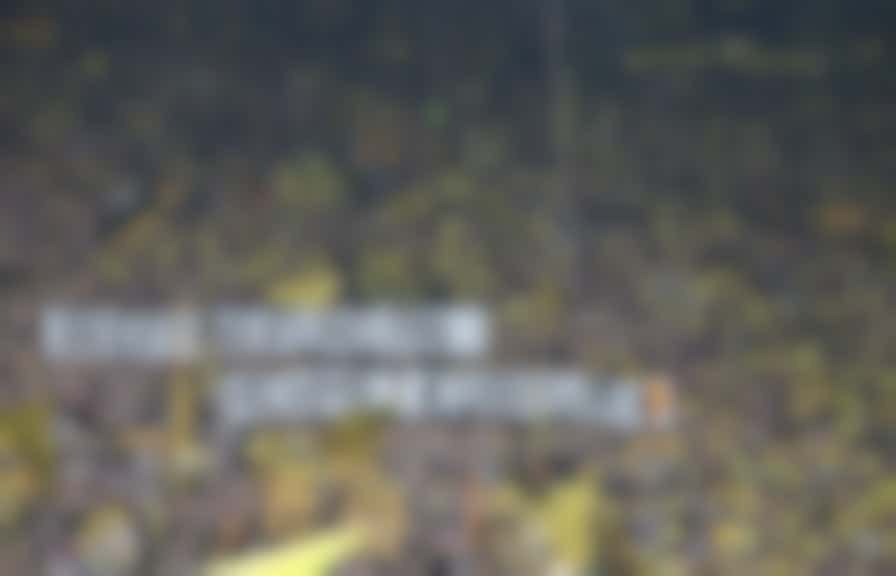
»Es fehlt eine Opfer-Beratungsstelle, geleitet von Betroffenen«, sagt auch Ibrahim Arslan. Er findet wichtig, dass auch andere Opfer die Gelegenheit erhalten, wie er ihre passive Rolle zu verlassen: »Ich habe so viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben ›ich möchte niemals in die Öffentlichkeit gehen‹, die aber jetzt im Fernsehen auftreten und Gedenkveranstaltungen selbst organisieren. Das ist geschehen, weil sie sich untereinander vernetzt und gegenseitig dazu ermutigt haben.«
»Opfer sind keine Statisten, sondern die Hauptzeugen des Geschehenen.«
Als Beispiel nennt Arslan die
Aber auch auf die Gesellschaft selbst wirken die Aktionen von Opfern migrantischer Herkunft, ist Arslan überzeugt: Er erzählt, dass seine Zeitzeugengespräche schon 3-mal bei Schülern, die selbst »aus der rechten Ecke kamen«, zu einem echten Umdenken führten – einer wollte sich sogar für Flüchtlinge engagieren. Letztlich könnte eine lautere Stimme der Opfer in der Gesellschaft vieles ändern, sagt Ibrahim Arslan: »Opfer sind keine Statisten, sondern die Hauptzeugen des Geschehenen.«
Titelbild: Gaelle Marcel - CC0 1.0

