Darum müssen wir uns mit unserem Plastikkonsum versöhnen
Plastik ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Ein »Weiter so« ist aber auch keine Option. Sonst leben wir bald auf einer Müllhalde.
Plastik ist überall: im Trinkwasser, in den Meeren, in unserem Essen. Es tötet Seevögel und Fische, verändert unseren Hormonhaushalt und entstellt die Umwelt für Jahrhunderte.
So weit, so schlimm, so bekannt. Und so einseitig.
Denn wir haben ihm auch viel zu verdanken: Ohne Plastik hätten wir heute zum Beispiel nicht so gesunde Zähne, gute Frisuren und frische Lebensmittel, wie wir es gewöhnt sind. Es gäbe keine Plastik hat den Luxus demokratisiert.
Schallplatten, Pflaster oder Computermäuse. Plastik hat den Luxus demokratisiert.
Eine Zahnbürste? Ein Kamm? Eine Tupperdose? Noch vor 150 Jahren waren das wertvolle Gegenstände, die aus seltenen und teuren Materialien wie Schildkrötenpanzer oder Metall gefertigt waren. Das konnten sich die wenigsten leisten. Heute gibt es Plastik-Pflaster, -Feuerzeuge und -Flaschen wortwörtlich wie Sand am Meer.
Die Misere ist offensichtlich: Gerade weil Plastik so praktisch und billig ist, häufen wir immer mehr davon an. Das sorgt dafür, dass es mittlerweile in den entlegensten Winkeln der Erde zu finden ist.
Genau die Eigenschaften, die Plastik zu einem so fantastischen Material für uns Menschen machen – Leichtigkeit, Festigkeit, Haltbarkeit –, machen es auch zu so einem Desaster, wenn es in die Natur gelangt.
Plastik ist also Fluch und Segen zugleich. Klar ist: Ein Zurück in eine Zeit ohne Plastik kann es nicht geben. Ein »Weiter so« kommt in Anbetracht der Probleme, die die Verschmutzung verursacht, aber auch nicht infrage. Es hilft nicht, Plastik pauschal zu verteufeln oder sich von den Vorzügen blenden zu lassen.

Die Frage ist: Wie kommen wir zu einem ausgeglichenen Umgang mit dem Wundermaterial? Allzu lange sollten wir diese Frage nicht mehr aufschieben …
Plastik ist Segen
Die Erfindung des Plastiks geschah aus der Not: Im 19. Jahrhundert, inmitten der industriellen Revolution, standen für Haushaltsgegenstände im Wesentlichen Materialien pflanzlichen Ursprungs (vor allem Holz), mineralischen Ursprungs (vor allem Gesteine), metallischen oder tierischen Ursprungs (etwa Horn, Wolle, Elfenbein) zur Verfügung.
Mit steigender Nachfrage wurden diese Güter immer knapper, sodass Chemiker und Produzenten händeringend nach Alternativen suchten. Nehmen wir das Beispiel Elfenbein: Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Billardspiel immer populärer. Die notwendigen Kugeln wurden zunächst aus Elfenbein von Elefanten hergestellt. Auch Kämme und Klaviertasten wurden häufig aus Elefanten-Stoßzähnen gefertigt – bis sich ein amerikanischer Unternehmer auf die Suche nach einem preiswerten Ersatz machte. Erst die Entdeckung von Zelluloid beendete vorübergehend

Bald wurde klar: Plastik eignet sich nicht nur, um die bis dato verfügbaren Materialien zu ersetzen. Plastik kann viel, viel mehr. Es ist leicht, kommt mal elastisch, mal fest daher, lässt sich in jede erdenkliche Form gießen oder pressen und ist sehr haltbar. Plastik rostet nicht, quillt nicht auf, wenn es feucht wird, und zerbricht nicht, wenn es auf den Boden fällt.
Heute erledigt Plastik in unserem Alltag so viele neue wie alte Aufgaben: Dank Teflon gibt es Pfannen, die nichts anbrennen lassen, Gummiringe sorgen für Ordnung in der Küche und auf dem Kopf, Polyamid hält uns im Regen trocken, ohne uns ins Schwitzen zu bringen.
Was, wenn die Zahnpasta-Tube leer, der Autoreifen abgefahren und der Joghurtbecher ausgelöffelt ist?
Die Liste scheint endlos: Auch die Medizin (Pflaster, Sprühverbände, Blutreserven), das Bauwesen (Dübel, Fensterrahmen, Isoliermatten), Kunst und Kultur (Schallplatten, Acrylfarben, Keyboards) und die
Aller Voraussicht nach ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht und Plastik wird auch weiterhin unser Leben umkrempeln: Mit »smarten« Kunststoffen sind künftig T-Shirts denkbar, die ihre Farbe wechseln, Fenster, die tagsüber Strom erzeugen und nachts Licht spenden, und Sonden, die in unserer Blutbahn unseren Gesundheitszustand checken.
Wie gesagt, ein Zurück in eine Welt ohne Plastik gibt es nicht.
Aber was, wenn die Zahnpasta-Tube leer, der Autoreifen abgefahren und der Joghurtbecher ausgelöffelt ist?
Wir produzieren immer schneller immer mehr Müll!
Die Menge an Plastikmüll wird jedes Jahr mehr. Bis 2050 könnte sie sich auf 26 Milliarden Tonnen vervierfachen.
Plastik ist Fluch
Jede Minute landen auf der Welt
Schon 1997 stieß Charles Moore, Meereskundler und Kapitän, mitten im Pazifik auf eine zuvor unbekannte Insel. Eine Insel aus Plastik:
Als ich den Blick von Deck über die Oberfläche dessen schweifen ließ, was ein klarer Ozean sein sollte, war ich mit dem Anblick von Plastik konfrontiert, soweit das Auge reichte. Es war unglaublich, aber ich konnte keinen unbedeckten Flecken finden. In den Wochen, die es dauerte, die Subtropenfront zu überqueren, schwamm Plastikabfall an der Oberfläche, egal zu welcher Zeit ich schaute: Flaschen, Deckel, Verpackungen, Fragmente.
Inzwischen ist der Plastikstrudel rund 4-mal so groß wie Deutschland.
Was der Amerikaner beschreibt, ist tatsächlich nur die Oberfläche des Problems.
Auf jede Flasche, jeden Deckel und jeden alten Kanister, der im Wasser treibt, kommen zahllose Kleinstpartikel, die sich von den größeren Gegenständen lösen oder

Und weil die Ozeane kein abgeschlossenes System sind, ist der
Das kann uns nicht egal sein, denn
- Seevögel essen die Plastikteile,
- auch

Wir müssen
- weniger Plastik verbrauchen,
- Plastik schlauer einsetzen,
- den Müll, den wir verursacht haben, wieder einsammeln.
1. Weniger Plastik verbrauchen
- Kleine Läden und erste Supermärkte machen es vor: Lebensmittel erreichen auch ohne Plastikverpackungen sicher unsere Küche. Gehört plastikfreien Supermärkten die Zukunft?
- In Irland, Frankreich, Ruanda und vielen anderen Ländern sind sie längst verboten: Einwegtüten an der Supermarktkasse. Ein Modell für den Rest der Welt?
- Der
- Wenn der Lack ab ist, landen die kleinen Plastiksplitter, aus denen viele künstliche Farben und Lacke bestehen, in der Natur. Welche Alternativen gibt es?
2. Anderes Plastik und Plastik anders gebrauchen!
- Anstatt Plastik auf Basis von Erdöl zu fertigen, gibt es viele Möglichkeiten, biologisch schnell abbaubares Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen herzustellen. Kompostierbare Mülltüten etwa liegen schon im Supermarkt. Funktioniert das?
- Oft kann Plastik durch einfache, natürliche Materialien ersetzt werden, etwa Mikroplastik in Kosmetik: Das ist in vielen Ländern – zum Beispiel in den USA und Großbritannien – schon verboten. Stattdessen sorgen beispielsweise auch zerriebene Obstkerne für glatte Haut.
- Kleidung aus Polyester gibt bei jedem Waschgang kleine Partikel ab. Holzfasern, Hanf, Wollmischungen oder Seide sind inzwischen genauso atmungsaktiv und wärmend. Ist das auch etwas für den Massenmarkt?
- In Deutschland wird
Wie lange überdauert unser Müll?
3. Plastik wieder einsammeln!
8,3 Milliarden Tonnen haben wir in der kurzen Geschichte des Plastiks bereits produziert – so viel, wie 80 Millionen Blauwale auf die Waage bringen.
- Die großen Mengen, die schon in die Natur gelangt sind, müssen wir wieder einsammeln. Pioniere haben sich daran gemacht, den Müll mit großen Treibnetzen aus dem Meer zu ziehen.
- Man hat Mikroben und
Ob und wie diese Lösungen funktionieren, wollen wir in den kommenden Monaten im Rahmen unserer Kooperation mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt herausfinden. Wenn ihr weitere Ideen und Anregungen rund ums Plastik habt, schreibt uns eine Mail!
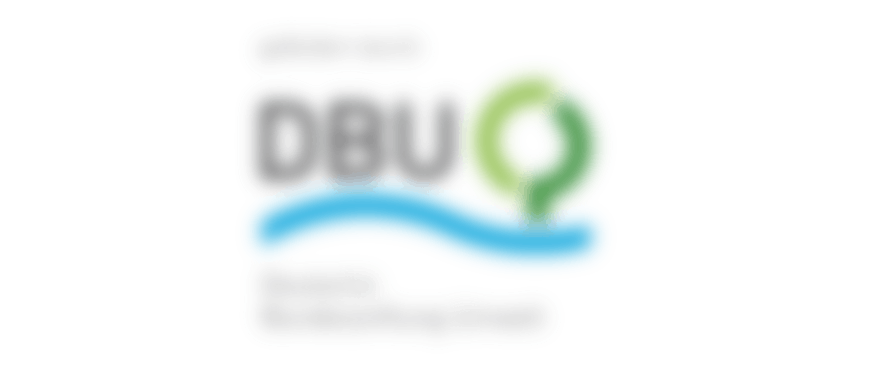
Weitere Informationen zu dieser Förderung findest du hier!

