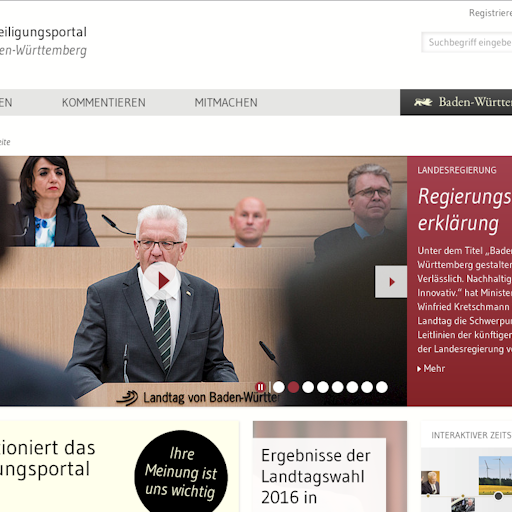Auf einen Experten im Rathaus kommen Tausende auf der Straße
Die spanische Partei Podemos mobilisiert die Bürger im Internet und im echten Leben. Mitbestimmung ist ihr Erfolgsrezept. Auch in Madrid wird Schwarmintelligenz genutzt. Aber ganz so einfach ist es nicht.

In 3 Tagen finden in Spanien Neuwahlen statt. Warum? Das Parlament ist nach den Wahlen im Dezember 2015 nicht regierungsfähig, da es keine Mehrheiten gibt. Was zunächst sehr negativ klingen mag, ist tatsächlich ein historisches Ereignis und der Beginn eines gesellschaftlichen und politischen Wandels in Spanien: Seit dem Ende des Franco-Regimes vor 39 Jahren wurde das Parlament von einem Zweiparteien-System regiert. Die junge Partei Podemos hat es geschafft, diese
Bei den spanischen Parlamentswahlen am 20. Dezember 2015 überraschte Podemos nicht nur das Establishment im Inland. Über 5 Millionen Wähler hatte sie aus dem Stand von ihrem Konzept überzeugt. Podemos will Direktdemokratie, soziale Gerechtigkeit und ein Ende der Korruption. Mit knapp 21% der Stimmen zog sie als drittstärkste Kraft in das spanische Parlament ein. Es ist also nicht nötig, politisch linksorientiert zu sein, um dieses Phänomen interessant zu finden. Die spannende Frage ist: Wie haben die das gemacht? Wer ist diese neue Partei und was unterscheidet sie von anderen?
Von der Protestbewegung zur Partei
Der Name »Podemos«, übersetzt »wir können«, benennt deutlich eines der wichtigsten Prinzipien der jungen Partei: Bürgerbeteiligung. Die Protestbewegung

Erst zu den Europawahlen im Mai 2014 lässt sich Podemos als Partei offiziell eintragen. Sie tue es aufgrund des »legalen Imperativs«, denn nur als Partei kann die Bewegung an den Europawahlen teilnehmen. Eine Woche vor Ablauf der Frist hat Podemos die nötige Anzahl von 15.000 Unterstützern erreicht, um bei der Europawahl kandidieren zu dürfen. Nach den Wahlen steht fest: Die Partei hat es geschafft. Mit knapp 8% der Stimmen gewinnt sie 5 Mandate für das Europaparlament. Die Zahl der Facebook-Fans steigt innerhalb von 2 Monaten von 100.000 auf 600.000. Im Juli beginnt Podemos mit der Aufnahme von Parteimitgliedern. Innerhalb von 48 Stunden registrieren sich 32.000 Mitglieder auf der Website der Partei, nach 20 Tagen sind es 100.000. Gemessen an der Mitgliederzahl ist Podemos nun nach der Volkspartei (Partido Popular, PP) und der Spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) die drittgrößte spanische
Mitglieder stimmen online über das Parteiprogramm ab
Podemos hat von Anfang an auf ein Mitmach-Prinzip gesetzt. Zunächst über soziale Medien, dann auf der eigenen Online-Plattform, dem Plaza Podemos. Hier kann sich jeder informieren und mitmachen. Mitmachen heißt bei Podemos mitgestalten und mitentscheiden. Die Protestbewegung »15M« kritisierte vor allem, dass Politiker nicht die Interessen der Bevölkerung in den Vordergrund stellten, sondern die eigenen und die der Wirtschaft. Die Bürgerbeteiligung wurde zum wichtigsten Instrument der Bewegung. Doch wie sieht das konkret aus?
Wer nicht nur seine Stimme abgeben will, sondern selbst aktiv werden möchte, schreibt sich mit seinem Personalausweis einmalig und kostenlos online beim Aktuell sind knapp 430.000 Bürger registriert.
Inhalte und Programme sind dort leicht einsehbar. So werden beispielsweise unter dem Stichwort »Transparenz« die Mitarbeiter und deren
Wer lieber »im echten Leben« diskutiert, trifft sich in den Podemos-Gruppen. In speziellen »Themen-Kreisen« setzen sich Laien und Experten aus allen sozialen Schichten mit bestimmten Inhalten auseinander. Sei es im Gesundheits-Kreis, im Bildungs-Kreis oder im Verkehrs-Kreis. Im Wirtschafts-Kreis treffen sich Manager, Arbeiter, Gewerkschaftler, BWL-Studenten und Rentner einer Stadt regelmäßig, um Konzepte für lokalwirtschaftliche Fragestellungen zu erarbeiten. Auch das Wahlprogramm wird gemeinsam diskutiert, es werden Anpassungen eingearbeitet, über finale Versionen wird abgestimmt. Ideen, die große Resonanz und viele »likes« erhalten, schaffen es in die nächste Ebene. Dort wird entschieden. Basisdemokratie eben. So soll das Volk in die Gestaltung der Gesellschaft miteinbezogen werden.
Das Ziel: einen Konsens finden. Das geht nicht ohne die aktive Bürgerbeteiligung an politischen Diskussionen und Entscheidungen. Politische Entscheidungen, die von vielen getragen werden, haben automatisch eine hohe Akzeptanz und erfahren entsprechende Unterstützung. Die digitale Kommunikation macht’s möglich und bringt die Grundstruktur einer »Schwarmisierung« mit.
Crowdfunding und Mikrokredite finanzieren den Wahlkampf
Wie sieht ein Parteiprogramm aus, das alle Bürger einbeziehen will? Endet das nicht im Chaos? Vor den Parlamentswahlen im Dezember 2015 konnten die Unterstützer im Netz gemeinsam an den Inhalten des Parteiprogramms arbeiten. Die einzelnen Programmpunkte sind jetzt – kurz vor den Neuwahlen am 26. Juni – wieder auf der Website einsehbar und verständlich erklärt. Die Themen betreffen alle Gesellschaftsschichten: Es sollen soziale Rechte in der Konstitution verankert, bezahlbare und stabile Mieten gefördert und eine partizipative Universitätsreform
Die Beteiligung des »Schwarms« hat dem Wahlkampf in Spanien eine neue Dimension hinzugefügt. Weil sich viele Bürger aktiv einbringen, Aufgaben übernehmen und mitgestalten, waren Parteiabstimmungen und Wahlkampf besonders kostengünstig: Die Auswertung der Wahlkampf-Kampagnen unterschiedlicher Parteien im Herbst 2015 ergab, dass Podemos die geringsten Wahlkampf-Kosten hatte. Das hat offenbar wenig mit der politischen Ausrichtung zu tun: Die ebenfalls linke IU hat statt knapp 50 Cent (Podemos) fast 3 Euro pro Stimme ausgegeben.
Auch die Vorfinanzierung des Wahlkampfes schöpfte Podemos direkt aus der Bevölkerung: Es gab Crowdfunding-Projekte und Mikrokredite, die bereits aus den eingegangenen Wahlsubventionen erstattet wurden. Durch den Verzicht auf Bank- oder Unternehmens-Kredite sollten Abhängigkeiten und Interessenskonflikte vermieden werden.

Vom Hacker zum Beauftragten für Bürgerbeteiligung
Auch auf der kommunalen Ebene gilt in vielen linksregierten Städten Spaniens inzwischen das Prinzip der Bürgerbeteiligung. Federführend ist hier die Hauptstadt Madrid mit ihren rund 3 Millionen Einwohnern. Einer, der dabei eine wichtige Rolle spielt, ist Pablo Soto, Mitte 30 und ehemaliger Hacker. Jetzt ist er Beauftragter für Bürgerbeteiligung der Stadt Madrid und hat sich entschieden, für kleines Geld die Stadt bei der Umsetzung der partizipativen Demokratie zu unterstützen. Gemeinsam mit seinem Team hat er die Plattform
Erhält ein Vorschlag von mindestens 2% der Einwohner Madrids (also von rund 60.000 Bürgern) Unterstützung, begutachtet eine Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung die Idee und es kommt zu einer zweiten und letzten Abstimmungsphase. Dieser Prozess dauert maximal 12 Monate. Spitzenreiter unter den Vorschlägen sind zur Zeit der benutzerfreundliche Metro-Pass und das Konzept »Madrid 100% nachhaltig«, das für autofreie Zonen und Tage, regenerative Energieversorgung sowie flächendeckende Fahrradwege und
»Auf einen Experten im Rathaus kommen Tausende auf der Straße.«
Pablo Soto ist davon überzeugt, dass sich diese Art der Direktdemokratie durchsetzen wird. Ein einzelner Politiker, sagt er, könne nicht Millionen von Menschen repräsentieren. Politiker hätten oft den Bezug zur Realität zum Leben auf der Straße verloren. Deshalb bräuchten sie das Feedback nicht nur durch Wahlen, sondern auch im Alltagsgeschäft. Die meisten Entscheidungen würden ja am Schreibtisch gefällt. »Auf einen Experten im Rathaus kommen doch Tausende da draußen auf der Straße«, sagt er. »Wir leben im 21. Jahrhundert und haben inzwischen alle Möglichkeiten, dieses Potenzial zu nutzen.« Die Zeit sei reif, betont der ehemalige Hacker. Jetzt, wo es endlich die technologischen Möglichkeiten gebe, all das Wissen zu bündeln.
Das klingt verlockend. Die Frage ist aber: Wird die Bürgerbeteiligung anhalten, wenn der Reiz des Neuen verblasst? Schließlich kostet Netzaktivität Zeit. Ein teures Gut. Haben wir soviel Zeit? Ein Blick nach Deutschland offenbart: Hier nutzen etwa 56 Millionen Menschen das Internet, die Hälfte davon täglich. Jugendliche verbringen täglich fast
Ein Blick in die sozialen Netzwerke zeigt allerdings auch, dass sich dort nicht nur kollektive Intelligenz, sondern auch kollektive Dummheit, also Schwarmdummheit ausdrückt. Die Frage ist also: Wie kann das eine genutzt und das andere unterbunden werden? Wie funktioniert der Schwarm?
Schwarmintelligenz nutzen, Schwarmdummheit vermeiden
Der Begriff Schwarmintelligenz kommt aus der Biologie und bezieht sich auf die Formationen von Zugvögeln oder die Arbeitsteilung von Ameisen, Bienen und Schwarmfischen. Die Schwarmintelligenz lässt große Gruppen koordiniert handeln. Fast so, als handele es sich um einen übergeordneten Super-Organismus. Sogenannte
Ernst Pöppel ist pensionierter Professor für Psychologie und Biologie, der sich viel mit dem Thema Schwarmintelligenz (und Schwarmdummheit) beschäftigt hat. In einem Experiment ließen er und seine Kollegen eine größere Gruppe von Menschen schätzen, wie schwer eine bestimmte Zeitung ist. »Die genannten Zahlen variierten sehr, doch der Mittelwert entsprach ziemlich genau dem tatsächlichen Gewicht.« Wenn unabhängiges Teilwissen zusammengeführt werde, könne so etwas wie Schwarmintelligenz entstehen.
Nicht jeder Schwarm liefert korrekte Informationen. Manchmal kommt es zu Gerüchten und falschen Behauptungen, absichtlich oder unabsichtlich. Im Netz können sich Meldungen ungefiltert in Windeseile verbreiten. Egal, ob es dabei um eine angebliche Zunahme von Flüchtlingszahlen oder ein

Zudem kann der Schwarm sich selbst lenken, sagt Schwarmforscher Jens Krause, Professor an der Humboldt-Universität in Berlin. »Wir haben uns damit beschäftigt, wie viele Individuen es braucht, um in einer Gruppe neue Richtungsimpulse zu setzen. Wir haben das auf großen Plätzen mit mehreren Hundert Menschen experimentell ausprobiert und es zeigte sich: Mit
Der Schwarm allein reicht nicht: Hauptakteure und Vielfalt
Podemos überlässt seinen Schwarm nicht sich selbst. Die Orts- und Themen-Gruppen erarbeiten Vorschläge, die dann von den Hauptakteuren aufgegriffen werden. Vor den Wahlen gab es etwa 80 Hauptberufliche, meist sehr junge Menschen, die in der Podemos-Zentrale in Madrid saßen. Dazu kamen bereits gewählte Abgeordnete im Europaparlament und in den Landesparlamenten. Seit den Wahlen wird die Erarbeitung und Strukturierung der Themen von den Mitarbeitern und Abgeordneten der Partei übernommen. Dazu kommen Bürger, die in den einzelnen Kreisen, auf der parteieigenen Plattform und in den sozialen Netzwerken besonders aktiv sind. Mit ihrer Hilfe wurde das Parteiprogramm
Eine Abteilung aus 19 Mitarbeitern betreut den Auftritt von Podemos im Netz. Diese zentrale Instanz kann eingreifen, wenn falsche Informationen gestreut werden, sogenannte Trolle ihr Unwesen treiben oder der Schwarm in eine andere Richtung zu schwimmen droht. So werden 2 Herausforderungen bewältigt: Jede Debatte erhält genügend Zeit, um die Intelligenz des Schwarms auch wirklich nutzen zu können und es gibt Hauptakteure, die den Prozess steuern.
»Wer aktiv ist, hat mehr zu sagen.«
Anfang Mai fand in Madrid ein
Jeder kann den Schwarm nutzen
Wer auf die Erfahrungen und das Wissen des Schwarms zugreifen will, muss kein Programmierer sein: Die isländische Non-Profit Organisation Citizens Foundation hat eine kostenlose Software für E-Demokratie entwickelt. Jeder, der die Beteiligung von Nachbarn, Bürgern, Mitarbeitern oder Mitgliedern fördern will, kann eine eigene Beteiligungs-Plattform einrichten. Städte und Gemeinden können sich von der Citizens Foundation dabei beraten lassen. In Estland wurden mithilfe des Tools aus Ideen von Bürgern bereits Gesetze. Eine Schule in Australien sammelt Verbesserungsvorschläge von Schülern und lässt sie bei der Verwendung des Budgets mitbestimmen. In Reykjavik konnten Nachbarschaftsvereine Vorschläge einbringen und die Verwendung öffentlicher Gelder beeinflussen. In England will das Nationale Gesundheitssystem (NHS) die medizinische Versorgung verbessern: Die Vorschläge von Bürgern, die das größte öffentliche Interesse erreichen, werden innerhalb der NHS weiter diskutiert und haben Chancen, umgesetzt zu werden.
Nach dem Wahlerfolg in Spanien im Dezember 2015 titelte Podemos auf ihrer Facebook-Seite: »Wenn viele Menschen sich zusammentun, entstehen außergewöhnliche Dinge«. Die ehemalige Protestpartei hat mithilfe des eigenen Schwarms das eingefahrene Zweiparteien-System in Spanien geknackt. In 3 Tagen wird sich zeigen, ob sie es mit dem neuen Koalitionspartner Izquierda Unida als Marke »Unidos Podemos« (»Vereint können wir«) in die Regierung schaffen wird.
Titelbild: (c) Gitti Müller