Warum auf allen Äckern Pilze wachsen sollten
Denn sie sind die wichtige Zutat für eine gesunde und günstige Ernährung – auch wenn du keine Pilze magst.
Sie wälzen stockfleckige Bestimmungsbücher, sezieren Frösche oder schließen sich tagelang im Labor ein: Biologen gelten als exzentrische Zeitgenossen. Während Blumen und Tiere als Interessengebiete weithin akzeptiert werden, stoßen Mykologen – Pilzforscher – mit ihrer Leidenschaft oft auf Unverständnis. Dabei gibt das Reich der Pilze immer wieder Faszinierendes preis. Hättest du zum Beispiel gewusst, dass
- der größte Organismus der Erde
- es Pilze gibt, die
- ein Pilz
Abgesehen von solchen Kuriositäten spielen Pilze in unser aller Leben eine Rolle. Ohne sie gäbe es weder Sojasauce oder Schokolade noch Käse oder Bier. Und als Basis für Antibiotika haben sie die Welt verändert.
Pilze sind unverzichtbar, auch wenn du keine Pilze magst.
Doch Pilze sind noch auf einer viel tieferen Ebene unverzichtbar für uns. Sie bilden eine Heerschar von Helfern, die seit Millionen von Jahren still und heimlich im Untergrund arbeiten, zu denen wir aber irgendwie den Draht verloren haben. Denn der Boden ist kein totes Substrat –
Und die interagieren nicht nur fleißig untereinander, sondern auch mit 90% aller Landpflanzen.
Diese Symbiose zu verstehen, könnte der Schlüssel zur Lösung einiger schwerwiegender Probleme in der Landwirtschaft sein.
Die 4 Krisen unserer Ackerböden
Dass die Landwirtschaft in Deutschland derzeit auf eine Krise zusteuert, ist dem ersten Anschein nach nicht zu erkennen. Schließlich sind die hiesigen Böden fruchtbar, das Klima gemäßigt und Krisen wie Hungersnöte sehr fern. Doch die Qualität der Böden hat sich in den vergangenen Jahrzehnten aus den folgenden Gründen spürbar verschlechtert:
- Das Wasser wird knapp: Durch den Wasserbedarf der Landwirtschaft sinkt auch in Deutschland der Grundwasserspiegel. Dadurch werden nicht nur Gewässer, sondern auch
- Das Klima wird unberechenbarer: Auch wenn Deutschland bisher von Naturkatastrophen wie Dürren und Überschwemmungen weitgehend verschont geblieben ist, nehmen auch bei uns Wetterextreme zu. Wind und Wasser verursachen Erosion und damit den Verlust von Bodenstruktur und Nährstoffen.
- Dünger schadet den Ökosystemen: Moderne Landwirtschaft bedeutet: große Mengen mineralischen Düngers.
- Gifte bleiben nicht auf den Feldern: Pflanzenschutzmittel landen nicht nur auf Feldern, sondern werden über Luft und Wasser auch darüber hinaus verbreitet. Sie sind vermutlich mitverantwortlich für

Dass es so auf Dauer nicht weitergehen kann, haben mittlerweile nicht nur die Umweltverbände und Bauern erkannt, sondern auch das
Doch wichtige Helfer für diese Strategie treten gerade erst ans Tageslicht: Es sind Pilze, die den Pflanzen durch Symbiose zum entscheidenden Vorteil verhelfen.
Das können Mykorrhiza-Pilze für Pflanzen leisten
Pilze kennt die Landwirtschaft vor allem als Schädlinge. Tatsächlich ernähren sich manche Pilzarten parasitisch von Pflanzen. Sie tun dies durch ihr
Willst du genauer wissen, wie die Pilze den Pflanzen helfen? Dann klicke hier!
- Nährstoffaufnahme: Hier spielen weitere Symbiosepartner wie Bakterien eine Rolle, welche die Pilzfäden mit einem Biofilm überziehen und zum Beispiel Phosphat aus dem Boden lösen können. Der Pilz kann also über die Bakterien mehr Nährstoffe für die Pflanze erschließen. Gleichzeitig überbrückt das Pilzgeflecht nährstoffarme Bereiche, die sich um die Wurzeln der Pflanze bilden, weil die Wurzeln schneller Phosphat aufnehmen, als aus der umliegenden Erde nachkommen kann.
- Wasseraufnahme: Zunächst einmal können die Pilzfäden ähnlich wie bei den Nährstoffen den Einzugsbereich der Pflanzenwurzeln erweitern und so Wasser aus tieferen Erdschichten erreichen. Sie sind quasi eine Verlängerung der Wurzeln. Die Pilzfäden sind feiner als die dünnsten Wurzelhärchen und wirken deshalb stärker gegen die
- Speicherung von Schadstoffen: Die Pilze speichern zum Beispiel Schwermetalle oder Umweltgifte, sodass diese sich nicht in der Pflanze ansammeln und deren Lebensfunktionen beeinträchtigen.
- Toleranz und Resistenz gegen Krankheitserreger: Pflanzen mit Mykorrhiza-Partnern werden weniger stark von Krankheitserregern beeinträchtigt. Dabei kann der symbiotische Pilz entweder die Resistenz der Pflanze erhöhen, sodass sie gar nicht erst von den Schadorganismen befallen wird. Oder er macht die Pflanze toleranter gegen die Schädigung. In diesem Fall besiedelt der Erreger zwar die Pflanze, diese wird aber weniger stark beeinflusst.
In perfekter Symbiose können Mykorrhiza-Pilze Pflanzen durch Stressphasen helfen, die bei Knappheit von Wasser oder Nährstoffen oder durch Krankheitserreger entstehen. So sind die Pflanzen besser für Herausforderungen ihrer Umwelt gewappnet, ohne dass mehr potenziell umweltschädigende Stoffe verwendet werden müssen – eine Win-Win-Situation für Pilz sowie Pflanze und ganz im Sinne des »integrierten Pflanzenschutzes«.
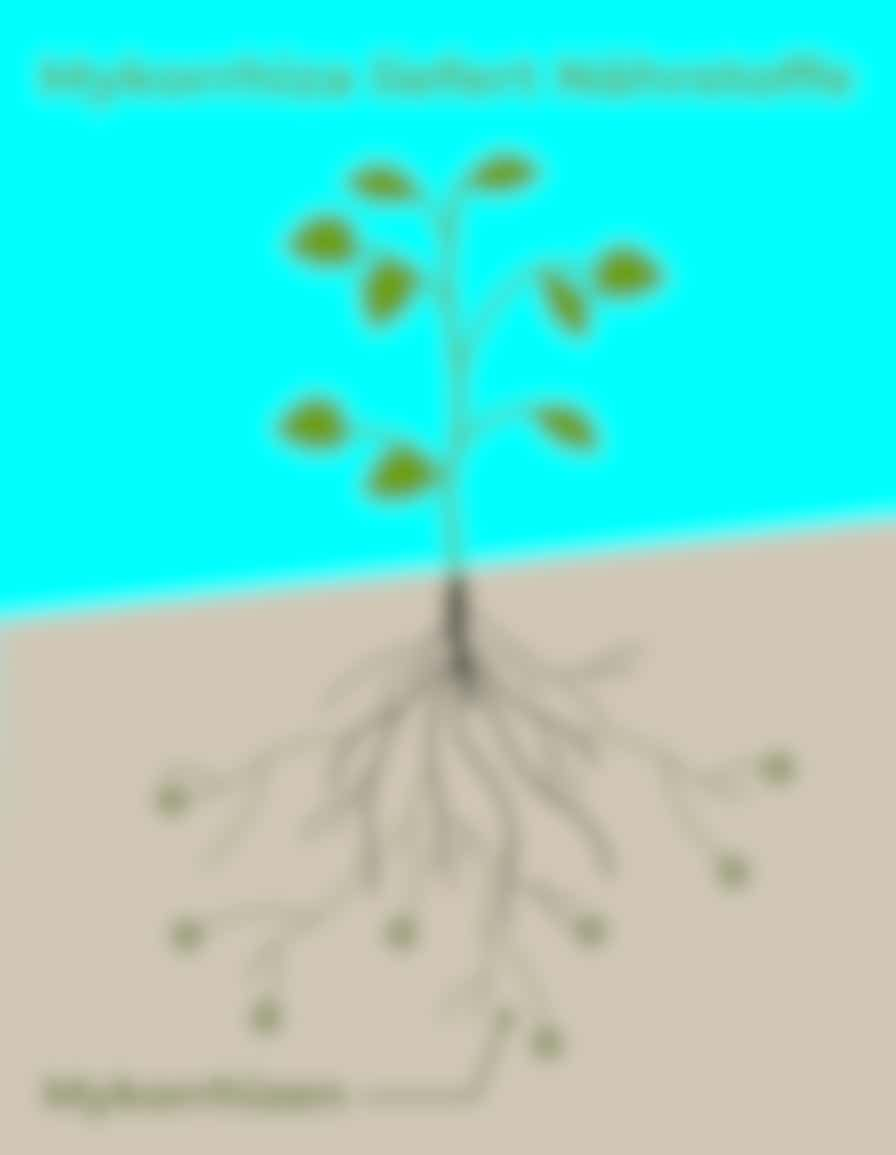
So machen wir den Pilzen die Arbeit schwer
Doch aktuell leiden die Mykorrhiza-Pilze noch unter den intensiven Anbaumethoden auf Ackerböden hierzulande. Tiefes Umpflügen der Felder zerstört das unterirdische Pilzgewebe. Das Gewicht großer Landmaschinen verdichtet den Boden und erschwert den Pilzen das Wachstum. Auch fanden Pilzforscher heraus, dass die Pilzvielfalt im Boden mit der Vielfalt der Pflanzen zusammenhängt. Intensive Anbaumethoden, Monokultur, Nährstoffflut – gute Pilze haben es nicht leicht
Anders gesagt: Die typische Monokultur schadet der so nützlichen
Dazu sind heutige Getreide und Gemüsepflanzen spezielle Züchtungen, die große Zugaben mineralischen Düngers in hohe Erträge umsetzen. Im Boden herrscht ein Überangebot von Nährstoffen, sodass diese
Wie genau es momentan um die Pilzvielfalt in Deutschland bestellt ist,
Können wir die Pilze nicht wieder in den Boden pumpen?
Große Konzerne wie
Philipp Franken vom Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau betont, dass es nicht in erster Linie darum gehe, den einen Superorganismus zu finden: »Das ist genau wie in unserem Darm: Wir brauchen nicht nur einzelne Mikroorganismen, sondern eine stabile Gemeinschaft.« Nach diesem Prinzip gehen er und seine Kollegen biologische Schädlingsbekämpfung ganz neu an.
Wir wollen möglichst viele Mikroorganismen in ihrem Wachstum fördern und so eine stabile Mikroorganismen-Gemeinschaft schaffen, in der ein einzelner
Dafür beobachtet Frankens Team im Labor, wie verschiedene Mikroorganismen miteinander interagieren und welche von ihnen die im Boden vorhandene Gemeinschaft stabilisieren und die Diversität noch erhöhen können. Um die Pflanzen und ihre neuen Unterstützer auf dem Acker zusammenzubringen, verwenden die Wissenschaftler 2 unterschiedliche Methoden:

- Inokulation: Der Ackerboden wird mit Pilzsporen und anderen Mikroorganismen mithilfe einer Flüssigkeit, dem Inokulum, beimpft.
- Seed Coating: Das Saatgut wird direkt mit der Sporen-Suspension ummantelt. Diese Behandlung ist gezielter auf die einzelne Pflanze ausgerichtet, dadurch effizienter und kostengünstiger.
So behandelte Pflanzen nehmen Nährstoffe besser auf, wachsen schneller,
Und wieso sind Pilze dann nicht längst die »Allstars« der Landwirtschaft?
Die nächste grüne Revolution steht in den Startlöchern
Viele Unternehmen bieten bereits heute wirksame Pilzpräparate an, vor allem als Starthilfe für Jungpflanzen. Doch die von Wissenschaftlern wie Philipp Franken entwickelten Methoden sind aktuell noch sehr teuer und damit uninteressant für den Anbau im großen Stil. Aber das könnte sich schnell ändern. Und zwar so:
- Steigendes Kosten-Nutzen-Verhältnis: Die Entwicklung neuer Pilzpräparate macht schnell Fortschritte. Dazu steigt durch den Preis von Phosphatdünger auch der Preis der herkömmlichen Landwirtschaft – Alternativen werden immer attraktiver.
- Neue Technologien: Ein weiterer Trend der modernen Landwirtschaft spielt den Pilzen in die Hand: die »Precision Agriculture«. Dabei erfassen Landwirte mit neuen Technologien die unterschiedlichen
- Politische Förderung: Auch die Politik hat erkannt, dass Mykorrhiza-Pilze nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich sein können. So werden Pilzsymbiosen im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft als Bestandteil einer
»Mykorrhiza-Pilze sind nicht der Stein der Weisen – aber sie können Bestandteil einer integrierten Landwirtschaft sein.« – Philipp Franken, Pilzforscher
- Wachsender Bedarf: Auch andere Regionen der Erde zeigen großes Interesse an den nützlichen Pilzen. Zu Pilzforschern wie Philipp Franken kommen beispielsweise Studierende aus der Subsahara-Zone, wo es besonders große Probleme mit Phosphatmangel gibt.
Pilze und andere Bodenorganismen könnten also in naher Zukunft einige unserer Landwirtschaft-Probleme lösen – wenn auch nicht alle und sofort. Sie sind vielmehr ein Puzzleteil beim Umdenken auf unseren Feldern.

Titelbild: Monique Laats - CC BY-NC-ND 2.0

