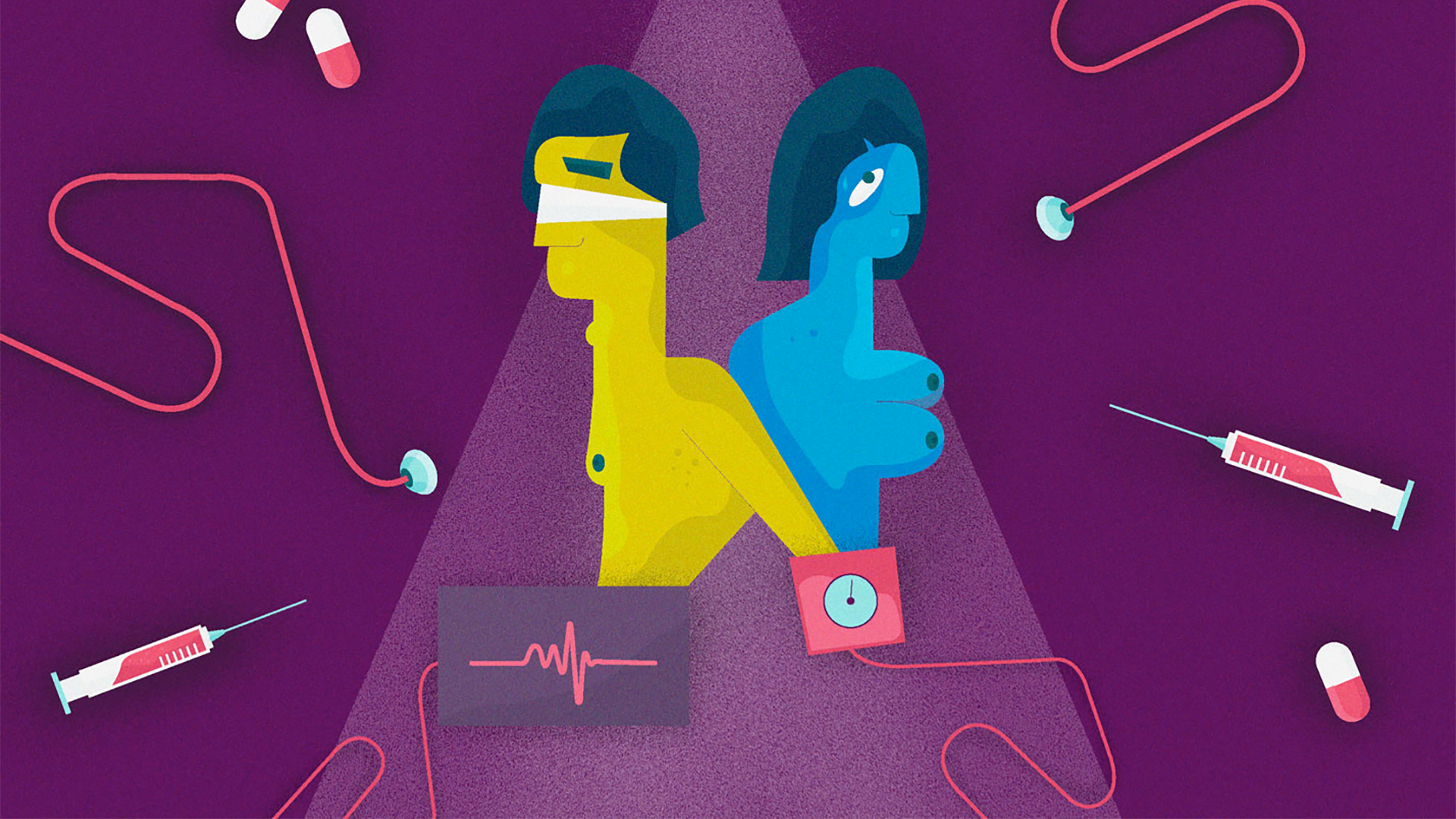Krebsvorsorge rettet Leben. Trotzdem sollte sie nicht jeder bekommen
Denn die Vorsorge kann mehr Schaden anrichten als der Krebs selbst. Nach diesem Text weißt du, welche Untersuchungen du wirklich brauchst.
»Guck mal da! Irgendwas schimmert komisch an deinem Scheitel«, entfährt es meiner Verlobten, als wir abends gemütlich vor dem Fernseher sitzen. Nun ist es also so weit, mein erstes graues Haar ist da. Mit meinen 29 Jahren habe ich schon öfter gedacht: Die Tage, an denen ich »voll im Saft« stehe, sind allmählich gezählt.
Das merke ich auch an den Rückenproblemen, der Denkerfalte und den fiesen Kopfschmerzen, die sich inzwischen schon nach ein paar Bierchen einstellen. Ist an dem Spruch »Ab 30 geht es endgültig bergab«
Ich bin verunsichert: Bin ich kurz vor Ende meines dritten Lebensjahrzehnts rundum gesund und meine Beschwerden sind nur harmloser Schwund?
»Krebsvorsorge ist wichtig!« Wer würde da widersprechen?
An sich ist mein Lebenswandel kein ungesunder: Ich bewege mich, so viel es geht, koche selbst und scheue dabei auch nicht vor Gemüse zurück und gönne mir mal eine Auszeit. Muss ich noch auf mehr achten?
Das muss sich doch herausfinden lassen! Nach einer kurzen Recherche im Netz stoße ich auf ein breites Angebot an Vorsorge-Untersuchungen, die mich hauptsächlich vor einer Krankheit schützen sollen, vor der auch sportliche und saubere Landluft atmende Asketen nicht zu 100% gefeit sind: Krebs.
Ich spüre ein merkwürdiges Unbehagen in mir aufsteigen. Doch zum Glück kann ich scheinbar einfach einen Arzttermin machen, und schon habe ich Sicherheit. Prävention kann ja sicher nicht schaden, denke ich mir. Oder etwa doch?
»Vorsorgen« muss jeder für sich selbst
Vorsorge ist besser als Nachsorge, das denken sich viele – und so kommen in Deutschland Jahr für Jahr Millionen gesunde Menschen mit Ärzten in Kontakt. Das klingt nach einer vernünftigen Entwicklung.

Allerdings gehen viele mit falschen Vorstellungen an die Sache heran. »Wir am Lehrstuhl hören das Wort Vorsorge überhaupt nicht gern« weist mich Thomas Kühlein, Leiter des Lehrstuhls für Allgemeinmedizin in Erlangen, direkt am Anfang unseres Gesprächs zurecht. Der Grund: »Manche Menschen entwickeln durch diese Untersuchungen eine Hoffnung wie ›Wenn ich immer brav in die Kirche gehe, komme ich auch in den Himmel.‹ Die Untersuchung selbst bewahrt einen aber nicht davor, Krebs zu bekommen.«
Gut, wenn man genauer darüber nachdenkt, leuchtet das ein. Ob ich rauche oder mich meiner Schwäche für Frittiertes hingebe – dafür bin ich ganz allein verantwortlich.
Dann also zur Früherkennung – denn trotz aller eigenen Entscheidungen kann man ja nie so genau wissen. Und durch diese Untersuchungen kann, sollte sich doch etwas falsch entwickeln, früh eingegriffen werden. Die Idee dahinter: Je früher Krebs erkannt wird, desto besser ist er heilbar. So werden Leiden reduziert, Leben gerettet und obendrein Kosten für Behandlungen gespart. Alles gute Gründe, derentwegen Krankenkassen die Kosten für einige Untersuchungen übernehmen.
So sind im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von empfohlenen Früherkennungs-Untersuchungen zusammengekommen, von denen
Geschlechtsunabhängig:
- Ab 35 Jahren alle 2 Jahre: Hautkrebs-Screening
- Ab 50 Jahren jährlich: Darmkrebs-Früherkennung
Für Frauen:
- Ab 20 Jahren jährlich: Gebärmutterhalskrebs-Früherkennung
- Ab 30 Jahren jährlich: Brustkrebs-Früherkennung
- Ab 50 Jahren alle 2 Jahre: Mammografie-Screening
Für Männer:
- Ab 45 Jahren jährlich: Prostatakrebs-Früherkennung
Prognosen sind ein schwieriges Unterfangen – besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
So weit die Theorie. In der Praxis bedeutet Früherkennung aber zunächst einmal, Medizin mit Gesunden zu betreiben. »Dazu gibt es ein freches altes Sprichwort: ›Ein gesunder Patient ist nur schlecht untersucht.‹ Da ist aber viel Wahres dran«, erläutert Thomas Kühlein, besonders wenn es um Krebs geht. »Hier lassen sich diverse Frühformen finden. Die führen aber nicht zwingend zu Krebs. Und wenn doch, dann ist dieser auch nicht zwangsläufig tödlich.«
Das betrifft besonders die Krebsarten, die geschlechtsspezifisch sind:
Sorgenfrei dank Brustkrebs-Screening?
Ladies first, fangen wir mit der Brustkrebs-Vorsorge an: Das Brustkrebs-Screening per
Diese betreffen besonders
Bei regelmäßiger Teilnahme ließe sich die Sterblichkeit durch Brustkrebs so um 20–30% reduzieren, ist in vielen Aufklärungsbroschüren zu lesen, die bei Gynäkologen im Wartezimmer liegen. Das klingt beeindruckend.
Aber was steckt wirklich dahinter?
Das zeigt diese Übersicht:







Die Schaubilder machen deutlich: Für 999 von 1.000 Frauen ist das Brustkrebs-Screening mindestens sinnlos – wenn nicht kontraproduktiv. »Die Frauen, die trotzdem sterben, haben leider eine Form von Krebs, die so rasant wächst, dass wir ihn mit der Früherkennung nicht erwischen«, erläutert Thomas Kühlein. Den Krebs früh zu erkennen, hat also nur einen begrenzten Nutzen.
Trotzdem wird statistisch alle 10 Jahre einer von 1.000 Patientinnen das Leben gerettet, womit Aufwand und Kosten
- »Falschpositive Befunde«: Auf die eine Patientin, die innerhalb eines 10-Jahres-Zeitraums profitiert, kommt es in derselben Zeit bei 100 Frauen zu Verdachtsfällen. Und die lassen sich erst durch weitere, teils schmerzhafte Untersuchungen wie das Entnehmen von Gewebeproben entkräften.
Schon der Verdachtsfall löst bei Patienten extreme psychische Belastungen aus.
- Psychische Belastung für Gesunde: Allein ein »Verdacht auf Krebs« erschüttert zwangsläufig bis ins Mark. Und hinterlässt damit auch in der Psyche seine Spuren. »Man kann sich vorstellen, dass keine Frau, die so etwas durchgemacht hat, ihre Brüste je wieder ansehen kann, ohne zu denken ›Was schlummert da noch in mir?‹«, schildert Thomas Kühlein das Dilemma des Brustkrebs-Screenings.
- Gefahr durch »Übertherapierung«: Schlimmer als ein sich nicht bestätigender Verdacht ist eine unnötige Behandlung, etwa per Chemotherapie. Denn es ist nicht sicher festzustellen, ob es sich bei einem Fund um einen
Betrachtet man diese Wahrscheinlichkeiten, ist fraglich, ob der Nutzen die Risiken und möglichen Schäden tatsächlich überwiegt.

Ob die Statistik für die Früherkennung des männerspezifischen Prostatakrebses besser abschneidet?
Angst um das beste Stück? Die Prostatakrebs-Vorsorge
Zurück zu meiner kleinen Kurz-vor-30-Krise: Ich frage mich, wie es um Früherkennung von »Männer-Krebs« in den sensibelsten Körperregionen steht. Lohnt sich das?
Ich bin in jedem Fall zu früh dran: Ab 45 haben Männer Anspruch darauf, sich per
Viele sterben nicht an Prostatakrebs, sondern mit ihm.
Vorteil daran: Das kann auch der Hausarzt einfach und vor allem nebenwirkungsfrei erledigen. Nachteil: Nur oberflächliche Tumore ab 1 Zentimeter Größe, also schon ziemlich weit fortgeschrittene, können so entdeckt werden. Wird etwas ertastet, muss es aber nicht direkt ein Tumor sein. Genau wie beim Brustkrebs ist die psychische Belastung durch einen Verdacht aber trotzdem gegeben.
Genau wegen dieser Schwächen bieten viele Urologen einen sogenannten PSA-Test an. Hier wird das Blut auf ein spezifisches Antigen untersucht, das fast ausschließlich in der Prostata gebildet wird und bei gesunden Menschen nur in sehr geringer Menge vorkommt. Wird mehr davon gefunden, kann das auf Krebs hinweisen. Ebenso gut kann der erhöhte Wert aber auch durch eine gutartige Vergrößerung oder eine Entzündung verursacht sein. Auch vorheriger Geschlechtsverkehr oder körperliche Anstrengung können ihn positiv ausfallen lassen.
Angesichts dieser Fehleranfälligkeit hat der
Lautet die Diagnose Krebs, muss man schon sehr starke Nerven haben, um erst einmal abzuwarten.
Generell tritt Prostatakrebs
Dabei ist er sich darüber bewusst, dass man der Diagnose Prostatakrebs zuerst die Stirn bieten muss. »Natürlich rutscht einem da erst mal der Tod ins Bewusstsein.«
Spricht mein Arzt Statistik?
In einer solchen Extremsituation trägt der behandelnde Arzt eine immense Verantwortung, denn eine emotionale Reaktion des geschockten Patienten ist unausweichlich. »Ich als Arzt muss dann als der, der nicht bedroht ist, versuchen, das rationale Korrektiv zu sein«, erklärt Thomas Kühlein. So müssen Ärzte zum Beispiel darüber aufklären, dass bei einem Fund häufig vorsorglich die ganze Prostata entfernt wird, was in sehr vielen Fällen dauerhafte
In der Situation der Bedrohung ist jeder Mensch erst mal irrational.
Um aber richtig aufklären zu können, muss man die Zahlen und Statistiken kennen – und sie richtig verstehen. Das Problem: Weil das Medizinstudium nur wenig Statistik vorsieht, ist das für die meisten Ärzte keine Selbstverständlichkeit.
Was für Ärzte gültig ist, trifft erst recht auf die meisten Patienten zu: »Wenn man Menschen genug Angst macht und sagt: ›Oh Gott, du könntest sterben, und dann könnte es auch noch Krebs sein!‹, dann ist man rationalen Argumenten und nüchternen Zahlen verständlicherweise nicht mehr zugänglich«, so Thomas Kühlein.
Hier liegt ein zentrales Problem im Umgang mit dieser Erkrankung: Krebs ist nach wie vor ein Tabuthema in unserer Gesellschaft,

Eine für jedermann verständliche Aufklärung ist ein zentrales Element eines Gesundheitssystems, das dem Krebs seinen Schrecken nehmen kann.
Was ich nicht weiß, macht mich nicht krank?
Also, umsonst Sorgen gemacht? Wahrscheinlich schon. Das heißt aber nicht, dass Früherkennungs-Untersuchungen pauschal sinnlos sind. Stattdessen lohnt es sich, sich genau zu informieren und zwischen unnützer und sinnvoller Früherkennung zu unterscheiden. Ob eine Untersuchung Sinn ergibt, hängt vor allem von 2 Faktoren ab:
- Flächendeckende Vorsorge-Untersuchungen für Gesunde sind nicht der richtige Weg. In Sachen Brust- und Prostatakrebs drängen so unnötige Ängste in den Alltag, die durch Fehldiagnosen noch gesteigert werden. Deswegen setzt sich eine Erkenntnis unter Medizinern mehr und mehr durch: »Der Trend ist, dass man nicht mehr den großen Früherkennungs-Rechen durch die gesamte Bevölkerung zieht«, sagt Thomas Kühlein. Wesentlich bessere Resultate erreiche man, wenn man Risikogruppen, zum Beispiel mit familiärer Vorbelastung, gezielt identifiziert und engmaschig betreut.
- Es gibt Früherkennungs-Untersuchungen, deren Nutzen zwar umstritten ist, die aber zumindest keinen Schaden anrichten. »Diese Untersuchungen sind zwar lästig, aber weitgehend gefahrlos«, sagt Thomas Kühlein. Dazu zählt vor allem die Darmkrebs-Früherkennung, da bei dieser Frühformen wie Polypen unmittelbar und ohne Nachteile entfernt werden können. Auch der Nutzen der Hautkrebs-Früherkennung ist mehr als umstritten und in der Regelmäßigkeit wie in Deutschland international einzigartig. Auch hier gilt: Der Patient profitiert meist nicht, Schaden erleidet er aber ebensowenig.
Kurz: Angst ist beim Thema Krebs-Früherkennung ein schlechter Ratgeber. Patienten wie Ärzte müssen Nutzen und Risiken von Medizin an gesunden Menschen sorgsam abwägen – ganz ohne ein grobes Verständnis von Statistik wird es dabei kaum gehen. Nur so können wir den Segen der modernen Medizin sinnvoll nutzen, ohne in einen ständigen Kontroll- und Selbstoptimierungszwang zu verfallen.
Ich jedenfalls lasse mir bis zu meiner ersten Prostata-Untersuchung noch eine Menge Zeit.
Dieser Text ist Teil einer Themenreihe bei Perspective Daily: Wir wollen darüber sprechen, was Krebs und andere schwere Krankheiten mit einem Menschen machen, wie Therapien ablaufen und wie die Betroffenen damit umgehen. Wir möchten auch euch einladen, uns eure Erfahrungen, Ängste und Hoffnungen mitzuteilen. Lasst uns gemeinsam über Krebs sprechen, um ihm so einen Teil seines Schreckens zu nehmen!
Titelbild: Tobias Kaiser - copyright