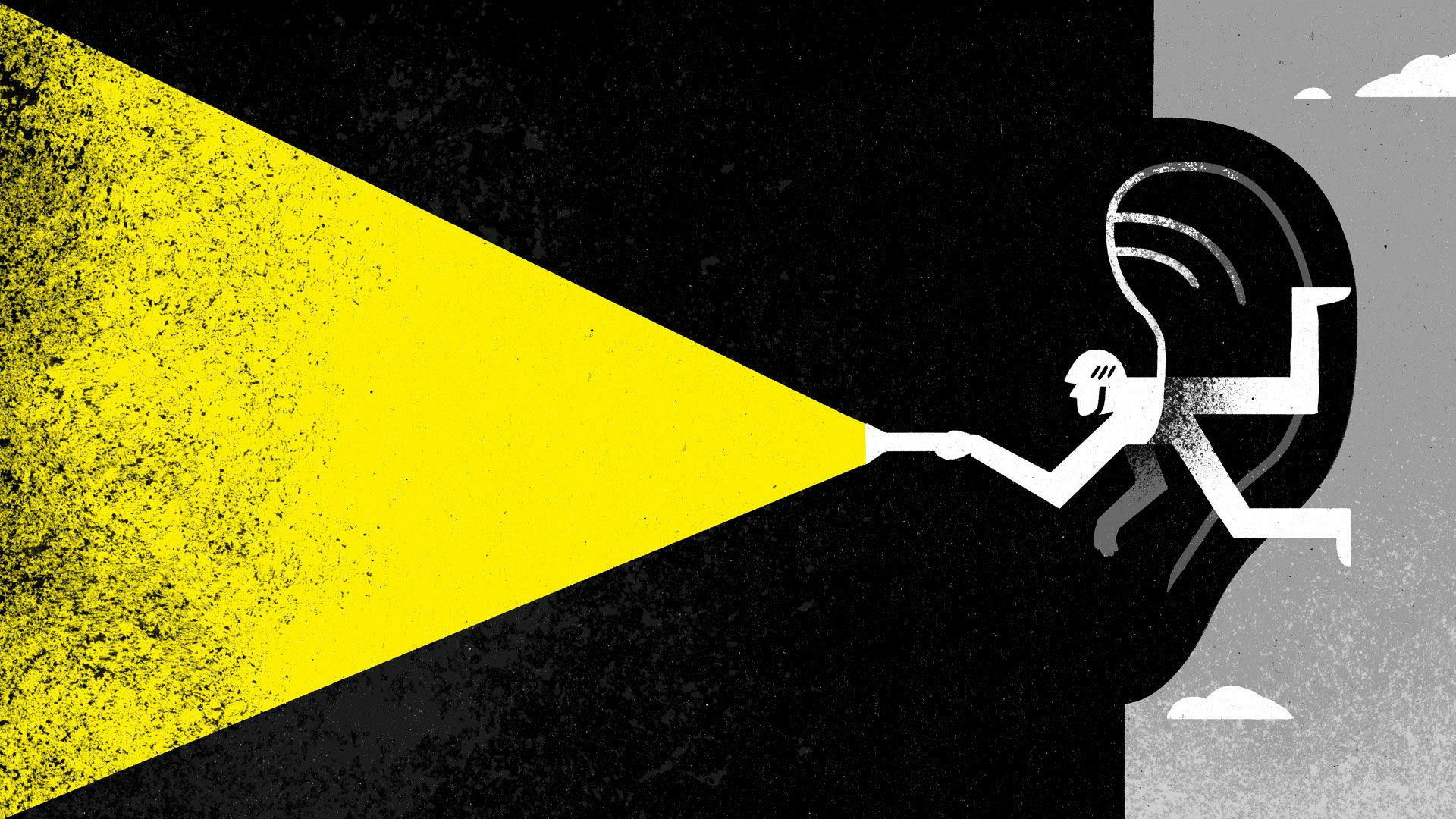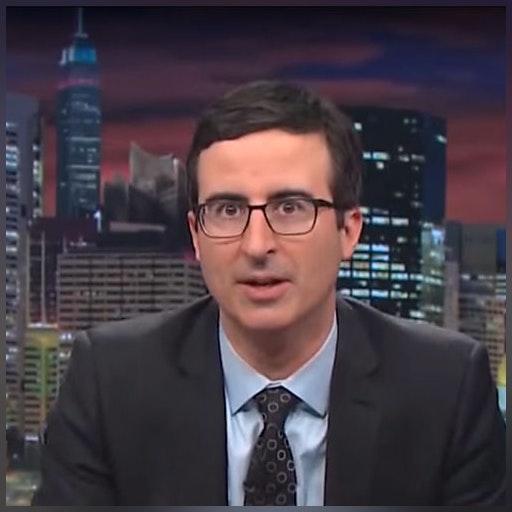Fakten, Fakten, Fakten? Nein!
Eine Reise durch den Kopf des »Klimaskeptikers«. Grubenlampe in die Hand und los geht’s.
Die Fakten liegen auf dem Tisch:
Generell sind »Klimaskeptiker« nicht alle einer Meinung: Einige behaupten, es gäbe keine Erderwärmung, andere behaupten, die Veränderungen seien vollständig auf natürliche Schwankungen und Ursachen zurückzuführen. Wieder andere halten die bevorstehenden Veränderungen für harmlos, sodass wir uns sehr einfach anpassen könnten. Eine Frage, die sich unweigerlich aufdrängt: Was muss passieren, um die »Skeptiker« zu überzeugen? Würden 100% der Wissenschaftler ausreichen?
Um diese Frage zu beantworten, machen wir uns auf die Reise in den Kopf des Klimaskeptikers. Die Grubenlampe in der Hand geht es durch die linke Ohrmuschel und den Gehörgang in Richtung Gehirn.
Die wohl häufigste Antwort auf die Frage, ob 100% reichen würden: Wenn wir auch dem letzten »Skeptiker« die eindeutigen Zahlen mitteilen – im Zweifel immer und immer wieder –
Das Versagen weitläufig verfügbarer, überzeugender Forschung, die anhaltende kulturelle Kontroverse zu den grundlegenden Fakten des Klimawandels verstummen zu lassen, ist das spektakulärste Scheitern von Wissenschaftskommunikation unserer Zeit.
Warum würde es nicht einmal helfen, wenn sich
Warum die 97%-Botschaft nicht funktioniert
Dan Kahan ist Juraprofessor in Harvard und setzt sich seit Jahren dafür ein, bessere Methoden zur Kommunikation über den Klimawandel anzuwenden. Er hat eine Erklärung dafür,

Gemeinsam mit Dan Kahan machen wir uns also auf die Reise in die Tiefen des »Klimaskeptiker«-Gehirns. Munter laufen wir los und wühlen uns durch die Hirnwindungen. Die Fakten stapeln sich rechts und links, Schubladen türmen sich, deren Ordnung uns nicht immer ersichtlich ist. Als ob jemand lauter rechte Socken verknotet hätte.
Logischer Startpunkt für die Analyse, warum die 97%-Botschaft nicht die gewünschte Wirkung hat: Die öffentliche Meinung darüber, was Klimawissenschaftler denken. Tatsächlich gibt es dabei keinen Unterschied zwischen »Klimaskeptikern« und Menschen,
Nicht das, was du nicht weißt, bringt dich in Schwierigkeiten – sondern das, was du sicher weißt und nicht der Fall ist.
Auch wenn es um »falsches Wissen« geht, unterscheiden sich die Gruppen nicht: So glaubt die Mehrheit aller Befragten fälschlicherweise, dass Klimawissenschaftler eine Verbindung zwischen Klimawandel und einem erhöhten Hautkrebsrisiko sehen. Ebenso unterstellt die Mehrheit den Klimaforschern den Glauben an einen Zusammenhang zwischen erhöhtem CO2-Gehalt in der Atmosphäre und geringerer Fotosynthese. Beide Aussagen sind falsch – und spiegeln nicht die Überzeugung der Klimawissenschaftler wider.
Der entscheidende Punkt ist: Trotz identischer Kenntnis und Unkenntnis der Fakten glaubt nur jeder vierte »konservative« Befragte an den menschengemachten Klimawandel, während der Prozentsatz bei den »liberalen« Befragten sehr dicht an 75% liegt – also dem gleichen Anteil, der die Überzeugung vom Klimawissenschaftlern zu CO2 und Erderwärmung richtig einschätzt.
Mit anderen Worten: Beide Gruppen haben das gleiche Bild davon, was Klimawissenschaftler bezüglich der Gefahren des Klimawandels glauben. Beide haben verstanden, dass Klimawissenschaftler davon überzeugt sind, dass wir handeln müssen, um katastrophale Folgen durch den Klimawandel zu verhindern. Der einzige Unterschied zwischen den beiden Gruppen: Die persönliche Einschätzung, ob es einen menschengemachten Klimawandel gibt.
Wichtig ist dabei: Dieser Unterschied hat nichts mit dem Wissen der Befragten zu tun. Die, die am besten Bescheid wissen und beispielsweise Klimawissenschaftlern nicht den Glauben an einen Zusammenhang zwischen Hautkrebs und CO2-Konzentration unterstellen, zeigen die gleiche Uneinigkeit bei der Frage, ob der menschengemachte Klimawandel existiert.
»Na dann liegt es doch bestimmt daran, dass die Zweifler den Klimaforschern
Egal, ob aus mangelndem Vertrauen oder anderen Gründen, wir landen bei der Frage: Warum glauben die »Klimaskeptiker« den Klimawissenschaftlern nicht?
Um das herauszufinden, müssen wir uns noch weiter vorarbeiten im Kopf des »Klimaskeptikers«. Der Weg wird mühsamer, weil die Ordnung deutlich nachlässt. Was erwartet uns wohl hinter der nächsten Gehirnwindung?
Warum ist das Widerlegen von »Fakten« so schwierig?
Den »Klimaskeptikern« fällt es so schwer, den Wissenschaftlern zu glauben, weil es so schwierig ist, fehlerhafte Annahmen zu widerlegen, wenn diese sich einmal in den Köpfen festgesetzt haben. Das wiederum hat vor allem 3 Gründe:
- Faktenbasiertes Argumentieren hilft nicht – und macht die Situation häufig noch schlimmer. Neben der Diskussion zum Klimawandel ist der vermeintliche Zusammenhang zwischen
Schuld an diesem Phänomen sind vor allem 2 Eigenschaften der menschlichen Psyche: Der
Hinzu kommt der
Je ideologisch aufgeladener und emotionaler eine Thematik, desto stärker ist der Effekt – und umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht von unserem Irrglauben abrücken, egal was dagegenspricht. Bezogen auf das Impfbeispiel bedeutet das: Selbst nachdem die Ergebnisse der ursprünglichen Studie von 1998 zum Zusammenhang zwischen Autismus und Impfungen aufgrund - Das Wiederholen verstärkt Mythen: Wird eine Falschaussage 1 Mal genannt, glauben knapp 30% daran;
- Wir brauchen Geschichten: Wir Menschen haben uns schon immer Geschichten erzählt, ob am Lagerfeuer in der Höhle oder im Blockbuster im 3D-Kino. Bei Journalisten heißt das neudeutsch Storytelling und ist der Grund, warum in Artikeln bestimmte Protagonisten auftauchen – selbst wenn es um eher theoretische Themen geht.
Wie gern wir selbst in einfache geometrische Formen ganze Liebesgeschichten hineininterpretieren, zeigt die Studie der amerikanischen Psychologen Fritz Heider und Marianne Simmel von 1944:

Endlich erkennen wir die Umrisse und treten näher. Wir sind im limbischen System angekommen und in der Amygdala tanzen die Neuronen, tauschen die Geschichten des Tages am Lagerfeuer aus. Schnell wird klar: Im Zentrum der Emotionen ist immer was los.
Als wäre die Herausforderung, diese 3 Punkte zu überwinden, nicht schon groß genug, kommt eine Sache erschwerend hinzu: Die 2 Dimensionen des Klimawandels.
Die Schizophrenie der Klimaskeptiker
Die beiden Dimensionen zeigt ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Schon heute werden Landwirte weltweit Tag für Tag Zeugen davon, dass der Klimawandel uns und unsere Lebensmittelproduktion verändert. Dennoch legen einige Landwirte bei der Frage nach dem Klimawandel ein paradoxes Verhalten an den Tag, das sich eigentlich nur damit erklären ließe, dass es
Nachdem wir es uns am Lagerfeuer mit den Emotionen gemütlich gemacht haben, fällt es uns wie Schuppen von den Augen: Die Emotionen müssen zu den Schubladen gelassen werden – vorbei am Türsteher und rein in die kühle Atmosphäre der Informationen und vermeintlichen Fakten.
Die 2 Dimensionen oder Lesarten des Klimawandels lassen sich vielleicht so zusammenfassen: Emotional und pragmatisch.
- Emotional: Das ist der Klimawandel, an den wir glauben – oder eben nicht, sozusagen die »emotionalisierte Erderwärmung«. Dabei spielt die Identifikation mit einer kulturellen Gruppe, zum Beispiel einer politischen Partei, eine wichtige Rolle. Dan Kahan spricht auch von »Stammesloyalitäten«.
- Pragmatisch: Das ist der Klimawandel, der uns zum Handeln veranlasst, sei es in der Rolle als Landwirt, Politiker oder Verbraucher.
Wie kann es gelingen, beide Dimensionen des Klimawandels zu einem Konzept, das auf den besten aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Daten begründet ist, zu verschmelzen? Und wie kann in den Köpfen der selbsternannten »Klimaskeptiker« die Erkenntnis reifen, dass sie sich in ihrem Verhalten längst zur pragmatischen Dimension des Klimawandels bekennen?
Aus 2 mach 1: Mit Mythen aufräumen
Klimawissenschaftler aktualisieren Klimamodelle ständig, weil wissenschaftliche Erkenntnisse immer im Fluss sind – und keine in Stein gemeißelten Dogmen. Wissenschaftskommunikation ist auch eine Wissenschaft. Das vergangene Jahrzehnt hat gezeigt: Die 97%-Botschaft hilft nicht dabei, die »Klimaskeptiker« von ihren Mythen zu befreien. Also müssen auch hier die Modelle angepasst werden, basierend auf neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dieses Mal nicht aus der Klimaforschung, sondern aus der Psychologie. Sonst sei die Wissenschaft der Wissenschaftskommunikation wenig wissenschaftlich, fasst Dan Kahan die Lage zusammen und fordert: Um die konstruktive, kollektive Entscheidungsfindung angesichts des Klimawandels voranzutreiben, müsse die Kommunikation wissenschaftlicher Daten von den »toxischen Effekten« der oben beschriebenen emotionalisierten Erderwärmung bereinigt werden.
Wie geht das?
Die Nachricht verändern: Anstatt die 97%-Botschaft auf allen Kanälen zu widerholen, müssen wir die Frage stellen: »Was sollten wir tun, angesichts dessen, was wir wissen?« Diese Frage unterscheidet sich von der Frage, die bei der 97%-Botschaft mitschwingt: »Wer bist du und auf wessen Seite stehst du?« Wir müssen die »Stammesloyalitäten« von der Nachricht lösen und stattdessen kommunizieren: Dein Wohlergehen und das der Menschen, die dir wichtig sind, hängt davon ab, vernünftig zu handeln. Also auf Basis der besten aktuell verfügbaren wissenschaftlichen Daten.
Dafür brauchen wir
Mythen erfolgreich widerlegen: Unsere Psyche (inklusive Bestätigungsfehler und Bumerang-Effekt) macht es uns nicht leicht, aber mittlerweile haben zahlreiche Wissenschaftler einige gute Hinweise darauf, was beim Widerlegen von Falschwissen hilft. Unser Gehirn verarbeitet Informationen nicht wie eine Festplatte, auf der Daten geordnet abgespeichert werden.
- (Selbst-)Bestätigung hilft: Statt dem Klimaskeptiker – oder Impfgegner – zu sagen »Du bist verrückt!«, hilft es, mit einem Kompliment an das Gegenüber zu beginnen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die korrigierte Information ins eigene Weltbild integriert wird. Gleiches gilt für eine kurze Selbstbestätigung: Wenn wir unser Gegenüber bitten, zunächst ein paar Sätze von einem Zeitpunkt aufzuschreiben, an dem sie mit sich selbst zufrieden waren, sind sie
- Mythen nicht wiederholen: Werden Falschinformationen und Gerüchte wiederholt, werden sie geläufiger und prägen sich besser ein; besonders, wenn sie unsere bisherige Weltsicht ins Wanken bringen. Wie aber können wir Falschinformationen richtigstellen, ohne sie zu nennen? Wenn möglich, sollten wir uns auf die richtigen Informationen konzentrieren, ohne den Mythos oder das Gerücht selbst zu nennen. Das ist aber nicht immer möglich. Wenn wir die Falschinformation gezwungenermaßen nennen müssen, um sie zu widerlegen, gilt trotzdem: Der Fokus sollte auf den zu vermittelnden Fakten liegen – nicht dem Gerücht. Es lohnt sich auch, mit ihnen zu beginnen. Nur so werden die richtigen Informationen im Gedächtnis verstärkt.
- Manchmal ist weniger mehr: Das gilt zumindest für die Überzeugungsarbeit. Ihr Erfolg steigt nicht mit der Anzahl der Gegenargumente: Der Erfolg kann zum Beispiel größer sein, wenn
- Aufdecken ist nicht genug … – es braucht ein glaubwürdiges und überzeugendes Gegennarrativ. Für jede Information – egal ob falsch oder richtig – erstellen wir ein mentales Bild in unserem Gehirn. Wird ein Gerücht beseitigt, entsteht also eine Lücke, die gefüllt werden will. Gibt es keinen Lückenfüller in Form einer besseren Erklärung, tendieren wir dazu, die Lücke mit Falschinformationen zu füllen.
Kurz gesagt: Wenn wir unser Gegenüber von einem Mythos befreien wollen, müssen wir eine überzeugende, alternative Erklärung parat haben, die die Lücke besetzen soll. Die kann sich zum Beispiel damit beschäftigen, warum ein Gerücht falsch ist (Herauspicken von Informationen, »falsche« Experten etc.) oder warum ein Gerücht verbreitet wird (Zuverlässigkeit der Quelle). Außerdem helfen explizite Warnungen, um Falschinformationen zu widerlegen. Das bedeutet, bevor eine Falschinformation genannt wird, sollte diese als solche kenntlich gemacht werden:
So sind wir am rechten Ohr angekommen und verlassen den Kopf des »Klimaskeptikers« auf ähnlichem Wege, wie wir ihn betreten haben. Ein wenig erschöpft, aber ein gutes Stück weiser: Fakten allein reichen nicht aus, egal wie eindeutig sie sind und wie laut sie geschrien werden. Nur wenn wir die Emotionen, die kulturellen Eigenschaften und Ideologien an den Diskussionen teilhaben lassen, haben wir Aussicht auf Erfolg.
Mit Illustrationen von Pia Schulzebrüdrop und Lennart Leibold
Titelbild: Pia Schulzebrüdrop - copyright