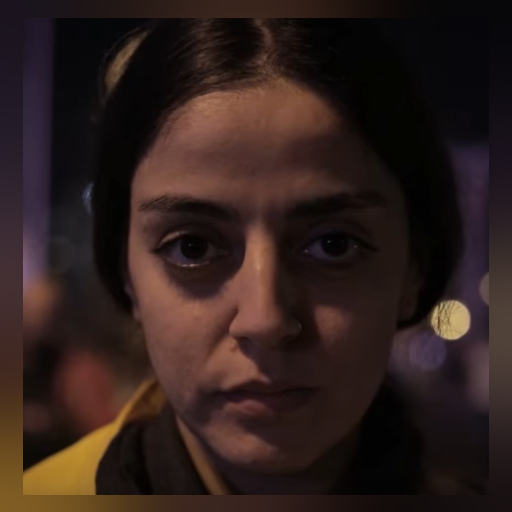Du denkst, die Welt ist in Aufruhr? Du hast recht
Für Klimagerechtigkeit, für Freiheit, für Würde – 2019 war ein Jahr der Massendemonstrationen. Und es geht weiter. 5 Protestforscher erklären, worauf wir uns jetzt vorbereiten müssen.
Ist das der Anfang einer neuen Epoche?
Der Küchentisch ist nicht selten der Ort, an dem große Fragen gestellt werden. Auch an jenem Abend im vergangenen Oktober, als mein Mann und ich durch die Nachrichten zu den vielen neuen Protesten scrollten, die allein in diesem einen Monat ausgebrochen waren. Von Südamerika über Afrika, Nahost, Europa bis nach Hongkong – uns schien, als würde sich überall auf der Welt eine Unzufriedenheit entladen, die sich lange angestaut hatte. »Zufall?«, fragte ich ihn. »Oder sogar das Ende einer Ära?«, gab er zurück. Ein paar Tage später stellte ich meinem Kollegen Benjamin Fuchs in der Redaktion dieselben Fragen. Die Neugier packte uns. Benjamin hat in Südamerika gelebt, ich im Nahen Osten – mit unserem regionalen Wissen wollten wir uns an die Antwort auf die Frage herantasten, ob diese Proteste etwas verbindet – und wenn ja, was das sein könnte.
Eines wird deutlich: Es war in Anzahl und Intensität ein außergewöhnliches Protestjahr. In rund 1/4 der Welt soll es 2019 zu einem dramatischen Anstieg ziviler Unruhen gekommen sein, die auch in diesem Jahr nicht abnehmen werden. So beschreibt es die britische Risikobewertungsfirma
Zusammenhangslos scheinen nämlich die Auslöser der Massenproteste auf den ersten Blick:
Um uns nicht zu verrennen, fragten wir bei 5 Protestforschern nach, die unterschiedliche regionale Schwerpunkte haben: Lateinamerika, Europa, Nordafrika und Mittlerer Osten sowie Hongkong. Um die Gemeinsamkeiten aufzudecken, mussten wir uns nämlich erst einmal durch regionale Unterschiede und Ursachen arbeiten.
Klicke hier für eine detaillierte Liste der großen Proteste im Jahr 2019.
Asien
- Hongkong: Im Sommer löste ein Gesetz, das die Auslieferung von Straftätern aus Hongkong nach China ermöglichen sollte, wieder Pro-Demokratie-Proteste in Hongkong aus. Die Protestierenden beharren auf einer Unabhängigkeit von China. Bereits 2014 waren sie auf die Straße gegangen.
- Irak: Anfang Oktober beginnen Proteste gegen Korruption und Misswirtschaft der Regierung. Die Forderung: eine neue Regierung ohne die etablierten Parteien. Anfang 2020 eskalieren die Proteste erneut.
- Libanon: Die Antiregierungsbewegung im Libanon protestiert gegen soziale Ungleichheit und die politische Klasse. Auslöser war eine geplante »›Whatsapp‹-Steuer«, eine Abgabe auf Anrufe per Internet. Seit Januar gibt es in neuen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitsbehörden viele Verletzte.
- Iran: Im November kommt es im gesamten Iran zu Protesten, nachdem die Regierung eine 50-prozentige Erhöhung der Benzinpreise angekündigt hatte. In 22 Städten werden mehr als 140 Demonstranten getötet. Bei einer landesweiten Razzia werden mehr als 1.000 Personen verhaftet.
- Indonesien: Zuerst gehen im September Studierende auf die Straße, um gegen neue Gesetzvorlagen zu protestieren, die die Antikorruptionsbehörde einschränken, außerehelichen Sex und die Diffamierung des Präsidenten kriminalisieren würden.
- Indien: Seit Dezember wird in ganz Indien gegen das Staatsbürgerschaftsänderungsgesetz protestiert. Es soll Menschen mit bestimmten Religionszugehörigkeiten erleichtern, die indische Staatsbürgerschaft zu erhalten – außer Muslimen.
Weitere Antiregierungsproteste in der Region:
- In West-Papua protestieren Schüler und Studierende gegen Rassismus und Polizeigewalt und für Unabhängigkeit.
- In Südkorea finden Proteste für den Rücktritt von Präsident Moon Jae-in und für die Absetzung den Justizministers Cho Kuk statt.
- In den Philippinen protestieren Tausende gegen Präsident Rodrigo Duterte und die Morde an Bauernführern auf der zentralphilippinischen Insel Negros.
- Textilarbeiterinnen und -arbeiter demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen in Bangladesch.
- Kaschmir demonstriert für die Unabhängigkeit.
- Jugendliche protestieren in Gaza gegen die Hamas.
- In Israel protestieren Oppositionelle in Tel Aviv gegen Benjamin Netanjahu und jüdische Äthiopier demonstrieren für ihre Rechte und gegen Polizeigewalt.
- Oppositionelle protestieren in Russland für freie, faire Kommunalwahlen, freie Meinungsäußerung und für die Freilassung politischer Gefangener.
- Landesweit demonstrieren Oppositionelle in der Türkei gegen die Regierung.
- Auch in Pakistan protestieren Oppositionelle gegen die Regierung, gegen Wahlfälschung und für Neuwahlen.
- Vorwiegend junge Demonstranten protestieren in Georgien für eine Wiederholung der Präsidentschaftswahlen.
- Mittel- und Unterschicht protestieren in Jordanien gegen ein neues Steuergesetz.
Afrika
- Sudan: Monatelange Proteste führen zum Sturz des langjährigen Diktators Al-Bashir. Anschließend ringen Militär und Opposition um die Bildung einer Übergangsregierung. Im Juni 2019 beginnen neue, heftige Proteste gegen eine befürchtete neue Diktatur.
- Ägypten: Seit Ende Oktober 2019 fordern Demonstranten den Rücktritt von Diktator Al-Sisi. Ausgelöst wurden die Proteste durch Korruptionsvorwürfe eines ägyptischen Whistleblowers.
- Simbabwe: Immer wieder eskalieren Proteste. Im Januar 2019 gibt es nach einer Benzinpreiserhöhung einen Generalstreik, die Polizei erschießt mehrere Menschen. Im August flammen neue Proteste gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung auf.
- Algerien: Nachdem Präsident Abdelaziz Bouteflika im Februar seine Absicht bekannt gegeben hatte, für eine fünfte Amtszeit zu kandidieren, forderten schätzungsweise 3 Millionen Demonstranten in Algier seinen Rücktritt. Bouteflika trat im April zurück.
Weitere Antiregierungsproteste in der Region:
- Studierende in Uganda protestieren gegen die Regierung.
- Regierungskritiker protestieren in der Hauptstadt Äthiopiens, Addis Abeba, und in weiteren Teilen der Region Oromia.
- In ganz Malawi protestieren vor allem junge und arbeitslose Oppositionelle gegen die Regierung mit dem Vorwurf von Wahlfälschung.
- Im Senegal wird in der Hauptstadt Dakar aufgrund steigender Ölpreise protestiert.
- Guineas Einwohner protestieren im ganzen Land gegen eine dritte Amtszeit von Präsident Alpha Condé.
- Vor allem junge Arbeitslose protestieren in Kenia gegen die schlechten Lage der kenianischen Wirtschaft und die ausufernde Korruption.
- In mehreren Teilen der Republik Tschad demonstrieren die Einwohner für den Zugang zu Internet und für bessere humanitäre Hilfe.
- Im Ostkongo, in der Stadt Beni und Goma protestieren junge Demonstranten gegen den ehemaligen Präsidenten Joseph Kabila und gegen die Mission der Vereinten Nationen für die Stabilisierung in der Demokratischen Republik Kongo.
- Proteste von Oppositionellen fanden in den Komoren gegen gefälschte Präsidentschaftswahlen statt.
- In Liberia demonstriert eine vom politischen Aktivisten Henry Costa angeführte Bewegung für mehr Gerechtigkeit und gegen die sich verschlechternde wirtschaftliche Situation in der Hauptstadt Monrovia.
Europa
- Frankreich: Ende 2019 starten massive Proteste gegen die geplante Rentenreform von Präsident Emmanuel Macron. Zuvor hatten seit Ende 2018 bereits die sogenannten Gelbwesten gegen Benzinpreiserhöhungen protestiert.
- Katalonien: Die Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien demonstriert immer wieder, besonders intensiv im Oktober 2019. Die wirtschaftsstarke Region möchte sich von Spanien abspalten.
Weitere Antiregierungsproteste in der Region:
- In Großbritannien finden Anti-Brexit-Proteste statt.
- Nationalisten und Liberale protestieren in der Ukraine für eine Änderung des Friedensplans mit Russland.
- Protestierende, darunter viele Frauen, gehen in Malta gegen Korruption auf die Straße.
- In Ungarn löst ein neues Überstundengesetz Antiregierungsproteste aus.
- In ganz Polen gehen die Menschen für die Unabhängigkeit der Richter und für ihre eigene Freiheit auf die Straße.
- In Rumäniens Hauptstadt Bukarest protestieren Bürger für den Rücktritt der Regierung.
- In Serbien protestieren Serben gegen den autoritären Regierungsstil von Präsident Aleksandar Vučić und fordern seinen Rücktritt.
- In Italien gehen Bürger gegen den zunehmenden Rechtspopulismus in der politischen Landschaft auf die Straße.
- In Albanien wird für den Rücktritt von Regierungschef Rama demonstriert.
- Die Protestbewegung in Tschechien kämpft gegen Regierungschef Andrej Babiš und für Demokratie und Meinungsfreiheit.
Lateinamerika
- Chile: Proteste gegen soziale Ungleichheit. Auslöser ist eine Erhöhung der Fahrpreise im öffentlichen Nahverkehr.
- Haiti: Proteste gegen Präsident Moïse. Auslöser war eine Korruptionsaffäre um die Veruntreuung von öffentlichen Hilfsgeldern.
- Kolumbien: Proteste gegen eine geplante Arbeitsmarkt- und Rentenreform. Nach dem Tod eines Jugendlichen bei den Protesten richten sich die Proteste stärker gegen Präsident Iván Duque Márquez selbst.
- Ecuador: Proteste gegen Benzinpreiserhöhungen als Bedingung eines IWF-Kreditpakets.
- Venezuela: Im Januar lässt sich Parlamentspräsident Juan Guaidó als Präsident vereidigen, obwohl Präsident Nicolás Maduro noch im Amt ist. Hunderttausende demonstrieren indes gegen Maduro. Die Proteste ebben im Verlauf des Jahres ab.
- Bolivien: Proteste gegen Präsident Evo Morales wegen angeblicher Wahlfälschung. Militär und Polizei zwingen Morales nach heftigen Protesten zum Rücktritt.
Weitere Antiregierungsproteste in der Region:
- In Peru demonstriert die Straße für die Bekämpfung von Korruption und gegen Teile des Kongresses.
- Viele junge Menschen, Studierende und Frauen protestieren in mehreren Städten Brasiliens für bessere Lebensverhältnisse und fordern soziale Gerechtigkeit.
- In verschiedenen Städten Nicaraguas protestieren Oppositionelle gegen die von Präsident Daniel Ortega verordneten Reformen der sozialen Sicherheit und fordern seinen Rücktritt.
- In Puerto Rico protestieren Oppositionelle für den Rücktritt von Gouverneur Ricardo Rosselló.
- In ganz Honduras protestieren größtenteils Studierende und junge Menschen gegen den korrupten Präsidenten Juan Orlando Hernández und fordern dessen Rücktritt.
Mit dieser Liste erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die meisten Proteste, die in der Tradition von Bewegungen stehen, wie beispielsweise die Frauenrechtsbewegung, haben wir ausgelassen. Die umfangreiche Recherche hat unsere Praktikantin Lara Herberg durchgeführt.
Am Ende unserer Recherche fanden wir 4 Berührungspunkte.
1. Die Protestierenden wehren sich gegen Ausbeutung
Stell dir vor, du hast ein Auto und jemand anderes kassiert Geld dafür, dass du es fährst. Ungerecht, oder? Wenn der Soziologe Sérgio Costa, gebürtiger Brasilianer und Professor an der FU Berlin, zu den Ursachen der Protestwellen in Südamerika befragt wird, spricht er von einer
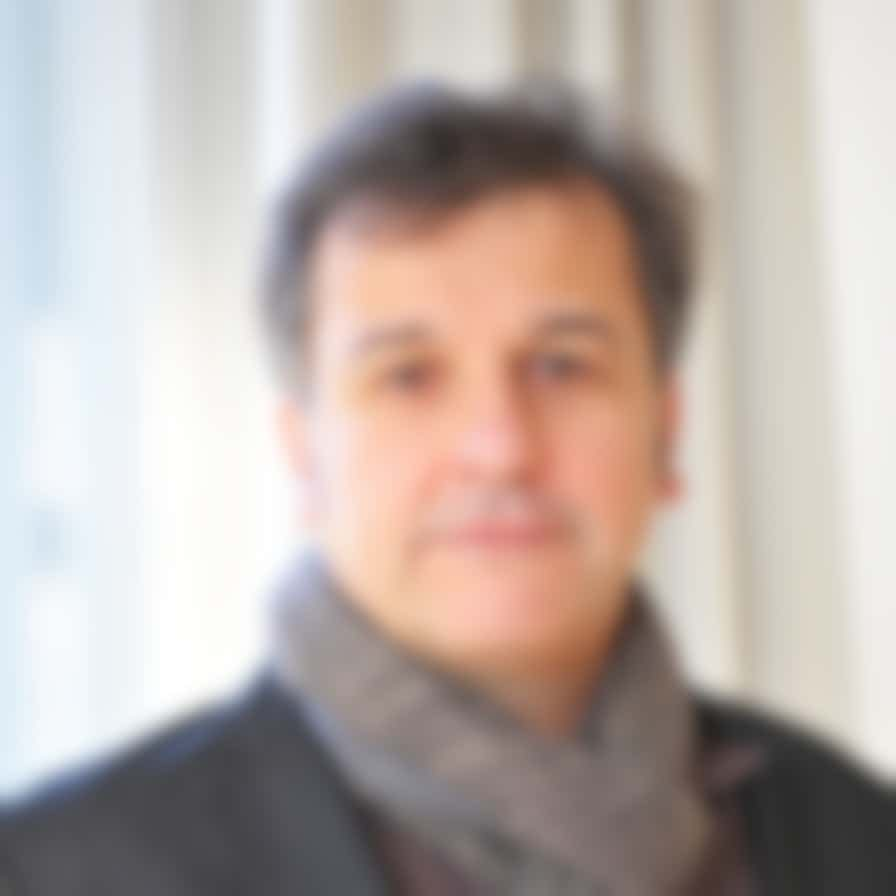
Selbst in Hongkong,
Ungleichheit zeigt sich im Libanon, Irak, Sudan und Algerien vor allem als demografisches Problem. In Nordafrika und dem Nahen Osten herrscht die höchste Jugendarbeitslosigkeitsrate weltweit: 25% der 15–24-Jährigen in der Region sind arbeitslos, Tendenz steigend. Lebenshaltungskosten und Arbeitslosigkeit rangieren unter den

Schauen wir nach Europa. Hier schwang auch bei dem
Gegen eine andere Form der Ausbeutung, sozusagen die zweite Seite der gleichen Medaille, wenden sich Millionen junger Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt: Die Ausbeutung und Zerstörung des Planeten. Fridays for Future und Extinction Rebellion stehen in der Tradition der Umweltbewegungen der
Wer sich die globalen Proteste heute anschaut, zieht intuitiv eine Verbindung zu der Protestwelle des Arabischen Frühlings, der

Seitdem ist die Vermögensungleichheit weiter gewachsen. Es gibt eine größere Anzahl von Menschen, die in Armut leben,
Selbst in Industrienationen beginnt die Mittelschicht zu begreifen: Sie hat kaum noch etwas zu gewinnen, aber jede Menge zu verlieren.
2. »Wir gegen die da oben«
Die Wut der Straße richtet sich gegen jene, die die Ausbeutung ihrer Ansicht nach organisieren, ihr tatenlos zusehen und von ihr profitieren: das wirtschaftliche und
Man hat gemerkt, dass der Staat – der eigentlich für das Gemeinwohl arbeiten sollte – von einer bestimmten Gruppe instrumentalisiert wird. Sei es legal oder durch Korruption: Der Staat macht nicht das, was er tun soll. Das ist der Eindruck.
Nach und nach stellte sich in Lateinamerika nicht nur eine Parteienverdrossenheit, sondern auch ein Misstrauen gegenüber fast allen politischen Institutionen wie Parlamenten und Gerichten ein. »Mit der

Nach Jahrzehnten massiver staatlicher Repression und Korruption überrascht es nicht, dass in Ländern des globalen Südens das Vertrauen in politische Institutionen eher gering ist.
Ihre Ablehnung nationaler wie übernationaler Institutionen, des gesamten Establishments, zeigen in Europa vor allem reaktionäre Protestbewegungen wie Pegida, die
Schauen wir uns dagegen die Klimabewegung an, ist das Vertrauen in politische Kräfte noch nicht gebrochen. Swen Hutter sagt: »Die Ziele sind ja eigentlich schon im politischen Prozess angekommen und auch die Allianzpartner sind da.« Damit meint Hutter, dass trotz der Versuche von Fridays for Future, sich vom politischen System in Deutschland abzugrenzen, mit den Grünen ein wichtiger politischer Fürsprecher im Parlament sitzt. Aber das ist nicht der einzige Unterschied.

3. Führerlose Proteste sind im Trend
Seitdem die Schwedin Greta Thunberg die weltweit größten Klimaproteste losgetreten hat, wird sie nicht nur bewundert, sondern auch öffentlich angefeindet. Zu jung, egoistisch, von der »Klimalobby« gesteuert und ein Kind verantwortungsloser Eltern –
Diese Taktik nutzen auch Staaten, die Antiregierungsproteste unterdrücken wollen. Wie China im Fall von Joshua Wong, der mit einer Gruppe von Studierenden die Hongkonger Proteste vor 6 Jahren initiierte. »Indem Wong so berühmt wurde, bekamen die Proteste internationale Aufmerksamkeit, gleichzeitig wurde er zur Zielscheibe der Regierung«, sagt der Hongkonger Protestforscher Ye Wang.

Seitdem ist die Bewegung in Hongkong weitgehend führerlos – wie auch die meisten anderen Proteste im vergangenen Jahr. Grund dafür ist nicht nur, dass Protestler sich und ihr Anliegen schützen wollen, sondern auch interne Interessenkonflikte darum, wer wen vertritt. Oft ist es aber eine bewusste Entscheidung: Im Libanon fordern Politiker beispielsweise immer wieder von den Demonstranten, ihre Repräsentanten für Verhandlungen zu benennen. Indem sich die Straße weigert, erteilt sie dem bestehenden politischen System nicht nur mit dem Mittel des
Führt »führerlos« zum Erfolg?
Ye Wang ist unsicher: »Führerlose Proteste sind wie ein Friss-oder-stirb-Deal für Regierungen. Entweder akzeptieren sie die Forderungen und die Protestierenden gehen nach Hause, oder nicht, und der Protest geht weiter.«
Bis Ende 2019 kamen in Chile 29 Menschen ums Leben, im Südirak sogar

Diese Reaktion hat Auswirkung darauf, wie lange der (friedliche) Protest bestehen kann. Saliba verweist auf einen der schlimmsten Kriege der letzten 10 Jahre, der der Euphorie des sogenannten Arabischen Frühlings ein jähes Ende setzte:
In Syrien hatte man 2011 friedlich zu demonstrieren begonnen, darauf wurde aber repressiv reagiert und Demonstranten wurden erschossen – deshalb entstand ein bewaffneter Widerstand.
4. Proteste breiten sich schneller aus
Nicht zuletzt sind es soziale Medien, die es überhaupt erst möglich machen, Proteste schnell und dezentral zu organisieren. Und der Austausch macht nicht an nationalen Grenzen Halt. Die Protestierenden haben heute online Zugriff auf einen unendlichen Wissenspool gefüllt mit Taktiken und Protestformen.
Auf der Videoplattform Youtube
Geteilt wird aber noch mehr: Es mutet skurril an, dass sich in den Straßen Santiagos und Beiruts Protestierende als Comicfiguren, zum Beispiel als Joker, verkleiden und dass im Irak, Bulgarien und Israel Anfang 2019 gelbe Westen getragen wurden –
Man könnte nun zu dem Schluss kommen, Massenprotestwellen wie die im digitalen Zeitalter seien noch nie da gewesen. Doch das stimmt nur bedingt: Informationen sind davor einfach nur sehr viel langsamer gereist. Swen Hutter gibt ein paar Beispiele:
Die soziale Bewegungswelle der 80er-Jahre mit den Protesten gegen Nuklearwaffen, mit Menschenketten und Petitionen, die Demos gegen den Irakkrieg Anfang der 2000er – all das war massenmobilisierender als das, was wir momentan erleben.
Wie kann es weitergehen?
Es sieht nicht so aus, als ob die Protestwelle im Jahr 2020 abebben wird. Denn um globale Ausbeutung zu bekämpfen, müsste laut Soziologe Sérgio Costa die gesamte Menschheit zum Wellenbrecher werden: »Man müsste global umverteilen und nicht daran denken, dass ein nationaler Staat allein das Problem wirklich lösen könnte. Aber das ist natürlich eine sehr langfristige Lösung«. Das zeigt, wie grundsätzlich diese Krise ist. Globale Umverteilung würde internationale Handelsabkommen berühren, wirkliche Gerechtigkeit würde am Ende vielleicht so etwas wie

Auch auf nationaler Ebene plädiert Costa für eine Umverteilung. Steuersysteme müssten gerechter werden, sodass
Um die zu lösen, braucht es mehr aktive Bürgerbeteiligung im politischen Prozess, etwa durch
Wie wir von den Straßen des Libanons, Chiles und Hongkongs hören, ist die Politisierung der Bürgerinnen und Bürger in vollem Gange. Nicht nur an Protesttagen finden sich Gruppen zusammen, die darüber diskutieren, wie ihr Land zukünftig aussehen und geführt werden soll. Die erste Chance, Bürgerinnen und Bürger teilhaben zu lassen, haben Regierungen in Ländern, in denen eine Verfassungsänderung gefordert wurde. In Chile soll im April, im Libanon noch im Jahr 2020 über eine neue Verfassung abgestimmt werden.
Nun haben wir Lösungen aufgezählt, um die Proteste zu stoppen – was aber, wenn die Protesterfahrung selbst eine nachhaltige Lösung darstellt? Denn Proteste einen und sind identitätsstiftend, da sind sich die interviewten Forscher einig. Diesen Effekt kann man vor allem dort beobachten, wo Menschen zusammen Ängste überwinden: »In einer freien Gesellschaft wird der Protest nicht so viel mit den Menschen machen wie in einer repressiven Gesellschaft, wo man deutlich mehr riskiert«, sagt Swen Hutter. Deshalb hallt der Ruf nach Freiheit und Würde auch dort am lautesten, wo das Regime weit mehr als nur die materielle Entfaltung erstickt.
In ihren aktuellen Protesten emanzipieren sich die Menschen von einer der stärksten Folgen des globalisierten Neoliberalismus – der zunehmenden Isolation des einzelnen Menschen. Wer zusammenkommt und ein Kollektiv bildet, setzt schon damit ein Zeichen. Die kollektive Erfahrung auf der Straße zeigt den Protestierenden: Es geht nicht nur einem Menschen allein so, man kämpft miteinander für ein gemeinsames Ziel. Nicht nur für eine Lösung für sich selbst, sondern für alle anderen.
Mit Illustrationen von Doğu Kaya für Perspective Daily