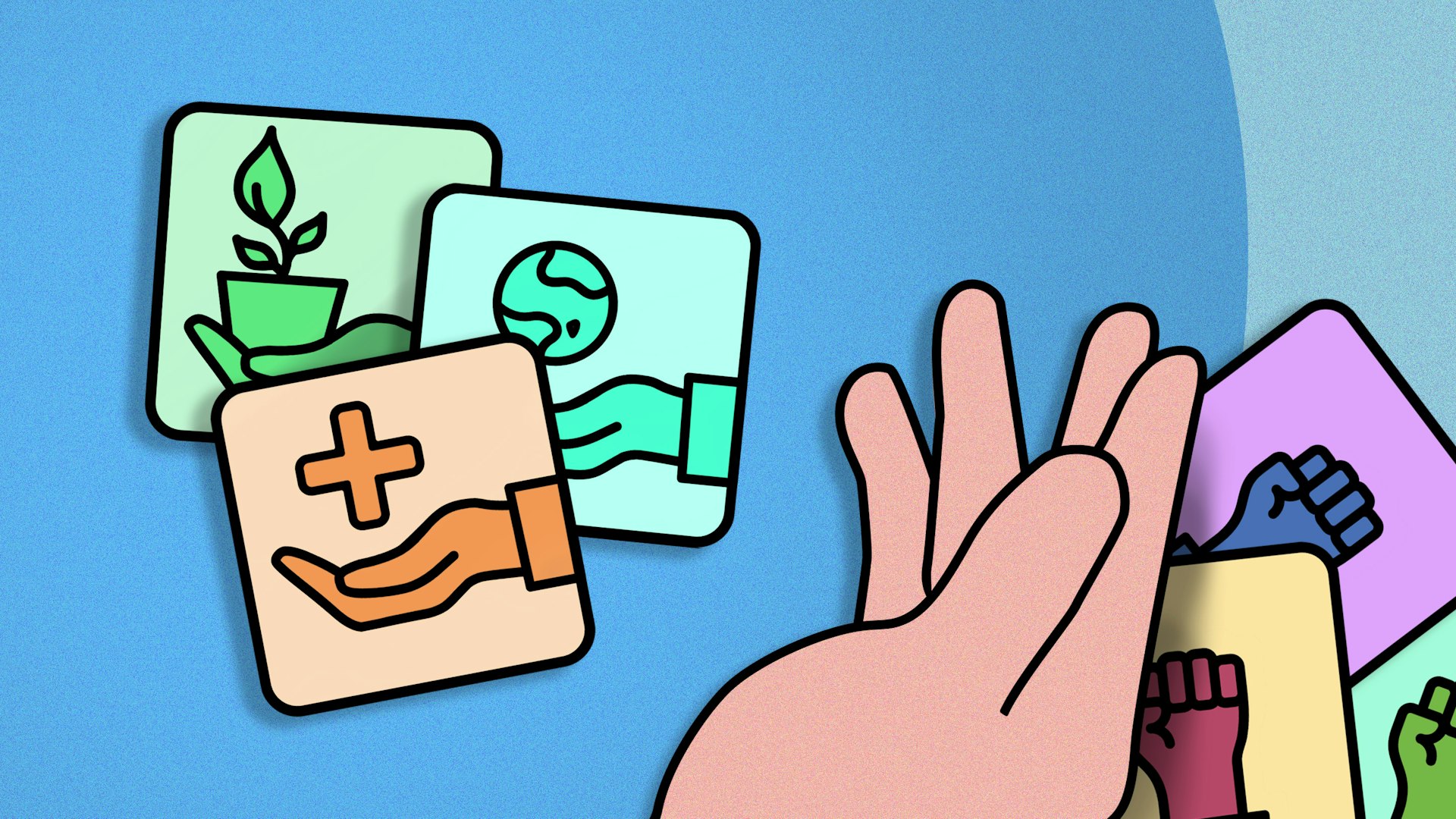Was heißt schon politisch? An dieser Frage hängt jetzt die Existenz vieler Vereine
Vielen Vereinen wird gerade die Gemeinnützigkeit aberkannt, zu politisch lautet die Begründung. Damit stehen sie vor dem finanziellen Aus – und das betrifft uns alle.
Die Überprüfung der Gemeinnützigkeit hätte eigentlich eine Routineangelegenheit sein sollen. Doch als im Oktober 2019 der Brief vom Finanzamt im Briefkasten landet, ist die Nachricht ein Schock: Dem Demokratischen Zentrum Ludwigsburg (DemoZ) wird rückwirkend die Gemeinnützigkeit aberkannt, so der Wortlaut der Amtsmeldung. Für den Verein eine Katastrophe.
Die Entscheidung des Finanzamtes hatte dieses Mal länger gedauert. Der Grund: Die Beamt:innen hatten ein Urteil abgewartet, das die Gemeinnützigkeitskriterien für Vereine neu definieren sollte – und damit letztendlich eine ganze Kettenreaktion auslöste. Zahlreiche weitere Vereine verloren auf Basis dieses Urteils ihren Gemeinnützigkeitsstatus, Hunderte sind potentiell betroffen.
Seit das Zentrum vom Finanzamt Post bekommen hat, sind knapp 12 Monate vergangen. Für das kleine soziokulturelle Zentrum in der Ludwigsburger Innenstadt hat sich seitdem einiges geändert. »Es ist eine enorme Doppelbelastung«, beschreibt Yvonne Kratz, die Pressesprecherin des DemoZ, ihre derzeitige Situation. Das DemoZ wird allein von Ehrenamtlichen gestaltet und versteht sich selbst als Kulturzentrum, worin sich jede:r aktiv einbringen

Yvonne Kratz sieht das DemoZ als Begegnungsort und Bildungsstätte zugleich. Durch den Entzug der Gemeinnützigkeit steht die Zukunft des Vereins nun auf der Kippe. Das liegt vor allem daran, dass die Gemeinnützigkeit als Gütesiegel gilt und Vereine Spender:innen verlieren, wenn sie nicht mehr als gemeinnützig gelten.
In ganz Deutschland sorgen sich nun größere und kleinere Vereine, ob sie den Status nach dem Urteil behalten können.
Wenn eine richterliche Entscheidung so viel Verwirrung auslöst, ist es Zeit, einen genaueren Blick auf das geltende Gemeinnützigkeitsrecht zu werfen. Denn in einer Demokratie, die vom Engagement der Bürger:innen lebt, sollte die Rechtslage zivilgesellschaftliche Beteiligung fördern – und nicht ausbremsen. Warum ist die Situation also gerade so unübersichtlich? Und wie ließe sie sich zum Wohl der Vereinslandschaft stabilisieren?
Was ist überhaupt »Gemeinnützigkeit«?
Formell gesehen ist die Anerkennung eines Vereins als gemeinnützig in Deutschland vor allem aus steuerrechtlichen Gründen wichtig. Denn Unterstützer:innen können Spenden an Vereine nur dann in voller Höhe steuerlich absetzen, wenn der Verein, der das Geld erhält, als gemeinnützig eingestuft ist.
Doch damit nicht genug: Wie das DemoZ nun erfahren musste, ist Gemeinnützigkeit auch für die Außenwahrnehmung eines Vereins relevant. »Wenn in der Zeitung steht ›Verein wurde die Gemeinnützigkeit entzogen‹, dann denken die Leute nicht ›Oh, er hat keine Steuervorteile mehr‹, sondern ›Der Verein hat sich nicht dem Gemeinwohl zuträglich verhalten‹«, so Yvonne Kratz. Gerade für kleinere Vereine wird es daher schnell zum finanziellen Problem, wenn Menschen durch die Aberkennung verunsichert werden und nicht mehr spenden.
»Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn die Allgemeinheit auf geistigem, sittlichem oder materiellem Gebiet selbstlos gefördert wird.« – Paragraf 52 Absatz 1 Abgabenordnung des Bundesfinanzamts
Für die Vereine selbst bringt die Gemeinnützigkeit also große Vorteile. Gerade deshalb sieht sich der Staat in der Verantwortung, die Gemeinnützigkeit nicht beliebig zu erteilen, sondern sie nur nach guter Prüfung an wirklich berechtigte Organisationen zu
Um gemeinnützig zu sein, muss sich ein Verein für Zwecke einsetzen, die sich – logisch –
Haltung zeigen und gemeinnützig sein – geht das?
Das DemoZ konnte sich bisher immer auf die Zwecke der »Volksbildung« sowie der »Förderung von Kunst und Kultur« berufen, um seine Gemeinnützigkeit zu rechtfertigen. Im vergangenen Oktober hat das zuständige Finanzamt jedoch entschieden, dass die vom Verein geförderte politische Bildung »nicht in geistiger Offenheit erfolgt« und daher auch
Wir haben eine Ausschlussklausel, die es Personen verweigert, unsere Räumlichkeiten zu betreten, wenn sie rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören. Das gilt auch für Personen, die der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische oder menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind.
Für den Verein sei diese Klausel eine rechtliche Absicherung, um bestimmte Personen ausschließen zu können, bevor sie die Veranstaltung stören, wie Yvonne Kratz erklärt. »Denn es hilft niemandem, der bei uns Gast ist, wenn ein Nazi reinkommt und wir ihn erst rausschmeißen dürfen, wenn er irgendjemanden rassistisch beleidigt hat.«
Diese Freiheit des bewussten Ausschlusses ist auch rechtens. Die Veranstalter:innen setzen damit ihr Hausrecht durch, das von Paragraf 11 des Versammlungsgesetzes geschützt
 Das DemoZ veranstaltet unter anderem Konzerte und Veranstaltungen zur politischen Bildung.
Das DemoZ veranstaltet unter anderem Konzerte und Veranstaltungen zur politischen Bildung.  Mit den Veranstaltungen im eigenen Kulturzentrum wirbt der Verein für eine »solidarische, gleichberechtigte und soziale« Gesellschaft.
Mit den Veranstaltungen im eigenen Kulturzentrum wirbt der Verein für eine »solidarische, gleichberechtigte und soziale« Gesellschaft.  Seit Oktober 2019 ist das DemoZ nicht mehr gemeinnützig. Der Grund: Das soziokulturelle Zentrum betreibe politische Bildung nicht in »geistiger Offenheit«.
Seit Oktober 2019 ist das DemoZ nicht mehr gemeinnützig. Der Grund: Das soziokulturelle Zentrum betreibe politische Bildung nicht in »geistiger Offenheit«. Wie viel politische Haltung ist erlaubt?
Haltung zeigen und gleichzeitig gemeinnützig sein – geht das? Die aktuelle Rechtslage, die durch das Attac-Urteil geschaffen wurde, scheint das nahezu unmöglich zu machen. Denn es liegt in der Hand der einzelnen Finanzämter, zu entscheiden, welche Haltung sich im Rahmen der gemeinnützigen Zwecke bewegt – und welche nicht. Dass Finanzämter dabei keineswegs einheitlich entscheiden, zeigt
Die Hälfte der Ämter bestätigte die Gemeinnützigkeit, die andere lehnte diese ab. Die Ablehnung erfolgte dabei aus verschiedenen Gründen – offensichtlich sind die 25 Zwecke, die sich
- von Wissenschaft und Forschung,
- von Kunst und Kultur,
- von Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studierendenhilfe,
- des Naturschutzes und der Landschaftspflege,
- des Wohlfahrtswesens,
- der Entwicklungszusammenarbeit,
- des Schutzes von Ehe und Familie,
- des Sports
- oder des demokratischen Staatswesens.
Eine politische Betätigung jenseits davon ist Vereinen jedoch bisher nicht erlaubt – zumindest nicht wenn sie weiter gemeinnützig bleiben wollen. So kann beispielsweise schon der
Jetzt kennst du die Kriterien für die Gemeinnützigkeit von Vereinen. In der Praxis ist das jedoch nicht immer logisch. In diesem Quiz kannst du angeben, ob du einen Verein für gemeinnützig hältst – und siehst direkt, ob das Finanzamt das genauso beurteilt hat:
Verhalten sich Vereine wie Parteien? Die Logik des Bundesfinanzhofs
Wie weit die Zwecke der »Volksbildung« und der »Förderung des demokratischen Staatswesens« ausgelegt werden, ist letztlich eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH). Mit dem Attac-Urteil hat sich der BFH für eine enge Auslegung ausgesprochen. Der Jurist Sebastian Unger ist der Ansicht, dass diese restriktive Sichtweise zwar möglich, aber keinesfalls zwingend ist. Unger lehrt Öffentliches Recht in Bochum und hat im April 2020 ein Gutachten veröffentlicht, worin er sich damit beschäftigt, ob politische Betätigung und Gemeinnützigkeit verfassungsrechtlich vereinbar sind.
Sein Fazit: Ja, im Prinzip lässt sich beides verknüpfen. Dass sich das in der bisherigen Rechtsprechung nicht widerspiegelt, liegt laut Unger an einem wichtigen Detail: Der BFH setzt die politische Arbeit von Vereinen mit der von politischen Parteien gleich.
Zwischen Parteien und Vereinen gibt es steuerrechtlich einen großen Unterschied: Spenden an Parteien dürfen nur bis zu einer Höhe von 3.300 Euro von der Steuer abgesetzt werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Menschen vergleichbare Möglichkeiten haben, die Politik zu beeinflussen. Bei gemeinnützigen Vereinen sind Spenden jedoch unbegrenzt steuerlich absetzbar. Die Logik des Bundesfinanzhofs ist also: Parteien machen Politik, deswegen dürfen Spenden an diese nur begrenzt steuerlich begünstigt werden. An gemeinnützige Vereine lassen sich hingegen Spenden in beliebiger Höhe absetzen, denn Vereine dürfen keine Politik machen. Tun sie es doch, muss der Staat ihnen ihre Gemeinnützigkeit entziehen – damit die demokratische Gleichheit wieder gewährleistet ist.

Und das, findet Unger, funktioniere nicht: »Der wesentliche Unterschied ist die Teilnahme der politischen Parteien an Wahlen. Und zivilgesellschaftliche Organisationen wollen eben nicht an Wahlen teilnehmen.« Die Parteien wollen politische Macht ausüben, während zivilgesellschaftliche Organisationen Einfluss auf diese nehmen, ohne selbst Macht erringen zu wollen.
Der Jurist sieht deshalb keinen Grund, gemeinnützigen Vereinen die politische Betätigung komplett zu verbieten. Das ist auch praktisch unmöglich: Bei politischer Bildung zum Beispiel lässt sich gar nicht eindeutig definieren, wo Bildung aufhört und Aktivismus anfängt. Für das DemoZ ist eine Ausschlussklausel eine Bedingung, um politische Bildungsveranstaltungen durchführen zu können – für andere ist das bereits ein politisches Statement. Ein Vortrag zu Anarchismus ist für das DemoZ Teil einer gesellschaftskritischen Reflexion – das Finanzamt sieht damit die politische Neutralität verletzt.
An Aufrufe zu Demonstrationen oder die Unterstützung politischer Kampagnen ist bei einer derart engen Auslegung von politischer Betätigung gar nicht erst zu denken, wenn ein Verein die Gemeinnützigkeit behalten will. Wer weiter Spendenquittungen ausstellen können möchte, organisiert lieber Karnevalsumzüge, Schachturniere oder trägt Kröten über die Straße. Denn das ist ja wohl unpolitisch … oder?
Sind Schützenvereine politisch?
Im vergangenen Herbst löste Finanzminister Olaf Scholz eine Debatte aus, die offensichtlich machte, dass selbst ein Schützenverein nicht unpolitisch ist. Der SPD-Politiker schlug vor, reinen Männervereinen die Gemeinnützigkeit abzuerkennen – weil sie Frauen (und auch alle anderen Menschen
Für welche Art von Gesellschaft stehe ich ein?
So leichtfertig kann der Status quo aber nicht gerechtfertigt werden. Denn hinter jeder politischen Entscheidung stecken auch immer gewisse Werte, die Einzelpersonen oder Parteien vertreten. Schließlich gibt es auch Reichsbürger:innen, die gern unter Reichsbürger:innen sind. Gleiches gilt für das zivilgesellschaftliche Engagement: Für welche Art von Gesellschaft stehe ich denn ein? Was möchte ich erreichen? Und vor allem: Wie? Diese Haltungen zu bemänteln ist für Yvonne Kratz vom DemoZ keine Option in einer modernen Zivilgesellschaft – vor allem nicht in der politischen Bildungsarbeit:
Wenn man versucht, wertneutral zu sein, verschleiert man seine eigentlichen Intentionen. Wenn ich den Hintergedanken, den ich habe, nicht transparent mache, dann gehe ich die Gefahr ein, dass auch eine Indoktrinierung passieren kann. Es ist wichtig, zu sagen, wer man ist, wofür man steht, wohin man möchte, um Menschen auch die Möglichkeit zu geben, zu entscheiden: Möchte ich zu diesen Veranstaltungen gehen?
Eben diese Transparenz ist dem DemoZ beim Finanzamt auf die Füße gefallen. Damit so etwas nicht mehr passiert, plädiert Sebastian Unger
Praktisch würde aus Ungers Anregungen folgen, dass sich Vereine auch über das bisherige Maß hinaus politisch betätigen dürfen, wenn sie demokratisch und transparent gestaltet sind. Dann würde ihre politische Arbeit nicht mit der demokratischen Gleichheit in Konflikt geraten und wäre immer noch klar von Parteipolitik zu unterscheiden.
Was für eine Zivilgesellschaft wollen wir?
Was wir festhalten können: Momentan ist Gemeinnützigkeit ein wichtiges Gütesiegel für zivilgesellschaftliche Organisationen, das für kleinere Vereine finanziell entscheidend sein kann. Wenn das Gemeinnützigkeitsrecht so bleibt, wie es ist, führt das zu etwas, was Sebastian Unger als »Kanalisierungseffekt« bezeichnet: Organisationen versuchen, nicht zu politisch zu agieren, um keine böse Überraschung beim Finanzamt zu erleben. Die Zivilgesellschaft würde dann vorrangig als Dienstleisterin wahrgenommen und weniger als »politische Partnerin«.
In der politischen Bildung funktioniere eine solche Dienstleistung allein im Sinne der »Volksbildung« nicht, erklärt Yvonne Kratz. Für den Schulunterricht wurde einst im
Vereine können Anwälte für die Anliegen von Minderheiten werden
Wenn sich das Gemeinnützigkeitsrecht ändert, bietet das die Möglichkeit, auch andere Funktionen der Zivilgesellschaft zu fördern. So können Vereine etwa einen Raum für Diskussionen bieten, wie das DemoZ, oder sich als
Die Umstellung auf Ungers Vorschlag wäre für die meisten Organisationen unproblematisch. Die Auflagen, die er sich wünscht, erfüllen viele gemeinnützige Vereine schon heute: Als Mitglieder der
Diese Bemühungen will der Zusammenschluss »Rechtssicherheit für politische Willensbildung« beschleunigen, dem auch das DemoZ angehört. Mehr als 175 Organisationen haben sich hier zusammengefunden und setzen sich gemeinsam dafür ein, dass politische Betätigung vom Gemeinnützigkeitsrecht anerkannt und nicht marginalisiert wird. Zu ihren Forderungen zählt, dass insbesondere die Zwecke der
Die Gesetzesreform lässt auf sich warten
Das Bundesfinanzministerium hingegen hat auf den unverhofften Dominoeffekt, den das Attac-Urteil ausgelöst hat, immerhin kurzfristig reagiert: Bis Ende 2021 sind alle Finanzministerien angewiesen, das Urteil nicht mehr heranzuziehen, um weiteren Vereinen die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Für alle Vereine, denen der Status bereits entzogen wurde,
Die angekündigte Gesetzesreform der Bundesregierung lässt jedoch bisher auf sich warten. Weder Yvonne Kratz noch Sebastian Unger glauben an eine baldige Entscheidung, denn das Thema wird nun schon lange aufgeschoben. Einen Hoffnungsschimmer gibt es jedoch: Vor Kurzem haben sich die Landesfinanzminister:innen im Finanzausschuss des Bundesrates darauf geeinigt, dass die
Wie engagiert ist Deutschland?
Die Bereitschaft, sich zu engagieren, ist nach wie vor sehr hoch in Deutschland. Das zeigt der »Datenreport Zivilgesellschaft« von 2019. Demnach ist die Zahl der Vereine in Deutschland im Zeitraum 1996–2016 um 1/3 gestiegen. Die der Stiftungen hat sich in den letzten 10 Jahren sogar verdoppelt.
Wir sind auf eine aktive Zivilgesellschaft angewiesen
Gleich, welche Vorstellung einer Zivilgesellschaft jede:r von uns persönlich hat: Die Anliegen, womit sie sich beschäftigen können und müssen, werden mehr. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben wie der Umwelt- und Naturschutz, das Engagement gegen Rechtsextremismus und Rassismus oder die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich sind auf eine aktive Zivilgesellschaft angewiesen.
Aber auch regionale Kulturveranstaltungen, Karnevalsumzüge, Fußballturniere und eben auch Kleidertauschpartys kommen oft nur dank engagierter Bürger:innen zustande. Dass Vereinen, die dabei »zu viel« politische Haltung zeigen, ein Entzug der Gemeinnützigkeit droht, ist ein fatales Zeichen – und wird dem Engagement der Bürger:innen nicht gerecht.
Mit Illustrationen von Doğu Kaya für Perspective Daily