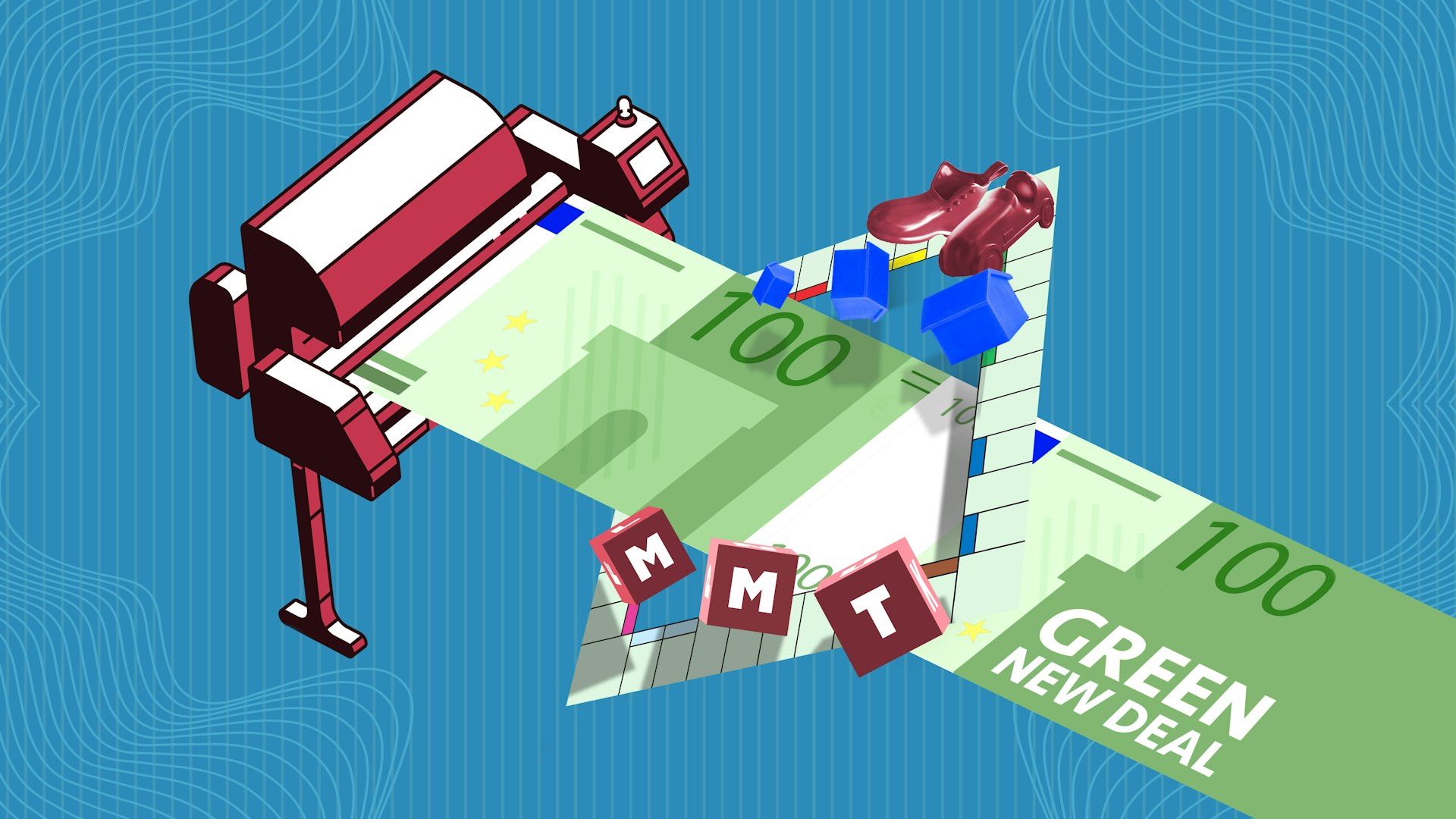Der Staat braucht dein Geld gar nicht. Du brauchst seins
Geld funktioniert ganz anders, als die meisten von uns glauben – sagt die sogenannte Modern Monetary Theory. Mit ihr ließe sich sogar spielend die grüne Transformation Europas finanzieren, wenn wir uns nur trauen. Bei einer Runde Monopoly kannst du lernen, wie.
Es ist ein Klassiker unter den Brettspielen, das seit seiner Erfindung vor über 100 Jahren schon Familienabende gesprengt und Freundschaften beendet hat: Monopoly. Erfunden hat es im Jahr 1904 die amerikanische Schauspielerin Lizzie Magie unter dem wenig griffigen Namen »The Landlord’s Game« (Das Hausbesitzerspiel). Ziel des Spiels ist es,
Doch es geht nicht nur ums Immobilienbusiness, Häuser und Hotels. Monopoly kann noch mehr, nämlich grundlegende Aspekte unseres Geldsystems erklären. Denn am Ende des Tages geht es den Spieler:innen nur um die bunten Papiergeldscheine, womit sich wohl jede:r schon einmal, den Blick herablassend auf die verarmten Mitspieler:innen gerichtet, Luft zugefächelt hat.
Wie wir mithilfe des Brettspielklassikers die Modern Monetary Theory besser verstehen können und mit diesem Wissen zum Spielende sogar ganz real eine nachhaltige Transformation Europas – auch »Green New Deal« genannt – finanzieren könnten, erfährst du in diesem Text – der wesentlich schneller vorbei ist als eine Runde Monopoly. So viel ist sicher!
Unser Geld verstehen – schon nach dem ersten Würfelwurf
»Wie funktioniert eigentlich Geld?«
Wenn wir diese Frage versuchen zu beantworten, greifen wohl die meisten auf ein Flickwerk von Informationen zurück, die wir im Laufe unseres Lebens aus Erziehung, Schule und Medien mitnehmen. Und spätestens bei den ersten Nachfragen wird schnell klar, dass diese einfache Frage reichlich komplex ist. Denn Geld ist mehr als nur ein Mittel zum Kaufen und Verkaufen. Es funktioniert je nach Kontext ganz unterschiedlich,
Geld in seiner Gesamtheit zu verstehen, ist der Ansatz der »Modern Monetary Theory« – oder kurz MMT. Sie geht noch einen Schritt zurück und fragt:
Die Modern Monetary Theory (MMT)
Die MMT ist eine vergleichsweise junge Geldtheorie, die seit dem Ende der 90er-Jahre vor allem in den USA zunehmend an Popularität gewinnt. Besonders der linke Flügel der Demokratischen Partei setzt sich für die Anerkennung dieser Theorie ein. Zu den prominentesten Unterstützer:innen zählen der Senator Bernie Sanders und die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, die durch die MMT eine Jobgarantie für alle für möglich halten.
Die Antworten, die die Moderne Geldtheorie auf diese Fragen gibt, bieten einen grundlegenden Perspektivenwechsel, der Banken und neoliberale Ökonom:innen zittern lässt, viele US-Demokrat:innen begeistert und auch bei uns im Bundestag angekommen ist.
Stelle dir dazu am besten vor, wie du mit deinen Lieben eine Runde Monopoly vorbereitest: Snacks und Getränke sind ausgepackt, das Spielbrett vorbereitet.
Du hast dein Startkapital erhalten, schnappst dir die Würfel und … 4!
Ein denkbar schlechter Start: Du ziehst deine Figur vor auf das Feld mit der Aufschrift
Verfechter:innen der Modernen Geldtheorie verweisen darauf, dass es in der Realität ganz genau so funktioniert – mit dem einzigen Unterschied, dass der Staat derjenige ist, der die Währung ausgibt. Er hat das Monopol auf Euroscheine (oder je nach Land mit eigener Währung Dollar, Yen und so weiter), die er an uns, die Währungsnutzer:innen, ausgibt.

»Wir können uns das noch einfacher vorstellen, wenn wir an frühe Stadtstaaten zurückdenken, in denen jeder Fürst eigene Münzen prägte und an die Bevölkerung ausgab«, erklärt mir Maurice Höfgen, Ökonom und wissenschaftlicher Mitarbeiter für Finanzpolitik im Bundestag. »Da war klar: Das Geld kommt nur vom Fürsten. Wenn dieser dann Steuern eintreiben will, nimmt er sie in Form seiner eigenen Münzen wieder ein.«
Aus dieser einfachen Beobachtung resultiert eine Feststellung mit weitreichenden Folgen: Der Staat braucht nicht unser Geld, wir brauchen seins.
Die MMT und Geldpolitik besser verstehen

Die Idee der Veranschaulichung unseres Geldsystems anhand von Monopoly stammt aus dem Buch »Mythos Geldknappheit« von Interviewpartner Maurice Höfgen.
Bildquelle: privatWarum der Staat deine Steuern nicht braucht
Privatpersonen und Unternehmen unterstehen als Währungsnutzer:innen der MMT zufolge also gänzlich anderen Spielregeln als der Staat in seiner Rolle als »Währungsausgeber«.
Trotzdem tun politische Entscheider:innen und Medien immer wieder so, als sei der Staats»haushalt« mit unserem Privat»haushalt« vergleichbar, und
Schließlich müsse »erst mal genügend Geld eingenommen werden, um es woanders ausgeben zu können«. Das funktioniert nach der gängigen ökonomischen Lehre der sogenannten
Die MMT nimmt zu dieser Sichtweise eine fundamental gegensätzliche Position ein. Hier wird Geld als eine Art Steuergutschrift definiert, die der Staat in die Privatwirtschaft ausgibt. Dort können die Währungsnutzer:innen an sich nur 2 Dinge damit anfangen: Es untereinander gegen Waren und Dienstleistungen tauschen – oder Steuern an den Staat »zurückzahlen«. Maurice Höfgen erklärt das so:
Wenn der Staat Geld ausgibt, dann landet es auf unseren Bankkonten. Wenn er Steuern eintreibt, verschwindet das Geld von unseren Bankkonten. Gibt der Staat mehr aus, als er über Steuern einzieht – ein Staatsdefizit –, profitieren wir also finanziell davon. Die Ausgaben des Staates sind unsere Einkommen und die Schulden des Staates sind unsere Ersparnisse.
Das heißt auch: Staatsschulden bedeuten eben nicht, dass der Staatsbankrott droht, wenn die Kasse leer ist – schließlich ist es ja der Staat, der das Monopol auf das Geld hat. Oder um noch einmal zu unserem Monopoly-Beispiel zurückzukommen, in dessen Spielanleitung steht:
Wenn der Staat aber gar nicht darauf angewiesen ist, Geld einzutreiben, warum tut er es dann trotzdem?
Ein weiteres Gedankenspiel kann dabei helfen, die Rolle von Steuern aus Sicht der MMT besser zu verstehen. Es führt uns weg vom Monopoly-Spielbrett zu einer kleinen Auszeit – auf der Toilette.
Was du auf dem Klo über die MMT und Steuern lernen kannst
Spielpause! Während die Spielleiterin munter kleine Zettelchen mit Zahlen beschriftet, nutzt du die Zeit für einen Toilettengang. Als du verrichteter Dinge vor dem Waschbecken stehst, um dir die Hände zu waschen, fällt dir etwas auf:
Der Staat kontrolliert den Wasserhahn oben, darunter ist das Becken, das unsere Wirtschaft darstellt. Je nachdem, wie sehr der Staat den Hahn aufdreht, fließt mehr oder weniger Wasser (Geld) in das Becken (Wirtschaft). Steigen die Staatsausgaben, etwa indem Infrastrukturprogramme, Subventionen oder Konjunkturpakete beschlossen werden, füllt sich das Becken allmählich mit mehr Wasser.
Dabei muss den politischen Entscheider:innen natürlich klar sein, dass das Becken zwangsläufig irgendwann überlaufen wird, wenn sie den Hahn ungehemmt aufdrehen. Und genau das ist Inflation: Das Geld wird weniger wert, wenn zu viel davon im Umlauf ist. Die MMT hat diese Gefahr genau im Blick und ignoriert sie nicht, wie viele Kritiker:innen der neoklassisch geprägten Ökonomie ihr immer wieder vorwerfen.
Dass der Staat die in der Theorie ausgegebene Geldmenge unbegrenzt erhöhen könnte, heißt eben nicht, dass er dies auch tun sollte, wie auch Maurice Höfgen betont: »Das würde natürlich keinen Sinn machen. Aber nicht weil das Geld begrenzt ist. Die Grenzen sind reale Ressourcen wie Rohstoffe und Arbeitskraft und die Inflation.«
Glücklicherweise ist ein Waschbecken eine durchdachte Apparatur, die auf überlaufendes Wasser reagieren kann. Anstatt es einfach immer weiter steigen zu lassen, bis nasse Füße drohen, kann zunächst der Hahn wieder weiter zugedreht und so der Zustrom von Wasser verlangsamt werden. Ist das Becken trotzdem irgendwann gestrichen voll, ist es Zeit, den Abfluss zu öffnen und einen Teil des Wassers abzulassen. Genau diese Funktion nehmen unsere Steuern in der MMT ein: Sie dienen dazu, etwas von dem Geld, das der Staat ausgegeben hat, wieder aus dem Kreislauf herauszuziehen.
Dieser Mechanismus hat in der Realität allerdings einen gefährlichen Haken: Steuererhöhungen sind in den seltensten Fällen besonders populär. Wenn sich politische Entscheider:innen eher an ihrer Wiederwahl als an den theoretischen Maßgaben der MMT orientieren und den Hahn geöffnet lassen, anstatt den Stöpsel zu ziehen, kann die Situation schnell außer Kontrolle geraten. Andererseits sind aktuell die Zentralbanken mit der Aufgabe betraut, die Entwicklung der Inflation zu steuern – und diese sind im Gegensatz zu Regierungen weder demokratisch legitimiert noch abwählbar.

Nun wird es aber wirklich Zeit, das Badezimmer wieder zu verlassen, deine Mitspieler:innen werden langsam ungeduldig. Denn das Spiel neigt sich allmählich dem Ende zu und es heißt: Alle gegen den einen, der die ganze Kohle gescheffelt hat.
Wenn die MMT auf die Realität trifft
Alle Straßen und Bahnhöfe sind verkauft, die Felder mit Häusern und Hotels zugepflastert – und am Ende gehört alles
Im echten Leben aber gibt es diesen Zustand des Sieges nicht, wonach in einer folgenden Partie wieder alle Spieler:innen mit demselben Startkapital beginnen. Hier geht das Monopoly-Spiel einfach weiter. Und diejenigen, die viel Geld angehäuft haben, können die Preise und Regeln für die anderen bestimmen und ein ganz eigenes Spiel spielen. »Eine Nacht in meinem Hotel? Das kannst du dir nicht leisten – außer du gibst mir die ›Du kommst aus dem Gefängnis frei‹-Karte.«
Frustriert setzt du dich aufs Sofa und schmeißt den Fernseher an, kaum dass die Gäste aus der Tür sind. In den Nachrichten tritt gerade Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor die Kamera und verkündet, dass die Bundesregierung weitere Milliarden für Konjunkturpakete für die Wirtschaft bereitstellt. Hat da etwa gerade im Bad der Wasserhahn getropft?
Woher kommen aber plötzlich die Geldberge, die die Regierungen nun überall auf der Welt losschlagen, wo es doch in den letzten Jahren immer wieder heißt, dass die Budgets begrenzt oder sogar ausgereizt sind?
Verfechter:innen der MMT haben eine Antwort parat: Die Regierungen erschaffen das Geld einfach. Staatliche Finanzspritzen sind nämlich auch nur das Pendant zum Drucken neuer Geldscheine. Das haben sie an sich auch vorher schon getan, nur geschieht es diesmal in sehr kurzer Zeit und in aller Offenheit.
Doch nicht nur MMTler:innen sehen das so. 2005 wurde der ehemalige Vorsitzende der US-Notenbank, Alan Greenspan, als Zeuge vor dem Haushaltsausschuss zur Zahlungsfähigkeit des amerikanischen Sozialversicherungssystems befragt, worauf viele US-Amerikaner:innen für ihre Rente angewiesen sind. Die Frage war, was wohl passieren würde, wenn das staatliche Sozialversicherungssystem pleiteginge. Seine überraschende Antwort:
Ich würde nicht sagen, dass umlagefinanzierte Leistungen in dem Sinne unsicher sind. Es gibt nichts, was die US-Regierung daran hindert, als Zahlung an jemanden so viel Geld zu schaffen, wie sie will.
Laut Greenspan wäre vielmehr die Frage, ob genügend Ressourcen oder Vermögenswerte vorhanden sind, um einen Gegenwert für das geschaffene Geld zu haben. Also prinzipiell genau das, was Maurice Höfgen und andere Vertreter:innen der MMT sagen.
Auch Ben Bernanke, Greenspans Nachfolger, machte 4 Jahre später in einem Interview eine Aussage, die aufhorchen lässt.
Es ist kein Steuergeld. Die Banken haben Konten bei der Notenbank, ähnlich wie Sie ein Konto bei einer Geschäftsbank haben. Wenn wir also einer Bank einen Kredit gewähren wollen, nutzen wir einfach den Computer, um den Kontostand zu erhöhen. Das ähnelt viel mehr dem Drucken von Geld als dem Leihen.
Ob sie das Geld hätten, will der Interviewer daraufhin wissen. Bernanke antwortet: »Nun ja, effektiv schon. Und das müssen wir, denn unsere Wirtschaft ist sehr schwach und die Inflation sehr niedrig.«
Wenn die obersten Banker:innen der größten Volkswirtschaft der Welt nicht wissen, was im Rahmen der Geldpolitik passiert und möglich ist, wer dann? Und ihre Antworten lassen sich so zusammenfassen: Scheinbar ist das »Erschaffen des Geldes« gar nicht so schädlich, sondern kann unter den richtigen Umständen sogar vorteilhaft sein.
Genau das ist eine Feststellung, die die MMT ebenfalls trifft und die sie von der dominanten Geldtheorie der neoklassischen Ökonomie unterscheidet.
Was aber heißt all das nun für unsere Wirtschaft?
Das Geld fließt schon lange – nur nicht in unsere Zukunft
Prinzipiell ist die Politik, die Olaf Scholz und die Bundesregierung aktuell neben vielen anderen Ländern betreiben, genau das, was Ben Bernanke und die US-Regierung nach dem Finanzcrash 2008 getan haben: Geld ausgeben, das vorher nicht da war, um die Wirtschaft zu stützen. Sie malen neue Scheine, drehen den Wasserhahn etwas mehr auf.
Aber warum kriegen ausgerechnet Großkonzerne – also die, die das Spiel sowieso gerade gewinnen – so viel von diesem Geld?
Diese Frage birgt einiges an Sprengkraft. Denn wenn die Regierungen der Welt ohnehin schon das tun, was die MMT beschreibt, warum dann das geschaffene Geld nicht möglichst zukunftsträchtig investieren, statt Großkonzernen zu geben, die damit
Alles wieder auf Los. Hier ist das nötige Spielgeld. Auf ein neues, gerechteres Spiel!
Die Antwort lautet: Weil dann diejenigen, die das Spiel gerade gewinnen, ein wenig an Macht verlieren und abgeben müssten.
Genau das will die paneuropäische Initiative
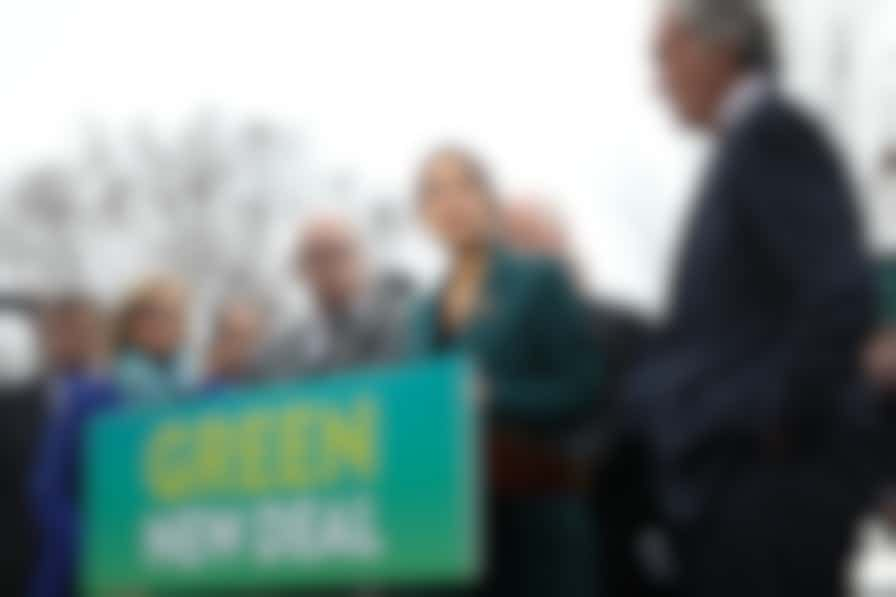
Der Ökonom und einflussreichste Verfechter der MMT im deutschsprachigen Raum, Dirk Ehnts, war als Teil des Autor:innenkollektivs an der konkreten Ausarbeitung des Konzepts beteiligt. In seinem
Beim Green New Deal steht die Bekämpfung des Klimawandels im Vordergrund. Der Staat soll den Klimawandel durch ein umfangreiches Paket an Maßnahmen bekämpfen. Dazu braucht er Ressourcen. Also muss er mehr Geld ausgeben, um diese Ressourcen für sich zu sichern.
Verhindert wurden staatliche Mehrausgaben in der EU zuletzt vor allem vom Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakt, der Sanktionen für Mitgliedstaaten vorsieht, die eine Neuverschuldung von mehr als 3% des Bruttoinlandsprodukts pro Jahr unter Strafe stellt. Doch 2020 ist alles anders und der Pakt wurde angesichts der Coronakrise bereits im März ausgesetzt, um umfangreiche Konjunkturpakete realisieren zu können.
So sollen von dem im Juli ausgehandelten EU-Coronahilfspaket im Umfang von 750 Milliarden Euro
Das scheint die Sichtweise vieler MMTler wie Maurice Höfgen zu bestätigen: »Das Schwierige ist nicht die Frage der Finanzierung eines Green New Deals – die ist aus Sicht der MMT trivial. Die schwierige Frage ist, wie wir die braune, fossile Industrie in eine Grüne transformieren. Und das, ohne dabei Arbeitslosigkeit und Inflation zu erzeugen und während des Prozesses die politische Unterstützung der Menschen dafür zu verlieren.«
Wenn es nach Dirk Ehnts und seinen Gleichgesinnten vom »Green New Deal for Europe« ginge, könnte der Umfang also noch wesentlich größer sein. Wichtiger sei die Frage, wie genau die Ausgaben den größtmöglichen Nutzen für eine nachhaltigere und sozial gerechtere Zukunft entfalten können. Ehnts schreibt:
Wichtig ist, dass die Demokratie Entscheidungsgrundlage bei der Suche nach Lösungen ist – für die Probleme, die uns in den letzten Jahrzehnten im Vertrauen auf den Markt entstanden sind. Bei der Frage, welche Ausgaben im Rahmen eines Green New Deals eigentlich zu tätigen sind, sollten wir uns auf die Wissenschaft verlassen.
Die »Roadmap für Europas sozial-ökologische Wende« ist hier als PDF-Datei abrufbar.
Mit Illustrationen von Doğu Kaya für Perspective Daily