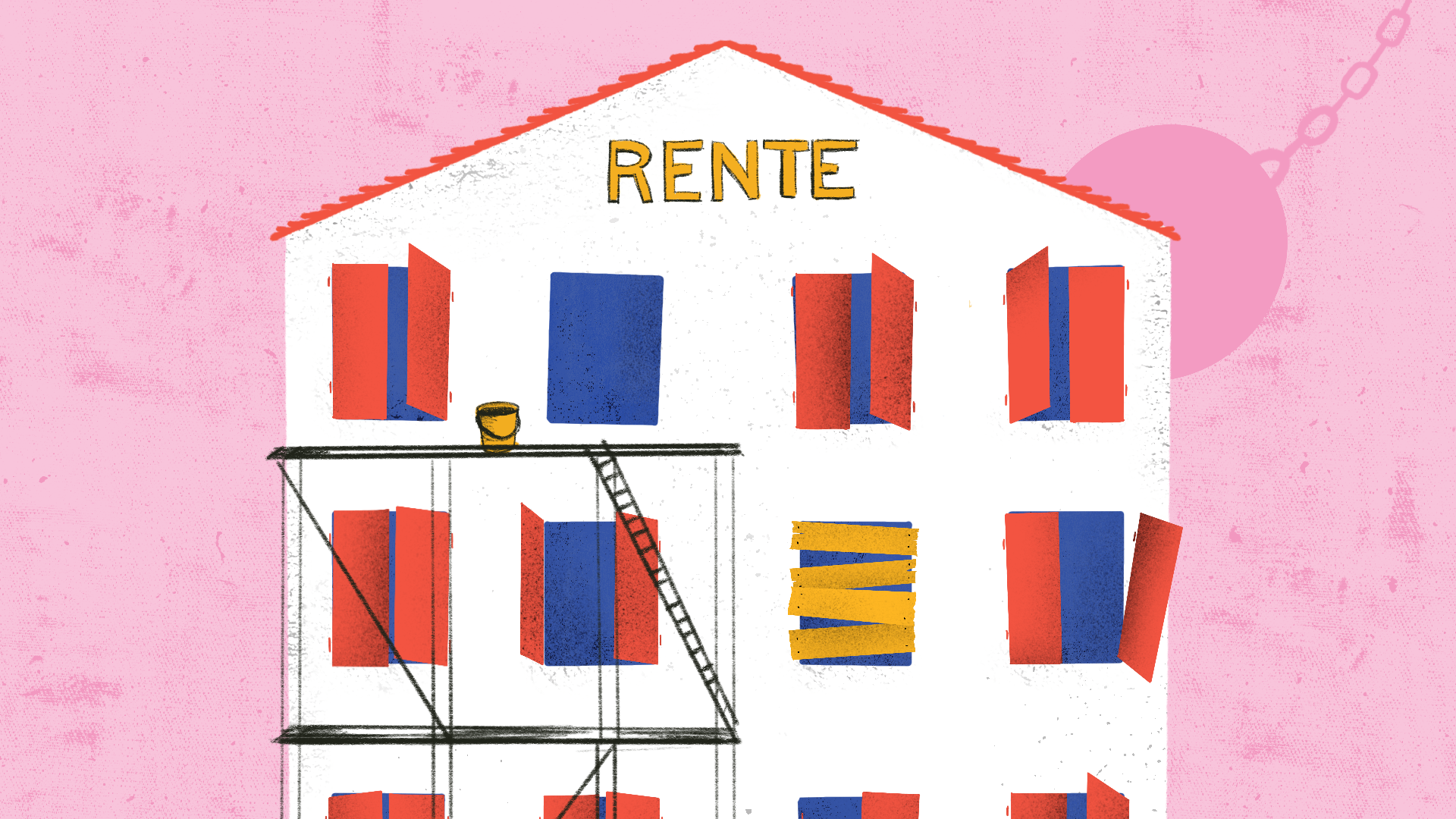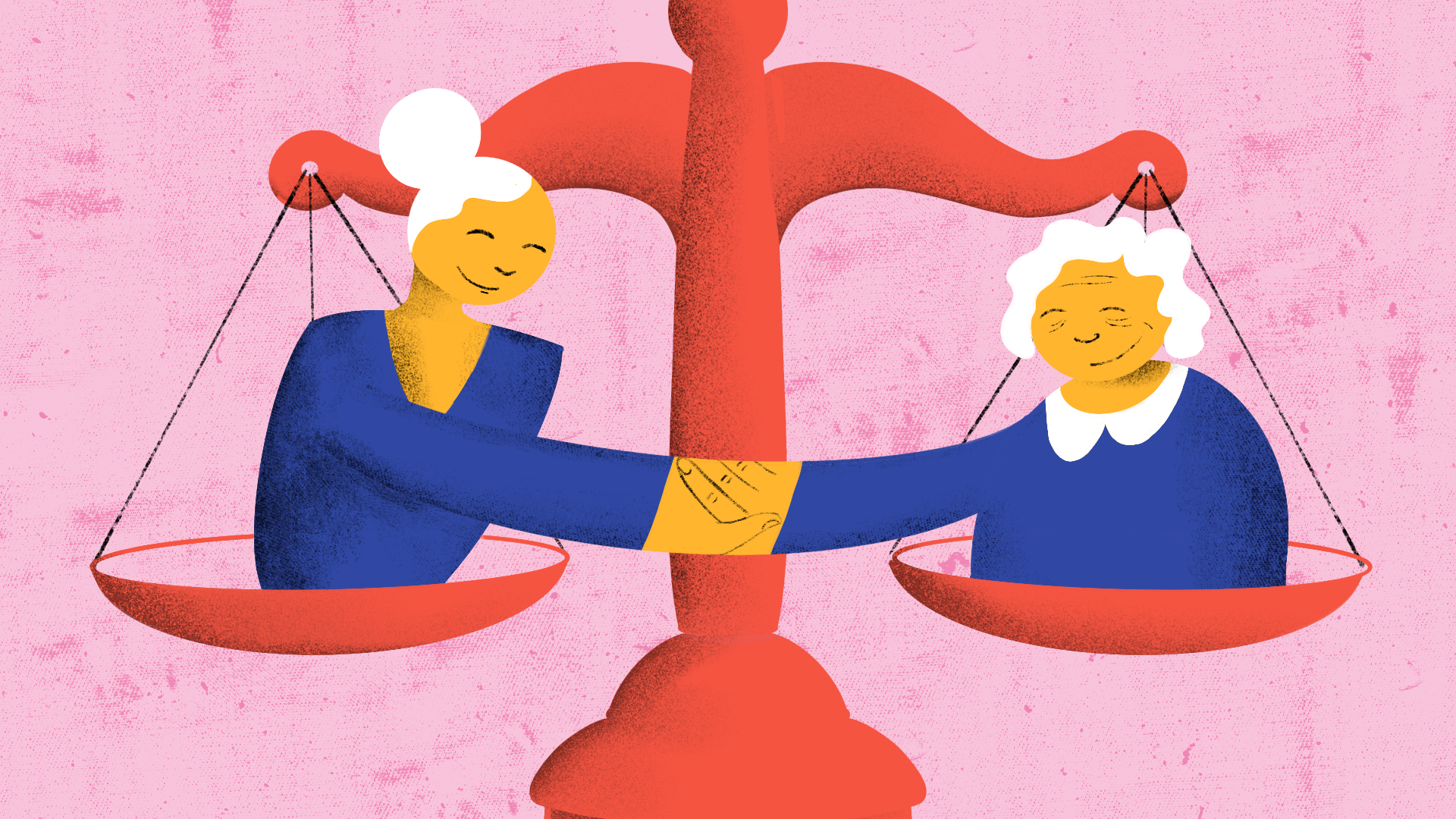Demografischer Wandel? Woran unsere Rente wirklich krankt
Glaubt man den Schlagzeilen, dann steht unser Rentensystem unweigerlich vor dem Kollaps, weil es zu viele alte und zu wenige junge Menschen gibt. Warum das so nicht stimmt und wer ein Interesse daran hat, dass du es trotzdem glaubst, erfährst du in diesem Text.
Beginnen wir mit dem vermeintlichen Untergang unserer Alterssicherung. Glaubt man den Schlagzeilen, die wieder und wieder den Untergang unseres Rentensystems verkünden, scheint es für die gesetzliche Rentenversicherung kaum eine Zukunft zu geben.
Erwartet uns ein »schrecklicher Renten-Ruin«, wie ihn die BILD-Zeitung hier prophezeit?
Wer nun denkt, dass nur die Boulevardpresse mit derartigen Schlagzeilen auf Leser:innenfang geht, irrt. Auch die Tagesschau nahm neben vielen anderen Medien die Kritik von Ökonom:innen am umlagefinanzierten Rentensystem zum Anlass, um eine alarmierende Frage zu stellen:
Rentensystem vor dem Kollaps?
All das ist nicht neu. Das Handelsblatt etwa sah das Rentensystem beispielsweise schon vor 8 Jahren, im Jahr 2013,
Trotz alledem zahlt die gesetzliche Rentenversicherung jedes Jahr verlässlich über 300 Milliarden Euro an rund 21 Millionen Rentner:innen in Deutschland aus – was nicht bedeutet, dass unser System nicht vor enormen Herausforderungen stehen würde.
Warum es sich dabei entgegen der landläufigen Meinung aber nicht in erster Linie um den demografischen Wandel handelt, wo wir stattdessen viel genauer hinsehen müssten und wer uns beweist, dass unser System nicht zum Scheitern verurteilt ist, erfahrt ihr heute in Teil 2 unserer Rentenreihe.
Wer meinen ersten Artikel zum Thema Rente verpasst hat oder sich noch einmal an die Grundideen unseres Rentensystems rund um dessen solidarischen Grundgedanken, Generationenvertrag und Umlagesystem erinnern möchte – bitte hier entlang:
1998: Eine historische Zeitenwende in der Bundesrepublik
1998 ist ein besonderes Jahr. Kurz vor der Jahrtausendwende sollte sich die politische Landschaft der Bundesrepublik so schlagartig wandeln wie niemals davor. Am Abend der Bundestagswahl am 27. September löst die Opposition aus SPD und den Grünen aus dem Stand die Regierung ab und beendet die 16-jährige »Ära Kohl«.
Der wohl wichtigste Grund für die radikale Trendwende ist das alles beherrschende Thema dieser Zeit: Arbeitslosigkeit. Bis zu 91% der Menschen geben gegenüber der Forschungsgruppe Wahlen an, dass die Sorge um den Job das größte Problem der Zeit sei. In den Jahren zuvor war es der Kohl-Regierung nicht gelungen, die seit der Wiedervereinigung kontinuierlich steigende Arbeitslosenrate von zwischenzeitlich fast 12% in den Griff zu bekommen.
Massenarbeitslosigkeit sei laut »Börsen-Zeitung« das neue »Markenzeichen Deutschlands«, die New York Times schreibt von »Elend, Krise, Lähmung«
Auch die gesetzlichen Sozialversicherungen gerieten angesichts der hohen Zahl von Erwerbslosen unter Druck. Die Ursache: Je weniger Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, desto weniger Beiträge fließen in die Kassen der Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung. Gleichzeitig steigen die Ausgaben der öffentlichen Hand für die Existenzsicherung der Menschen ohne Einkommen.
Ein Teufelskreis, der die nun politisch Verantwortlichen von SPD und Grünen unter großen Handlungsdruck setzte. Diese Situation entging auch den Bürger:innen nicht, die folgerichtig die Sorge um die Rente – wenn auch mit weitem Abstand –
Vor diesem Hintergrund holte die Regierung Schröder zu einem Paradigmenwechsel in den sozialen Sicherungssystemen aus, der bis dato undenkbar war – und bis heute für hitzige Kontroversen sorgt. Im Rahmen der »Agenda 2010« und weiterer umfangreicher Reformen wurden in den Jahren 1998–2005 im Geiste
Was das für die Rente bedeutet, erklärt Florian Blank, Experte für Sozialpolitik am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung: »Grundsätzlich galt in Deutschland: Löhne und Renten steigen parallel. Angesichts des demografischen Wandels und dem Eindruck der hohen Arbeitslosigkeit wurde zu Anfang des Jahrtausends von dieser Logik abgewichen.« Anstelle dieses Automatismus sollte künftig bei den jährlichen Berechnungen zu den Rentenerhöhungen berücksichtigt werden, wie sich die Beitragssätze der Erwerbstätigen zur Rentenversicherung sowie deren Einnahmen und Ausgaben entwickeln. So sollte verhindert werden, dass Einzahlende kontinuierlich mehr abgeben müssen, während die Bezüge der Rentner:innen wie bisher weiter steigen.
Jährliche Rentenanpassung
Der zentrale Faktor für die jährliche Rentenanpassung war bis zu den rot-grünen Reformen allein die Entwicklung der jährlichen Nettolöhne (siehe Teil 1 der Artikelreihe). Seither fließt auch mit ein, wie hoch der aktuelle Beitragssatz zur Rentenversicherung und deren Einnahmen- und Ausgabensituation ist. Die Rente steigt also nicht länger »automatisch« von Jahr zu Jahr.
So weit, so nachvollziehbar. Doch ein weiterer Grundsatz der gesetzlichen Rentenversicherungen kommt durch die Reformen zu Fall: Das Ziel, den vorherigen Lebensstandard der Rentner:innen bis zu einem gewissen Grad allein durch die öffentliche Rentenversicherung abzusichern. »Das Gesetz ist ein Teil notwendiger Veränderungen«, kommentiert die damalige Sozialministerin Ulla Schmidt (SPD) im Jahr 2004, da die gesetzliche Rente allein nicht mehr in der Lage sei, dieses Ziel ohne Privatvorsorge der Bürger:innen zu erreichen.
Dass sie mit dieser Einschätzung nicht Unrecht hatte, zeigt sich heute an der vergleichsweise stabilen Abgabenlast der Versicherten.
Der Beitragssatz zur Rentenversicherung entwickelt sich zuletzt stabil
Entwicklung des Beitragssatzes der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland in den Jahren 1990–2023
Nach 2 Legislaturperioden, einem gescheiterten Misstrauensvotum und vorgezogenen Neuwahlen kam die Zeit der Regierung Schröder 2005 zu einem vorzeitigen Ende – auch wenn der ehemalige SPD-Kanzler das bis zum Schluss so nicht wahrhaben wollte, wie er noch am Wahlabend unter Beweis stellte.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel eingeht, in dem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Wir müssen die Kirche auch mal im Dorf lassen. (…)
Dieser Abend sollte der Beginn der nächsten 16 Jahre unter der Regie der Union als stärkste Regierungspartei werden – und entgegen den Aussagen Schröders agierte die SPD in 12 davon als Juniorpartner der Konservativen. Doch im Gegensatz zu den Schröder-Jahren blieben seither größere Kurswechsel in Sachen Rentensystem aus – mit Ausnahme der Anhebung des Renteneintrittsalters, der »Rente mit 67«.
Alles, was in den letzten Jahren kam, ist in das laufende System eingebaut worden. Das, was vorher unter Rot-Grün und der ersten großen Koalition gemacht wurde, also das Anheben des Renteneintrittsalters oder das Absenken des Rentenniveaus, ist in der folgenden Phase weder beschleunigt noch substanziell korrigiert worden. Mit einer Metapher könnte man es so beschreiben: Die Rentenversicherung ist ein Haus, das ein bisschen wackelig ist, denn durch das schon abgesenkte Leistungsniveau bietet es manchen alten Menschen schon jetzt kein echtes Dach mehr über dem Kopf. In dem Haus wurden jetzt noch einmal Fenster ausgetauscht oder der Wintergarten ist saniert worden. Aber es hat keine Kernsanierung gegeben. Es wurden lediglich ein paar Risse überdeckt.
Doch die Risse, die bisher nur geflickt wurden, bringen das Rentengebäude nach und nach weiter zum Bröckeln. Was uns zu einem kleinen Zeitsprung in unsere Gegenwart führt. Und uns damit zur Abrissbirne bringt, die seit der Regierungszeit Schröders über dem Rentengebäude baumelt: der viel zitierte demografische Wandel.
Wird er unser Rentensystem in absehbarer Zeit wirklich zum Einsturz bringen? Steht die gesetzliche Rentenversicherung nach über 60 Jahren tatsächlich vor dem Aus?
Warum der demografische Wandel nicht als Totschlagargument taugt
Erst im Juni dieses Jahres erschien
Kurz zusammengefasst lauten die Kernpunkte des Papiers so:
- Im Jahr 2018 wurde gesetzlich garantiert, dass das Rentenniveau nicht unter 48% des Durchschnittslohns fallen darf und die Rentenbeiträge nicht höher als 20% steigen.
- Bereits 2012 wurde durch den Gesetzgeber in gewissen Fällen die »Rente mit 63« ermöglicht, die dazu geführt hat, dass das Defizit in der Rentenversicherung weiter ausgeweitet wurde und immer mehr Mittel aus dem Bundeshaushalt in die Rentenkasse fließen müssen, um das Rentengebäude zu kitten. Im Jahr 2019 flossen so 1/4 des gesamten Bundeshaushaltes in die Rentenversicherung, Tendenz steigend.
- Daher sehen die Autor:innen des Papiers künftig die Kopplung des Renteneintrittsalters an die steigende Lebenserwartung als »unumgänglich« an, und zwar schrittweise bis hin zu 68 Jahren.
»Rente mit 68« ist eine dieser Formulierungen, womit sich hervorragend Schlagzeile machen lässt – und die vielen Menschen der Beleg dafür zu sein scheint, dass unser Rentengebäude abrissreif ist und auf Dauer nicht nachhaltig funktionieren kann. Die Geschichte dahinter geht meist so: Wir haben in unserer Gesellschaft zu viele alte und zu wenige junge Menschen, die für sie »aufkommen«. Daher ist die Rentenversicherung zum Scheitern verurteilt und es muss dringend etwas Neues her.
Doch es lohnt sich, genauer hinzusehen. Die Autor:innen der Studie sehen den Grund für die akuten Probleme nicht primär in der Alterung der Gesellschaft – sondern vor allem in politischen Entscheidungen der letzten Jahre. Auch Rentenexperte Florian Blank plädiert für einen differenzierten Blick auf die Auswirkungen des demografischen Wandels, hat aber einen deutlich abweichenden Blick auf Handlungsmöglichkeiten in der Rentenversicherung: »Natürlich wäre es falsch zu sagen, alles sei super. Ich will nicht schönreden, dass die gesetzliche Rentenversicherung geschwächt worden ist. Dennoch habe ich ein Problem damit, in diesem Zuge die gesetzliche Rentenversicherung an sich als ein erfolgreiches Instrument abzuschreiben – besonders wenn als Alternative die Finanzmärke mit all ihren Anlagerisiken angepriesen werden.«
So sei es schon sehr lange klar, dass die Bevölkerung altert – nur sei da entgegen den häufig verbreiteten Untergangsszenarien nichts Schlimmes dran.
»Rente vor dem Kollaps« – Focus, April 2021
»Dass wir länger leben, ist doch erst einmal etwas Gutes.« Der demografische Wandel ist natürlich eine Herausforderung – er bedeute aber zunächst lediglich: mehr Alte, weniger Junge. »Die Frage aus Rentensicht ist aber: Ist das überhaupt das relevante Verhältnis? Die Relation, die für die Stabilität der Alterssicherung eigentlich wesentlich ist, lautet: Rentner:innen einerseits und Beitragszahlende andererseits.«
Und die Zahl der Beitragszahlenden steigt seit Jahren kontinuierlich, was die grundlegende Finanzierung der Alterssicherung auch bei einer sinkenden Zahl von Jüngeren zunächst einmal sicherstellt.
Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten wächst
Das zeigt: Wir haben es hier also keinesfalls mit einem Generationenkonflikt zu tun, der immer wieder durch Titel wie
Liegen die eigentlichen Konfliktlinien nicht zwischen Arm und Reich oder Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden? Spricht man vom Generationenkonflikt, ist das möglicherweise ein Versuch, andere Konflikte auszublenden.
Wie kommt er zu dieser Aussage – und was bedeutet das für die Zukunftsfähigkeit unseres Rentengebäudes?
Wie wir unser Rentengebäude wieder auf Vordermann bringen können
Der demografische Wandel taugt entgegen den vielfach wiederholten Schlagzeilen nicht als pauschales Totschlagargument für unausweichliche Rentenkürzungen oder eine unumgängliche Erhöhung des Eintrittsalters.
In einigen Fällen liegt die Vermutung nahe, dass über diesen Strohmann versucht wird, »alternativlose« Sachverhalte heraufzubeschwören, um damit Politik zu beeinflussen. Um etwa die Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung, die von Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden zu gleichen Teilen gezahlt werden, nach unten zu drücken – zum Nachteil der Beitragszahlenden, die so zu immer schlechteren Konditionen in Rente gehen. Die Arbeitgeber:innenseite hat hingegen naturgemäß ein Interesse daran, hier große Summen an Lohnnebenkosten einzusparen, und
Vor diesem Hintergrund würde es der Diskussion um die Zukunft unseres gemeinsamen Rentengebäudes guttun, diese 3 Punkte ins Rampenlicht zu rücken:
- Für ein starkes Fundament – gute Jobs für gute Rente
Je mehr Menschen einen angemessen bezahlten, sozialversicherungspflichtigen Job finden, desto stabiler sind die Einnahmen der Rentenversicherung. Das bedeute laut Florian Blank jedoch nicht, dass alles andere als ein Vollzeitjob gleich problematisch sein muss: »Nicht jede Form von atypischer Beschäftigung ist gleich prekär oder ein Problem für die Rentenversicherung. Aber es bleibt dabei, dass gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen dazu beitragen, dass die Rentenversicherung auf soliden Füßen steht und Menschen Ansprüche auf eine gute Rente erwerben.«
So sind es in Deutschland vor allem die Geringverdienenden, die die größten Probleme mit einer zu geringen Rente haben. Schließlich können sie kaum etwas oder gar nichts einzahlen, um Rentenpunkte zu sammeln. Ihre Zahl ist in den letzten 25 Jahren immer weiter gewachsen, heute ist jede:r vierte Arbeitnehmende im Niedriglohnsektor beschäftigt.
- Liquiditätsspritze für die Sanierung – eine solidarische Versicherung für alle
Schon das historische wissenschaftliche Konzept der gesetzlichen Rentenversicherung aus den 50er-Jahren sah vor, dass möglichst wenige Berufsgruppen aus dem Solidarsystem ausgenommen werden sollten. Der damalige CDU-Kanzler Adenauer klammerte dennoch Selbstständige und Beamt:innen aus (siehe dazu Teil 1). Auch heute noch sprechen sich Union und FDP gegen eine solche Erwerbstätigenversicherung aus, während sie von Grünen, SPD und der Linken befürwortet wird.
Ein solcher Schritt könne laut Florian Blank für einige Jahrzehnte zu einer Entspannung in der Rentenkasse führen – auch wenn er darin kein Allheilmittel sieht: »Später müssen an diese Gruppen natürlich auch wieder entsprechende Leistungen ausgezahlt werden. Es würde also nicht einfach eine Art Schatzkiste geöffnet werden und alle sind glücklich.«
Zuvor müssten ernsthafte Diskussionen mit den betroffenen Gruppen geführt und alles geprüft werden, da nicht einfach mit einem radikalen Schnitt von der vorherigen Beamtenversorgung auf das Modell Rentenversicherung gewechselt werden könne. Ein Übergang müsse hier schrittweise mit den dann neu zu Versichernden vollzogen werden. - Ein stabiles Haus für alle – unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigen
Zu einer ehrlichen Diskussion über die Zukunft der Rente gehört es auch, vor dem gesellschaftlichen Wandel trotz der stärkeren Berücksichtigung der Arbeitsverhältnisse nicht die Augen zu verschließen. Es ist nicht zu bestreiten, dass viele Menschen immer älter werden und somit auch länger Rente beziehen, als es früher der Fall war. Diese Menschen altern – erfreulicherweise – inzwischen immer häufiger gesund. Doch besonders für diesen sensiblen Punkt gilt: Es muss genau hingesehen und differenziert werden – und zwar einmal mehr anhand der Unterscheidung zwischen Arm und Reich. Denn im Schnitt werden wir zwar immer älter – aber das gilt leider nicht für alle.
Insbesondere für Menschen, die körperlich hart arbeiten und geringe Löhne erhalten, gilt dies nicht. Denn im Schnitt werden wir zwar immer älter, doch auch bei der Lebenserwartung geht die Schere zwischen Arm und Reich auseinander. Für den Fliesenleger mit magerem Salär ist es ungleich härter, bis 65 oder länger zu arbeiten, als für die Anwältin in Teilzeit, die finanziell ohnehin ausgesorgt hat. Da die Lebenserwartung dieser Menschen zudem geringer ist als die von Wohlhabenden, erhalten sie unterm Strich weniger Rente. Auch auf diese Weise subventionieren arme Menschen die reicheren. Arbeiten also diejenigen länger, die es gut können, ist das auch ein Akt der Solidarität.
Die Österreicher:innen beweisen, dass unser Rentengebäude nicht abrissreif ist
Dass eine kontinuierliche Erhöhung des Renteneintrittsalters aber alles andere als »alternativlos« ist, beweist unser Nachbarland Österreich. Dort bildet nach wie vor in erster Linie die umlagefinanzierte öffentliche Rentenversicherung das Rückgrat der Alterssicherung, während wir in Deutschland vor knapp 20 Jahren unter der Regierung Schröder in Richtung privater Altersvorsorge abgebogen sind.
Dafür steht im Zentrum des österreichischen Systems nach wie vor der Anspruch der Lebensstandardsicherung nach der sogenannten 80/45/65-Formel: 80% Bruttoersatzrate bezogen auf das durchschnittliche Einkommen während des Erwerbslebens bei 45 Versicherungsjahren und Renteneintritt mit 65. Dafür bekommen die durchschnittlichen österreichischen Rentner:innen dann auch einiges: Während in Deutschland am Ende für
Die Frage, was uns eine stabile und verlässliche Alterssicherung kosten darf, ist also nicht allein eine ökonomische. Viel mehr lautet sie: Was ist uns eine gute Rente wert? Ob wir uns auf höhere Kosten einlassen würden, ist eine politische Frage.
Doch um diese richtig diskutieren zu können, müssen wir offen benennen, was die Ursachen der heutigen Armutsrenten sind: Nämlich schlechte Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und
So könnten wir mittelfristig wieder mehr Vertrauen in unser Rentensystem entwickeln – ein System, das trotz all seiner Reformbedürftigkeit besser ist als sein Ruf.
Mit Illustrationen von Mirella Kahnert für Perspective Daily