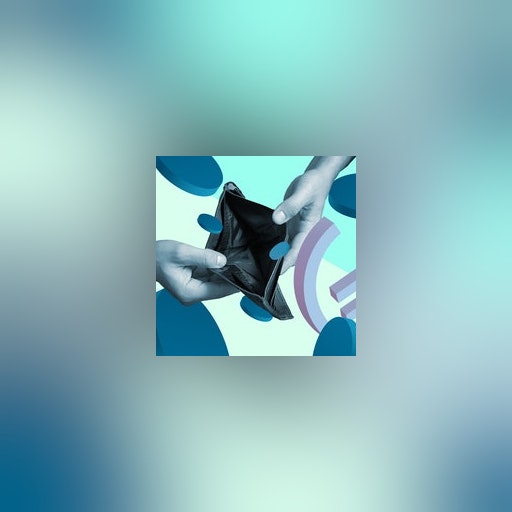»Ich fühle mich nicht arm, ich fühle mich im Stich gelassen«
Auch wer Arbeit hat, kann arm sein. Betroffene sprechen darüber, warum direkte Nothilfe für sie wichtig ist, aber nicht alle Probleme löst. Teil 2 unserer Serie über Armut in Deutschland 2021.
Dieser Artikel ist Teil 2 der Reihe über Armut in Deutschland. Falls du den ersten Teil noch nicht gelesen hast, findest du ihn hier.
Früh aufstehen, zur Arbeit gehen, Leistung bringen – und trotzdem reicht diese Anstrengung am Ende des Monats nicht aus, um davon leben zu können. Arm trotz Arbeit – das gibt es überall auf der Welt, auch hierzulande. Und zwar häufiger, als man sich das gemeinhin vorstellt.
Wie bei
Die alleinerziehende Mutter kann deswegen nur in Teilzeit arbeiten. Sie ist Schulbegleiterin für ein Kind mit Behinderung. Ihre Arbeit empfindet sie als wichtig, auch wenn sie eigentlich nicht genug verdient, um mit ihrem Sohn über die Runden zu kommen. »Die Kinder können ja nichts dafür, dass die Arbeit mit ihnen nicht besser bezahlt ist«, sagt Ute Christensen.
Ihrem 10-jährigen Sohn ermöglicht sie den Besuch einer
»Die Kinder können ja nichts dafür, dass die Arbeit mit ihnen nicht besser bezahlt ist.«
Ihr Einkommen kann sie nicht mit Arbeitslosengeld II ergänzen, denn dafür verdient sie ein paar Euro zu viel. Sie lebt in einer Grauzone und fällt damit durch alle Raster. »Andere Eltern haben mir auf dem Spielplatz vorgerechnet, dass ich mit Hartz IV mehr Geld zur Verfügung hätte«, sagt sie. Im Jobcenter habe man ihr auch gesagt, sie hätte sich ja nicht von ihrem Mann trennen müssen, der verdiene schließlich gut. Dabei war sie vor seiner Gewalt geflohen.
Arm trotz Arbeit
Weil sie kein Geld für eine Waschmaschine hatte, musste Ute Christensen nach der Trennung von ihrem Mann immer wieder in sein Haus zurück, um Wäsche zu waschen. Eine einfache, aber sehr reale Abhängigkeit. Die Direkthilfe
An Lebensgeschichten wie dieser wird deutlich: Selbstverschuldete Armut durch Faulheit – ein problematisches Narrativ. Laut Armutsbericht (2020) des Paritätischen Gesamtverbandes sind etwa
Erwachsene Arme nach Erwerbsstatus in Deutschland 2019
Zahlenangaben in Prozent
Knapp 30% der armen Menschen sind
Unterm Strich heißt das: Nicht einmal jeder zehnte von Armut Betroffene ist das, was im Volksmund gemeinhin als »arbeitslos« bezeichnet wird. Auch der viel beschworene Satz
So wie im Fall von
Das Team von »EineSorgeWeniger« hat Schröder, der seit 2005 Arbeitslosengeld II bezieht, mit Kleidung ausgeholfen. In Kleiderkammern habe er durch sein Übergewicht Schwierigkeiten, etwas für sich zu finden. Schröder bleiben nach Abzug von Strom- und Telefonkosten 340 Euro zum Leben. Ihm helfe sehr, dass er zusammen mit einem guten Freund in einer Wohngemeinschaft lebe.
Ist Direkthilfe die Krücke eines kaputten Systems?
Ob Kleidung, Elektrogeräte oder Lebensmittel: Initiativen wie »EineSorgeWeniger« oder die Tafeln unterstützen Menschen, die unter Armut leiden, versorgen sie mit dem Nötigsten, damit sie ihren Alltag meistern können. Dennoch gibt es dafür nicht nur Lob. Kritische Stimmen werfen ihnen immer wieder vor, das ungerechte System aus florierendem Niedriglohnsektor und schlankem Sozialstaat zu stützen. Eben dadurch, dass sie eine Aufgabe übernähmen, die eigentlich der Staat ausfüllen müsste – allen ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Ganz von der Hand zu weisen ist das nicht.

Der Kölner Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge hat jahrzehntelang zu Armut und Ungleichheit geforscht und kennt das Sozialsystem gut. Vor den Hartz-Reformen habe es sogenannte wiederkehrende einmalige Leistungen gegeben: »Wenn der Wintermantel nicht mehr passte, dann gab es einen neuen. Entweder aus der Kleiderkammer des Sozialamtes oder man bekam das Geld dafür. Dasselbe galt auch zum Beispiel bei einer kaputten Waschmaschine.«
»Das Grundproblem kann nur in den Parlamenten gelöst werden.« - Sasa Zatata, Armutsbetroffene
Einerseits ziemlich genau das, was »EineSorgeWeniger« jetzt übernimmt. Allerdings gibt es andererseits diesen Bedarf, der ohne die gemeinnützige Stiftung im jetzigen System ungedeckt bliebe. Eine ethisch-moralische Zwickmühle. Ute Christensen wie auch Ralf Schröder sehen die Hilfe der Ehrenamtlichen sehr positiv, weil sie in konkreten Situationen ihre Not gelindert hat.
Auch Sasa Zatata sagt: »Den Menschen muss im akuten Moment geholfen werden. Da ist zunächst egal, ob es eigentlich eine staatliche Aufgabe wäre. Das Grundproblem muss und kann aber natürlich nur in den Parlamenten gelöst werden.« Doch dieser Weg sei ihr persönlich nun durch Krankheit und Armut versperrt.
Der Weg zur nachhaltigen Veränderung muss also über die Politik, die Gewerkschaften oder eine Bürger:innenbewegung führen. Aber politisch Einfluss zu nehmen, ist für Menschen in Armut ungleich schwieriger als für solche, die sich nicht jeden Tag um ihre Existenz sorgen müssen. Zum einen haben viele arme Menschen kein großes Vertrauen darin, dass ihre Stimme bei einer Wahl etwas bewirken kann. Sie fühlen sich oft ohnmächtig, wählen seltener und verlieren somit erst recht Gewicht im Vergleich zur Mittel- und Oberschicht.
Ein anderer Grund sei die Schuldzuweisung, die im Hartz-System stecke, sagt Ungleichheitsforscher Christoph Butterwegge. Der Gedanke: Wer arm ist, müsse ja irgendwie selbst dafür verantwortlich sein. Der Ausspruch »Jeder ist seines Glückes Schmied« verdeutlicht diese verbreitete Einstellung.
Im Grunde wird den Armen die Selbstermächtigung verwehrt, indem man sie zu den Verantwortlichen oder zu den Schuldigen erklärt.
Auch das Menschenbild des sogenannten Homo oeconomicus aus der Mainstream-Ökonomie prägt unsere Sicht auf andere. Demnach sei der Mensch ein rationales und egoistisches Wesen, das immer das Beste für sich selbst herausholen wolle und dafür auch das Sozialsystem rücksichtslos ausbeute, um vermeintlich »auf der faulen Haut« liegen zu können. Die Statistik zeigt, dass dieses Menschenbild nicht haltbar ist.
Auch eine inzwischen berühmte Aussage von Grünen-Chef Robert Habeck zur Übernahme der gestiegenen Heizkosten bei armen Menschen spiegelt diesen allgegenwärtigen Geist wider:
Solange dieses problematische Menschenbild derart in die Gesellschaft eingebrannt ist, dass es selbst links der politischen Mitte immer wieder reflexartig an die Oberfläche kommt, wird es schwer, einen Konsens für eine gerechtere Gestaltung des Sozialsystems zu erreichen.
Ein solches neu aufgesetztes System dürfte dann nicht auf Fordern, Kontrolle und Strafe aufgebaut sein, sondern müsste auf Vertrauen und der Deckung des tatsächlichen Lebensbedarfs von Menschen fußen. Wenn das aber nicht der Fall ist, braucht es konkrete Nothilfe. »EineSorgeWeniger« möchte hier andocken und einen Schritt weiter gehen.
»Unser Ziel ist Empowerment«
Die »OneWorryLess«-Stiftung, so der offiziell eingetragene Name, möchte Armutserfahrungen sichtbar machen. Sie hat dazu einen eigenen Hashtag kreiert. Unter #EinWortMehr sollen Menschen auf Twitter von ihren Armutserfahrungen berichten und sich so aus der Defensive befreien. »Unser Ziel ist Empowerment von Armutsbetroffenen«, sagt Konstantin Seefeldt, Co-Gründer der Stiftung. »Es geht darum, zu vermitteln, dass man sich nicht kleinmachen muss, wenn man Pech hat und strauchelt«, fügt seine Mitstreiterin Natalie Schöttler hinzu.
Aufmerksamkeit, so die Grundidee, soll der Wegbereiter für ein gesellschaftliches Umdenken sein, das den Weg zu politischen Veränderungen öffnet. Die gesellschaftliche Erzählung über Armut müsse sich verändern. »Wenn ein größer werdender Teil der Gesellschaft umdenkt, auf Partys, im Freundes- und Familienkreis den Klischees von Armen als Sozialschmarotzern widerspricht, dann hat die Politik irgendwann ein ganz opportunistisches Interesse, darauf zu reagieren«, sagt Natalie Schöttler.
Politikwissenschaftler Christoph Butterwegge sieht im Politischen den einzig wirksamen Hebel. Persönliche Schicksale könnten Gegner immer schnell mit Gegenbeispielen kontern. »Wir müssen wegkommen von der individuellen Ebene. Almosen sind eine mittelalterliche Form der Armutsbekämpfung, die auf Empathie von materiell Bessergestellten basiert. Wir sollten uns für eine moderne Art der Armutsbekämpfung entscheiden – das ist der Um- und Ausbau des Sozialstaates.«
An Vorschlägen, wie die Situation politisch verbessert werden kann, mangelt es nicht.

Mehr Klassen-Mobilität wagen
Doch wer selbst in die Politik möchte, um etwas zu verändern, muss sich durchbeißen und braucht einen langen Atem. Diese Erfahrung hat auch SPD-Politikerin Sasa Zatata gemacht. Geht es um Positionen, die Macht versprechen, wie zum Beispiel Bundestagskandidaturen, werden auch Parteien wie die SPD schnell recht konservativ und setzen lieber auf etabliertes und beruflich erfolgreiches Personal.
Menschen, die aus längerer Arbeitslosigkeit in den Bundestag kommen, finden sich zum Beispiel nicht, Handwerker:innen gibt es selten, dagegen viele Menschen mit akademischem Hintergrund. Die Politik ist hier ein Spiegel der gesamtgesellschaftlichen Ungleichheit.
Das Schaubild in diesem Tweet zeigt: Während es die Hälfte der Söhne von wohlhabenden Vätern in Deutschland unter die einkommensstärksten 25% schafft, gilt dies nur für 10% der Söhne mit einkommensschwachen Vätern.
Das war Teil 2 der Reihe über Armut in Deutschland. Im dritten Teil erklären Expert:innen, wo sie Potenzial für Veränderung sehen, wie sie die bisherigen Positionen der künftigen Ampelkoalition zum Umbau des Sozialstaates bewerten und was sich ihrer Ansicht nach tun müsste, um Armut in Deutschland ernsthaft zu bekämpfen.
Hier findest du die anderen beiden Teile der Serie:
Mit Illustrationen von Doğu Kaya für Perspective Daily