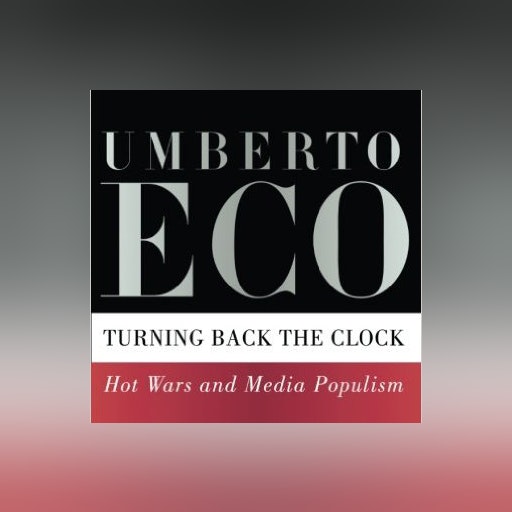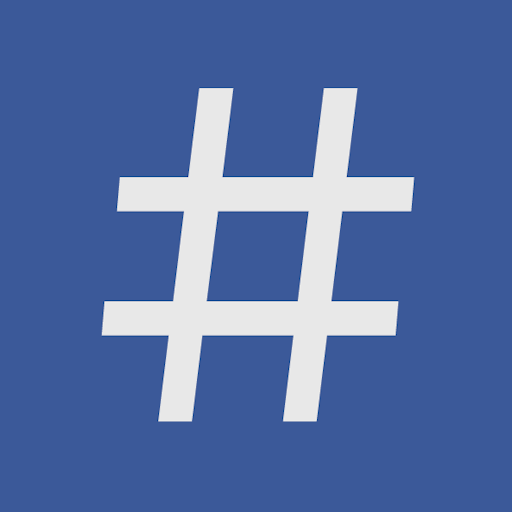Das wird man wohl noch sagen dürfen!
Warum reden wir nicht einfach, wie wir wollen?
Redaktionelle Anmerkung: Dieser Text ist vor über 3 Jahren entstanden. Hinter meiner Argumentation stehe ich nach wie vor: Wir sollten auch über verletzende und kontroverse Worte offen sprechen und diskutieren können. In der ersten Fassung dieses Textes habe ich das N-Wort ausgeschrieben. Doch gerade in den letzten Jahren wurde darüber viel diskutiert. Menschen, die betroffen sind, haben beschrieben, wie sehr es sie verletzt. Wie kann ein Diskurs konstruktiv sein, der viele Betroffene auf diese Weise ausschließt? Deshalb habe ich mich dazu entscheiden, das N-Wort selbst nicht auszuschrieben. Ich benutze aber Zitate von Menschen, die das nicht so sehen, gerade, weil ich die Realität abbilden will. Deshalb spreche ich vorab eine Triggerwarnung aus.
Neulich diskutierte ich mit einem Freund über Migration. Da fiel er mir plötzlich ins Wort:
Ausländer darfst du nicht mehr sagen, Herr Journalist. Das ist diskriminierend.
Verwundert zückte ich mein Smartphone und schlug beim Duden nach. »Ausländer: Angehöriger eines fremden Staates oder Staatenloser.«
Und was soll ich stattdessen sagen?
Das musst du wissen.
Der Duden hatte auch darauf eine Antwort:

Das Gespräch ließ in mir ein unbestimmtes Gefühl von Widerwillen zurück. Wann genau haben wir angefangen, unsere Sprache so zu verdrehen?
Wir müssen über die Taka-Tuka-Kultur reden
Sie tauchen in Zeitungen auf, in Regierungstexten, in Reden, in Kinderbüchern und sogar bei sozialen Medien:merkwürdige neue Wörter. Eines der ersten Opfer war ausgerechnet die Rebellin Pippi Langstrumpf. In der Neuauflage des Kinderbuchklassikers heißt der
Längst ist dieser Trend nicht nur in Kinderbüchern zu finden. So werden aus Behinderten »körperlich eingeschränkte Menschen«, aus Arbeitslosen »Beschäftigungssuchende« und aus Schülern aus Gründen der Gleichberechtigung »Schülerinnen und Schüler« – letzteres ist sogar so lang und umständlich, dass selbst Lehrer es zu »SuS« verkürzen.
Nicht einmal vor religiösen Texten macht Taka-Tuka halt. Besonders absurd wirkt die
Was soll das? Ist das der übersensible Versuch, nirgendwo anzuecken und es allen Recht zu machen? Als Germanist bin ich durchaus offen für sprachliche Experimente, doch wenn ich über jedes Wort 3 Mal nachdenken muss, vergeht auch mir die Lust.
»Ich will«: Wer spricht, handelt
Die Idee hinter all dem ist der gezielte Versuch, durch Sprache weniger zu diskriminieren. Das Schlüsselwort heißt:
Eine, die sich intensiv mit sprachlichen Tabus beschäftigt, ist Heidrun Kämper. Sie arbeitet als Linguistin am Institut für Deutsche Sprache in
Politically Correct:
Probieren wir diese Definition von Political Correctness mal an einem historischen Satz aus. Ist das für dich diskriminierend und damit politisch nicht korrekt?

Wie hätte Bayerns Innenminister den Sänger stattdessen bezeichnen sollen?
Deutsch-Afrikaner wäre sicher ungefährlich gewesen und »N*****« mit Sicherheit diskriminierend. Doch bei Wörtern wie Schwarzer und Schwarzafrikaner bewegen wir uns in einem sprachlichen Graubereich. Tatsächlich unterliegen Wörter einem laufenden Bedeutungswandel, erklärt Heidrun Kämper. Eine immer gültige Liste mit diskriminierenden Wörtern kann es daher nicht geben. Wer sich unsicher ist, kann seit 1999 im Duden nachschlagen und findet hinter bestimmten Wörtern eben besondere Hinweise. Welche Begriffe markiert werden, bestimmt zwar die Redaktion des Duden-Verlags, doch die orientiert sich damit an der tatsächlichen Sprachpraxis
Mit Zensur von oben hat das nichts zu tun. Die Gesellschaft hat einfach ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass man mit der Verwendung bestimmter Wörter Personen verletzen kann, und nimmt Rücksicht.
Hinter dieser Erkenntnis stehen 4 Eigenschaften von Sprache:
- Wer spricht, handelt auch: Sonst wäre das »Ich will« am Traualtar nicht mehr als
- Bedeutungen: Wörter und Begriffe haben immer auch eine
- Sprachliche Gewalt: Sprache kann neben der reinen Informationsweitergabe
- Verantwortung: Sprache bietet fast immer Alternativen. Welche Wörter wir benutzen, entscheiden wir letztlich
Wer spricht, muss sich also entscheiden, wie er damit umgehen will – entziehen kann er sich der Wirkung nur durch dauerhaftes
So weit, so einleuchtend. Bleibt die Frage, wann und wie der Ruf von Political Correctness ruiniert wurde.
Das neue Feindbild: Political Correctness
Bei Political Correctness ging es schon immer um mehr als nur sprachliche Sensibilität. Der Begriff kam Mitte der 1980er-Jahre an US-amerikanischen Universitäten in Mode. Dort wehrten sich Studierende gegen Lehrpläne, die sich zu stark auf »tote, weiße, europäische Männer« stützten. Die jungen Aktivisten forderten eine Ausweitung der gelehrten Ideen und verwendeten »politically correct« – kurz »P.C.« – dabei ironisch für neue Sprachcodes.
Die Studentenproteste gefielen vor allem konservativen Politikern nicht. Als einer der Ersten sprach sich George W. Bush gegen Political Correctness aus und gab eine Interpretation vor, die bis heute nachhallt:
Diese fundamentale Kritik holte die Republikaner 2016 ein. Im US-Wahlkampf nutzte Donald Trump Political Correctness als Feindbild und diskriminierte, um aufzufallen: So bezeichnete er etwa mexikanische Einwanderer als »Vergewaltiger und Mörder«, machte sich öffentlich über einen Reporter mit körperlicher Behinderung
Anders formuliert: Endlich sagt’s mal einer! Und in dieser Haltung scheinen sich mittlerweile auch einige Philosophen, Politiker und Terroristen einig zu sein:

Wer hat’s gesagt: Politiker, Philosoph oder Terrorist?
- Politiker: der Schweizer Bundesrat Christoph Blocher in einer
- Politiker: Präsident Donald Trump bei der
- Philosoph: der slowenische Kulturkritiker Slavoj Žižek
- Terrorist: Anders Behring Breivik in seinem
Ist dieser Vergleich fair? Nein, er steckt Personen in Schubladen, stellt unterschiedliche Positionen auf eine Stufe, überspitzt und differenziert zu wenig – aber er hat auch einen
Wo ziehen wir also die Grenze zwischen Anti-Diskriminierung und Taka-Tuka-Sprache, die einschränkt? Die Linguistin Heidrun Kämper hilft mir dabei, die gängigen Argumente der Gegner unter die Lupe zu nehmen.
Gegenargument 1: »Mut zur Wahrheit«

Doch die Kritik geht über die Sprache hinaus. In Frauke Petrys Interpretation wird Political Correctness zur Eigenschaft einer überholten Politik und damit zum Instrument eines
Zu diesem Selbstbild gehört, Begriffe der politischen Gegner nicht mehr zu verwenden und bewusst gegen ihre Regeln zu verstoßen. Provokation ist dabei Programm.
Anders formuliert: Dass Politiker unerwünschte Tatsachen gern mal vertuschen oder leugnen, ist mittlerweile ein verbreitetes Klischee mit wahrem Kern. »Klartext« wird damit zum wirksamen Etikett für jede Partei auf Wählersuche. Indem rechtskonservative Parteien gegen Political Correctness ankämpfen, können sie sich selbst als Macher, Märtyrer und Rebellen stilisieren. Der Slogan der AfD heißt nicht von ungefähr »Mut zur Wahrheit.« Das macht immun gegen
Gegenargument 2: »Das sind doch alles Scheindebatten«
Auch von linker Seite gibt es Gegenwind: Der slowenische Kulturkritiker Slavoj Žižek hält
Diese Gefahr ist besonders in den Medien real: Die regelmäßigen Empörungen über Politiker-Tweets lenken
Diskriminierungsfreies Reden ist mehr als nur »Schein«. Sprache kann verletzen und kann sprachliche Gewalt sein. Wenn wir darauf Rücksicht nehmen, ist das für die Betroffenen bereits ein erster Schritt hin zur Verbesserung ihrer Lebenssituation.
Kämper verweist auch auf den Zusammenhang zwischen
menschenverachtende Deutungsmuster
Gegenargument 3: »Die verbieten mir das Denken«

Das wohl härteste Gegenargument gegen Political Correctness stammt direkt aus der besagten Rede von George W. Bush: Sprachzensur. Mit der Deutungshoheit über Wörter soll dem politischen Gegner das
Tatsächlich werden auch in Deutschland bestimmte Themenfelder von Politikern mit besonderer Vorsicht angefasst: etwa das Verhältnis zu Israel oder zu Parteien am Rand des politischen Spektrums.
Hier haben die Gegner von Political Correctness Recht, wenn sie fordern, dass auch unliebsame Meinungen zu einer offenen Gesellschaft
Mit dem ursprünglichen Konzept der sprachlichen Anti-Diskriminierung hat das nichts mehr zu tun. Heidrun Kämper weist darauf hin, dass es kein Sprachministerium gibt, das Wörter als »richtig« oder »falsch« bewertet. Formulierungen setzen sich nur dann durch, wenn ein Großteil der Bevölkerung sie praktisch oder sinnvoll findet.
Wer Anti-Diskriminierung generell als Zensur empfindet, will unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit diskriminieren.
Gegenargument 4: Vorsicht vor der Doppelmoral
PC ist längst ein politischer Kampfbegriff, der polarisiert. Missverständnisse und Reibungspunkte sind da programmiert. Seine Befürworter und Gegner machen auch vor einer Doppelmoral nicht halt:
- Wer einerseits auf Political Correctness besteht, andererseits aber auf »abgehängte Wutbürger« schimpft, missversteht das Konzept und diskriminiert selbst. Wer die Ethik hinter Anti-Diskriminierung ernst nimmt, muss auch
- Wer aus Empörung gegen Political Correctness anderslautende Perspektiven niederbrüllt, versucht, ein eigenes Tabu in der Gesellschaft zu etablieren. Wenn Ideen plötzlich nicht mehr »patriotisch korrekt« sind, soll eine offene Debatte behindert
Klartext: »Political Correctness ist Schuld an allem« ist genauso absurd wie »Wer keine Political Correctness betreibt, ist ein Nazi.«
So können wir Political Correctness gemeinsam besser nutzen
Ja, es ist leicht und gerade politisch »in«, auf das Reizwort Political Correctness zu reagieren, es zu verbiegen, umzudeuten und damit Wählerstimmen und Sympathien zu sammeln. Vielleicht hilft es gerade jetzt, sich daran zu erinnern, dass es ursprünglich darum ging, eine Gesellschaft zu schaffen, die auf gegenseitigen Respekt baut. Ob wir das Political Correctness, Zivilcourage, Anstand oder Rücksicht nennen, ist dann egal. Natürlich ist das langweiliger als laute Wortgefechte.
Ich versuche es mal mit 3 Gedanken zum Abschluss, die ich aus der ganzen Political Correctness mitgenommen habe:
- Freiwillig nicht »N****« sagen: Anti-Diskriminierung bleibt eine gute Idee, wenn sie freiwillig bleibt. Mit Umberto Ecos Worten: »Lasst uns an das fundamentale Prinzip halten, dass menschlich und wohlerzogen ist, alle Formen von Wörtern aus unseren Sprachgebrauch zu streichen, die unsere Mitmenschen leiden lassen.« Gegen sprachliche Gewalt helfen keine aufgezwungenen Ersatzwörter, sondern eher Gespräche über die Ursachen. Nicht dass jemand ein abwertendes Wort gebraucht ist schlimm, sondern die möglicherweise negative Absicht, die dahinter steckt.
- Mehr Klartext wagen: Das Spiel der Empörungen über den politischen Gegner ist mühsam und führt tatsächlich zu Scheindebatten. Hier wären weniger Taka-Tuka und mehr Klartext nötig: Manche politischen Äußerungen sind nicht »politically incorrect«, sondern einfach anstandslos, rassistisch, tatsächlich verschleiernd oder faktisch falsch. Das sollten wir beim Namen nennen – und natürlich begründen können.
- Nicht alles auf die Goldwaage legen: Political Correctness und Incorrectness haben vor allem zu einem geführt: sprachlicher Unentspanntheit. Aber Sprache ist nicht eindeutig, kennt Humor, Satire, Parodie und manchmal auch Ventil – und das ist gut so. Wer einmal das Wort »Ausländer« benutzt, entlarvt sich damit nicht gleich als Rassist und muss nicht gleich bevormundet werden. Auf der anderen Seite ist auch eine Bibel in gerechter Sprache nicht gleich ein
Fakt ist: Es ist möglich, Anti-Diskriminierung gut zu finden und trotzdem konservativ zu sein. Menschen können kontroverse Ideen vortragen, ohne zu diskriminieren. Es geht sogar, entspannt Haltung zu zeigen und trotzdem eine andere zu tolerieren. So wie Präsident Obama, der noch im Herbst 2016 inmitten des hitzig geführten Wahlkampf-Endspurts in den USA
Es gibt einen Trend im ganzen Land, Universitäten dazu zu bringen, Redner mit einer anderen Meinung auszuladen oder Wahlveranstaltungen von Politikern zu stören. Tut das nicht. Egal wie lächerlich oder verletzend ihr das finden mögt, was von ihren Lippen kommt.
Titelbild: Ayo Ogunseinde - CC0 1.0