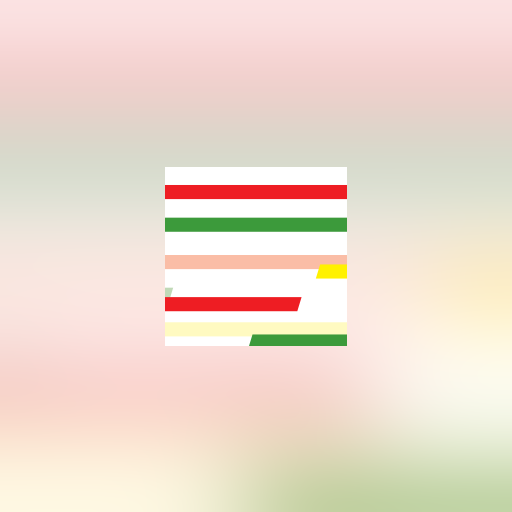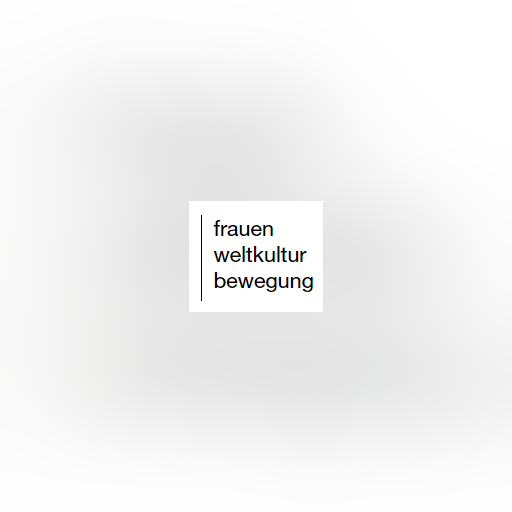Hält die Koalition, was die Parteien versprochen haben? Wir haben bei Expert:innen nachgefragt
Ob Klimaschutz, Gleichstellung oder Digitalisierung: Die Ampelkoalition will »mehr Fortschritt wagen«. Doch was taugen ihre Pläne wirklich?
Olaf Scholz ist Bundeskanzler, die Mitglieder des neuen Kabinetts sind vereidigt, der Koalitionsvertrag beschlossene Sache. Grünes Licht also für die Ampel und ihre Vorhaben, die sie auf 177 Seiten festgehalten hat.
Anfang Dezember haben wir uns angeschaut, 10 Punkte, die eine progressive Politik versprechenwie viel des versprochenen Fortschritts tatsächlich im Koalitionsvertrag steckt und für wen die Koalition aus SPD, Grünen und FDP gute Nachrichten im Gepäck hat. Jetzt haben wir einige kritische Stellen des Vertrags noch einmal genauer unter die Lupe genommen – und bei Expert:innen und Betroffenen nachgefragt, wie sie die Pläne bewerten.
Wie wichtig sind Koalitionsverträge?
Koalitionsverträge sind rechtlich nicht bindend. Im Laufe der Legislaturperioden wurden die schriftlichen Vereinbarungen der Regierungsparteien allerdings immer länger und detaillierter – eine selbstgelegte Messlatte für den eigenen Erfolg. Dass es sich bei den Verträgen nicht um bloße Papiertiger handelt und sich die genaue Lektüre also durchaus lohnt, zeigte kürzlich eine Studie der Bertelsmann-Stiftung. Die Analyst:innen stellten fest: 80% der Versprechen der Großen Koalition wurden ganz oder teilweise gehalten – 229 von 294 einzelnen Punkten.
ME/CFS: »Das Gesundheitssystem hat die Erkrankung jahrelang ignoriert«
von Lara MalbergerAls ich mit meinem Kollegen Marc Tiemann spreche, überziehen rasiermesserartige Schmerzen seinen Körper. Für unser Gespräch hat er sich trotzdem aufgerafft, denn das Thema, um das es geht, begleitet ihn schon seit mehr als 20 Jahren. Seitdem weiß er, dass er an Myalgischer Enzephalomyelitis bzw. dem Chronischen Fatigue-Syndrom erkrankt ist.
»ME/CFS wurde bei mir im Jahr 2000 diagnostiziert, ich habe es aber schon seit der Kindheit. Bis zur Diagnose hatte ich eine jahrelange Ärzteodyssee hinter mir«, erzählt mir der 43-Jährige. Schon als Kind sei er häufig abgeschlagen und schnell erschöpft gewesen, immer wieder plagten ihn starke Bauch-, Kopf- und Muskelschmerzen. Mit den Jahren verschlechterte sich sein Zustand, doch eine Diagnose blieb lange aus. Und damit auch angemessene Hilfe.
Obwohl in Deutschland mindestens 250.000 Menschen betroffen sind, ist ME/CFS hierzulande noch wenig bekannt – auch bei Mediziner:innen. Durch die Pandemie ändert sich das gerade ein bisschen. Denn die Forschung zeigt immer deutlichere Parallelen zwischen ME/CFS und den Symptomen einer Teilgruppe der Was wir über Long Covid wissen, haben Benjamin Fuchs und ich hier zusammengetragenLong-Covid-Betroffenen.
Wenn jede Bewegung Folgen hat
Die sogenannte Post-Exertional Malaise (PEM) ist ein zentrales Merkmal von ME/CFS. Sie sorgt dafür, dass sich alle Symptome nach geistiger oder körperlicher Belastung deutlich verstärken. Schon kleine Aktivitäten wie Zähneputzen, Duschen oder Kochen können für Betroffene so zur Tortur werden; Besorgungen im Supermarkt anschließend zu tagelanger Bettruhe zwingen. Für Schwerstbetroffene kann die Post-Exertional Malaise bereits durch das Umdrehen im Bett oder die Anwesenheit einer weiteren Person im Raum ausgelöst werden. Die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS e. V. informiert darüber ausführlich.
Eine zugelassene Behandlung oder Heilung gibt es bisher jedoch nicht. Weil bis heute so wenig über die Krankheit bekannt ist, fordern Betroffene und Mediziner:innen schon lange, dass mehr getan wird, um ME/CFS zu erforschen und den Erkrankten zu helfen. Der neue Koalitionsvertrag verspricht nun, genau das zu tun. So heißt es auf Seite 83:
Zur weiteren Erforschung und Sicherstellung einer bedarfsgerechten Versorgung rund um die Langzeitfolgen von Covid-19 sowie für das chronische Fatigue‐Syndrom (ME/CFS) schaffen wir ein deutschlandweites Netzwerk von Kompetenzzentren und interdisziplinären Ambulanzen.
»Nachdem ich die eklatanten Missstände rund um ME/CFS jahrzehntelang selbst erfahren habe, macht es Hoffnung, dass sich nun endlich etwas bewegt«, Jetzt komme es darauf an, wie ernst die Parteien die Umsetzung nehmen. Das dringendste Problem sei die katastrophale Versorgungslage, insbesondere der betont Marc, bei dem die Krankheit derzeit vergleichsweise mild verläuft.
Da das Gesundheitssystem die Erkrankung jahrzehntelang ignoriert oder fehlklassifiziert hat, vegetieren viele Patient:innen in abgedunkelten Zimmern ohne Hilfe vor sich hin. Neben staatlichen Forschungsgeldern brauchen wir dringend mehr Aufklärung und eine angemessene Versorgung.
Ob die neue Bundesregierung dieser Forderung gerecht wird, müsse sich zeigen. »Die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS und Long Covid Deutschland haben in ihrer Die gemeinsame Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS e. V. und Long COVID Deutschland findest du hiergemeinsamen Stellungnahme vom 17. Oktober 2021 wichtige Maßnahmen gefordert. Daran müssen wir die Politik jetzt messen«, so Marc.
Ambitionierterer Klimaschutz denn je, aber noch immer nicht genug
von Maria StichAnfang Dezember veröffentlichte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung Econ die Ergebnisse einer von der beauftragten Analyse. Hier findest du die Ergebnisse der Analyse (PDF)Die Studie attestiert dem Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP das »ambitionierteste Klimaschutzprogramm […], das jemals eine Bundesregierung vorgelegt hat«. Auf das Lob folgt aber sogleich die Ernüchterung: Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Deutschland mit den von der Ampel geplanten Maßnahmen nach wie vor verfehlen wird.
Die Analyst:innen untersuchten dafür die im Koalitionsvertrag angekündigten klimapolitischen Maßnahmen in den Sektoren Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft. In einer sektorübergreifenden Kategorie wurden zusätzlich Maßnahmen wie Dieser Verein kauft der Industrie die Emissionszertifikate weg – mit deinem Geld!der CO2-Preis oder natürliche Unser Autor David Ehl war auf dem größten Kohlenstoffspeicher der Welt unterwegszusammengefasst. Das Ergebnis: In keiner der Kategorien schafft es der Koalitionsvertrag, ausreichende Maßnahmen zu formulieren. Einzig im Energiesektor, in dem der massive Ausbau erneuerbarer Energien vorgesehen ist, könnten die In diesem Artikel habe ich über die Pläne der Koalition beim Umbau des Energiesektors geschriebenKlimaziele am ehesten erreicht werden. »Hier ist eine konsequente, schnelle und handwerklich gute Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen wichtig«, meint Christiane Averbeck, Geschäftsführerin der Klima-Allianz Deutschland.
Die größten Schwächen deckt die Studie in den Sektoren Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft auf – die Formulierung von Zielen dazu bleibe viel zu unkonkret. Damit die im Klimaschutzgesetz bis 2030 festgeschriebenen Maßgaben erreichbar bleiben, muss vor allem hier nachgeschärft werden. »Dabei hat die Ampel keine Zeit zu verlieren! Die Bundesregierung muss nun mit dem angekündigten Klimaschutzsofortprogramm zeigen, wie sie die Lücken in diesen Sektoren schließen will«, fordert Christiane Averbeck.
Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Reichen die Pläne der Ampel, um sie zu stoppen?
von Katharina WiegmannJede Stunde werden in Deutschland durchschnittlich 13 Frauen Opfer von Gewalt in der Partnerschaft, alle 2 1/2 Tage wird eine Frau von ihrem Partner oder einem Ex-Partner getötet. Soweit die offizielle Statistik des Bundeskriminalamts für 2020, es muss jedoch Der Deutschlandfunk berichtet über die Pressekonferenz des BKA und des Familienministeriums zu den aktuellen Zahlen (2021)von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden. Gewalt gegen Frauen ist in Deutschland Alltag, quer durch alle sozialen Schichten. Während der Pandemie hat sich das Problem weiter verschärft. Was will die Ampelkoalition dagegen tun?
Laut Koalitionsvertrag soll unter anderem die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen »vorbehaltlos« umgesetzt werden.
Was genau die Istanbul-Konvention ist und warum Rechte in ganz Europa ein Problem mit ihr haben, kannst du in diesem Artikel nachlesen:
Vorbehalte hatte die vorherige Bundesregierung gegen Artikel 59 der Konvention. Darin geht es um den Schutz und die Rechte gewaltbetroffener Migrantinnen. Was das in der Praxis bedeutet, erklärt die feministische Historikerin und Autorin Franziska Benkel, die zu Franziska Benkels Buch zur Geschichte der Frauenhäuser in Deutschland ist im Orlanda Verlag erschienen – hier findest du mehr Informationengeschlechtsspezifischer Gewalt arbeitet: »Frauen, deren Aufenthaltsstatus an den gewalttätigen Ehemann gekoppelt ist, können im Falle einer Scheidung abgeschoben werden.«
Dass Gewalt laut Koalitionsvertrag künftig »ressortübergreifend« verhütet und bekämpft werden soll, bewertet Benkel positiv: »Das zeigt, dass partnerschaftliche Gewalt als strukturelle Gewalt anerkannt werden soll und Gewaltschutz auch beinhaltet, dass Lohn- und Fürsorgearbeit diskriminierungsfrei sein müssen.«
»Nach aktuellen Schätzungen fehlen mehr als 14.600 Schutzplätze für Frauen« – wissenschaftlicher Dienst des Bundestags, 2019
Wichtig findet Benkel außerdem, dass die Koalition explizit die Finanzierung von Frauenhäusern anspricht, Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hat den »Sachstand« zum Thema Frauenhäuser 2019 zusammengefasst (PDF)»denn bisher reicht die Versorgung ja nicht aus«. Und schließlich lobt sie die ausdrückliche Erwähnung von Queers und Frauen mit Behinderung: »Es scheint, dass es ein Bewusstsein über Diversität und Mehrfachdiskriminierung durch ›race‹, ›class‹ und ›gender‹ gibt.« Ob die Istanbul-Konvention nun tatsächlich vollständig umgesetzt werde und das gesamte Hilfssystem für gewaltbetroffene Frauen von der neuen Regierung profitiere, bleibe aber abzuwarten.
(Endlich) ein Aufbruch für die Digitalisierung
von Dirk WalbrühlEs ist schon ein wenig peinlich, dass Deutschland im Jahr 2021 nach wie vor
Die neue Bundesregierung will hier endlich aushelfen und nutzt im Koalitionsvertrag das Wort »digital« auffallend häufig, inklusive prominentem Platz des Themas gleich nach der Präambel.
Doch was will sie konkret angehen? Im Mittelpunkt der Pläne steht die Versorgung mit den neuesten Standards Glasfaser und 5G – Grundlagen, ohne die Zukunftstechnologien wie selbstfahrende Autos unmöglich wären. Löblich: Vor allem die »weißen Flecken« sollen angegangen werden, also aktuell vom Netzausbau abgeschnittene Regionen abseits der großen Städte. Dafür will die Bundesregierung mehr Geld an die Kommunen verteilen. Leider fehlt ein konkreter Zeitplan und wie genau ein hilfreich sein könnte, muss sich noch zeigen. Für mehr Tech-Start-ups sollen Mittel aus dem Zukunftsfonds genutzt und Prozesse vereinfacht werden.
Dazu sollen Behörden die Verwaltung endlich umfassend digital gestalten und auch so kommunizieren, etwa im Bereich der »öffentlichen Ausschreibungen«. Auch können demnächst Bürger:innen Petitions- und Gesetzgebungsverfahren auf einem neuen Portal online einsehen und kommentieren. Dabei verpflichtet sich der Staat zum Nutzen verschlüsselter Kommunikation und zur externen Überprüfung der IT-Sicherheit von Behörden und der Förderung offener Standards (Open Source) und der Netzneutralität. Das sind interessante Punkte, die nach der Formulierungshilfe klingen, die dieser im Oktober veröffentlicht hatte. Das fiel auch denen auf, Das Blog von IT-Sicherheitsexperte Felix von Leitner kommentiert die auffallend ähnlichen Stellen zwischen Koalitionsvertrag und Formulierungshilfe (2021)die daran mitgeschrieben hatten.
Vielleicht liest sich deshalb die digitale Agenda des Koalitionsvertrages tatsächlich wie ein neuer Aufbruch. Doch ausgerechnet zu den Themen staatlicher Han Langeslag fragt: Macht Kontrolle uns zu besseren Menschen?Überwachung und Bürger:innen-Rechte bleiben viele empfindliche Fragen offen, wie Sebastian Meineck, Digitalexperte für Netzpolitik.org, heraushebt:
Positiv am Koalitionsvertrag ist zum Beispiel die und Verbesserungen im Bereich Open Source. Zur Zukunft von Staatstrojanern und So wirst du im Alltag überwacht: 7 Überwachungsmaßnahmen und wie sie in Deutschland zum Einsatz kommenVorratsdatenspeicherung ist der Koalitionsvertrag leider vage. Eine klare Absage an den Einsatz dieser Technologien sähe anders aus.
Barrierefreies Gesundheitswesen: Hat die Regierung wirklich einen Plan?
von Stefan BoesIn den nächsten 4 Jahren In diesem Artikel von Stefan Boes erfährst du, was unter Barrierefreiheit zu verstehen istsoll Deutschland barrierefrei werden. Ob dieses Ziel der neuen Regierung ambitioniert ist oder eine vage Absichtserklärung, lässt sich aus dem Koalitionsvertrag nur schwer ableiten. Es finden sich zwar durchaus konstruktive Vorschläge, wenn es etwa um die bessere Inklusion auf dem Arbeitsmarkt
Andere Ziele sind denkbar unpräzise formuliert: Etwa sollen Pressekonferenzen »baldmöglichst« in Gebärdensprache übersetzt werden und Angebote in Leichter Sprache »ausgeweitet« werden. Ganz offen bleibt, wie die Ampelkoalition ein »barrierefreies Gesundheitswesen« schaffen will. Dafür kündigt sie nicht viel mehr als einen Aktionsplan bis Ende 2022 an, was bei Inklusionsaktivist:innen auf Unverständnis stößt:
Wir brauchen nicht den 48. Aktionsplan zum Thema Gesundheit, wir brauchen Taten. Bis heute gibt es nicht einmal einheitliche Erhebungen und Standards, mit denen Informationen zur Barrierefreiheit von Arztpraxen für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung gestellt werden.
Constantin Grosch kritisiert, dass die Gesundheitsversorgung nicht allen Menschen gleichermaßen offenstehe. »Durch mangelnde Barrierefreiheit, fehlendes Wissen um seltene Erkrankungen und unzureichende Kommunikationsmöglichkeiten können Menschen mit Behinderungen noch immer die medizinische Grundversorgung nicht in vollem Umfang wahrnehmen«, heißt es Pressemitteilung des Vereins Sozialheld*innenin einer Pressemitteilung des Vereins Sozialheld*innen.
Der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird sich nicht nur daran messen lassen müssen, ob er ein guter Pandemiemanager ist. In seine Bilanz wird auch einfließen, ob das unscharf formulierte Ziel des barrierefreien Gesundheitssystems in 4 Jahren erreicht ist.
Wie groß die Aufgabe ist, zeigt eine Erhebung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung: Eine Anfrage von mehreren Abgeordneten der Grünen zum Thema Barrierefreiheit in Arztpraxen (2020, PDF)Nur 26% der haus- und fachärztlichen Praxen in Deutschland haben demnach einen uneingeschränkt barrierefreien Zugang. Das zu ändern, wäre aber nur ein erster Schritt.
Ein barrierefreier Zugang zu Gesundheit umfasse die Behandlung in verständlicher Sprache, verfügbare Gebärdensprachdolmetschung, flexible Untersuchungseinrichtungen und Personal, das im Umgang mit Menschen mit Lernbehinderungen und Mehrfachbehinderungen geschult sei, heißt es in der Mitteilung der Sozialheld*innen. Praxen müssten in der Lage sein, Menschen mit Behinderung adäquat zu versorgen, sagt Constantin Grosch. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Kleine Reformen statt echtem Neuanfang im Migrationsrecht
von Maria StichGleich zu Beginn des entsprechenden Kapitels verspricht der Koalitionsvertrag der Ampel einen Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik, »der einem modernen Einwanderungsland gerecht wird.« (S. 137) Ein großes Versprechen, das sich in den Vorhaben auf den folgenden Seiten nur teilweise widerspiegelt.
Auf der Habenseite stehen Verbesserungen beim Familiennachzug und beim Bleiberecht sowie die Abschaffung von Arbeits- und Ausbildungsverboten. An anderen Stellen weist der Koalitionsvertrag aber Lücken auf. »Tief enttäuscht sind wir, dass die Regierung die bis zu 18-monatige Isolierung in den Erstaufnahmeeinrichtungen nicht antastet«, kritisiert beispielsweise der Geschäftsführer von Günter Burkhardt. Denn die neue Bundesregierung hat zwar angekündigt, die sogenannten abzuschaffen. Den Aufruf von Pro Asyl und anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen findest du hier (PDF)Ähnliche Einrichtungen bleiben aber bestehen, der Aufenthalt dort wird nicht auf 3 Monate beschränkt, wie Pro Asyl und andere zivilgesellschaftliche Organisationen schon vor der Bundestagswahl forderten.
Für Burkhardt entscheidet sich die Zukunft des Asylrechts aber nicht allein in Deutschland, sondern vor allem auf EU-Ebene. Positiv bewertet er, dass sich die Koalition hier klar zur Rechtsstaatlichkeit bekennt – was in der EU nicht mehr selbstverständlich sei. Erik Marquardt schreibt in seinem neuen Buch darüber, wie Europa seine Werte an den Außengrenzen verrät und was wir dagegen tun könnenKonkrete Maßnahmen gegen aktuelle Missstände wie die illegalen Pushbacks an den europäischen Außengrenzen bleiben allerdings offen. Pro Asyl erwarte von der neuen Koalition deshalb, dass sie für das Asylrecht kämpfe und Menschenrechtsverletzungen gegenüber den EU-Staaten klar benenne:
Jegliche finanzielle Unterstützung für Staaten wie Polen, Ungarn, Griechenland und Kroatien muss eingestellt werden, wenn die Pushbacks dort weitergehen. Kein Euro aus deutschen oder EU-Mitteln darf in den Bau neuer Mauern und Festungsanlagen fließen.
»Alle beschlossenen Gesetzesänderungen müssen nun in einem 100-Tage-Programm gesetzlich auf den Weg gebracht werden«, fordert Günter Burkhardt weiter. Allerdings: Lies dazu bei der Tagesschau: »Wie die Union die Ampel ausbremsen könnte«Viele der Vorhaben hängen davon ab, ob sich jeweils Mehrheiten dafür im Bundesrat finden.
Der Personentransport auf der Schiene muss 6-mal so schnell wachsen wie bisher. Geht das überhaupt?
von Désiree SchneiderDie vorherige Bundesregierung hatte sich 2018 zum Ziel gesetzt, die Zahl der Bahnreisenden bis 2030 zu verdoppeln – also von »Sehr ambitioniert«, Das Zitat stammt aus »Die Wiederbelebung der Schiene« von klimareporter (2020)kommentierte Dirk Flege, Geschäftsführer des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses das Ziel damals angesichts der eher
Die Ampelkoalition hat nun noch einen draufgelegt: Sie will die bis 2030 verdoppeln. Diese berücksichtigt nicht nur die Anzahl der Bahnreisenden, sondern auch die von den Fahrgästen zurückgelegte Strecke. Um das neue Ziel zu erreichen, muss die Branche allerdings 6-mal so schnell wachsen wie bisher. Das hat die Allianz pro Schiene Mit dem vorherigen Ziel hätte eine Allianz pro Schiene: »Ampel setzt für Personenverkehr auf Schiene höhere Wachstumsziele als alte Regierung« (2021)Vervierfachung gereicht. Ist mehr überhaupt möglich?
»Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aus unserer Sicht aber machbar«, sagt Markus Sievers, Pressesprecher der Allianz pro Schiene. Der genaue Fahrplan sei im Der Masterplan Schienenverkehr auf der Website des Verkehrsministeriums (2020, PDF)»Masterplan Schienenverkehr« festgehalten, den die Schienenbranche in der vergangenen Legislaturperiode gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium erarbeitet hat. Der Plan listet über 100 Einzelmaßnahmen auf – von dem Neu- und Ausbau des Gleisnetzes, neuen Signalsystemen, der bis hin zu einer »Angebotsoffensive« durch den sogenannten Deutschlandtakt, der bis 2030 alle deutschen Großstädte Felix Austen erklärt den Deutschlandtaktim 30-Minutentakt miteinander verbinden soll. »Es ist ein Riesenpaket, das aber nur umgesetzt werden kann, wenn auch eine langfristige Finanzierung gesichert ist. Erst damit können Baufirmen planen In diesem Text schreibe ich über die Herausforderungen einer nachhaltigen »Zugkunft«, der Fachkräftemangel ist eine davonund die nötigen Fachkräfte anwerben«, so Sievers.
Der politische Wille ist da, die Ziele sind formuliert – und es sind gut messbare Ziele. Nun liegt es an der neuen Regierung, in konkreten Programmen genügend Geld für die Umsetzung der Projekte bereitzustellen – auch damit die Fahrpreise bezahlbar bleiben.
Mit Illustrationen von Aelfleda Clackson für Perspective Daily