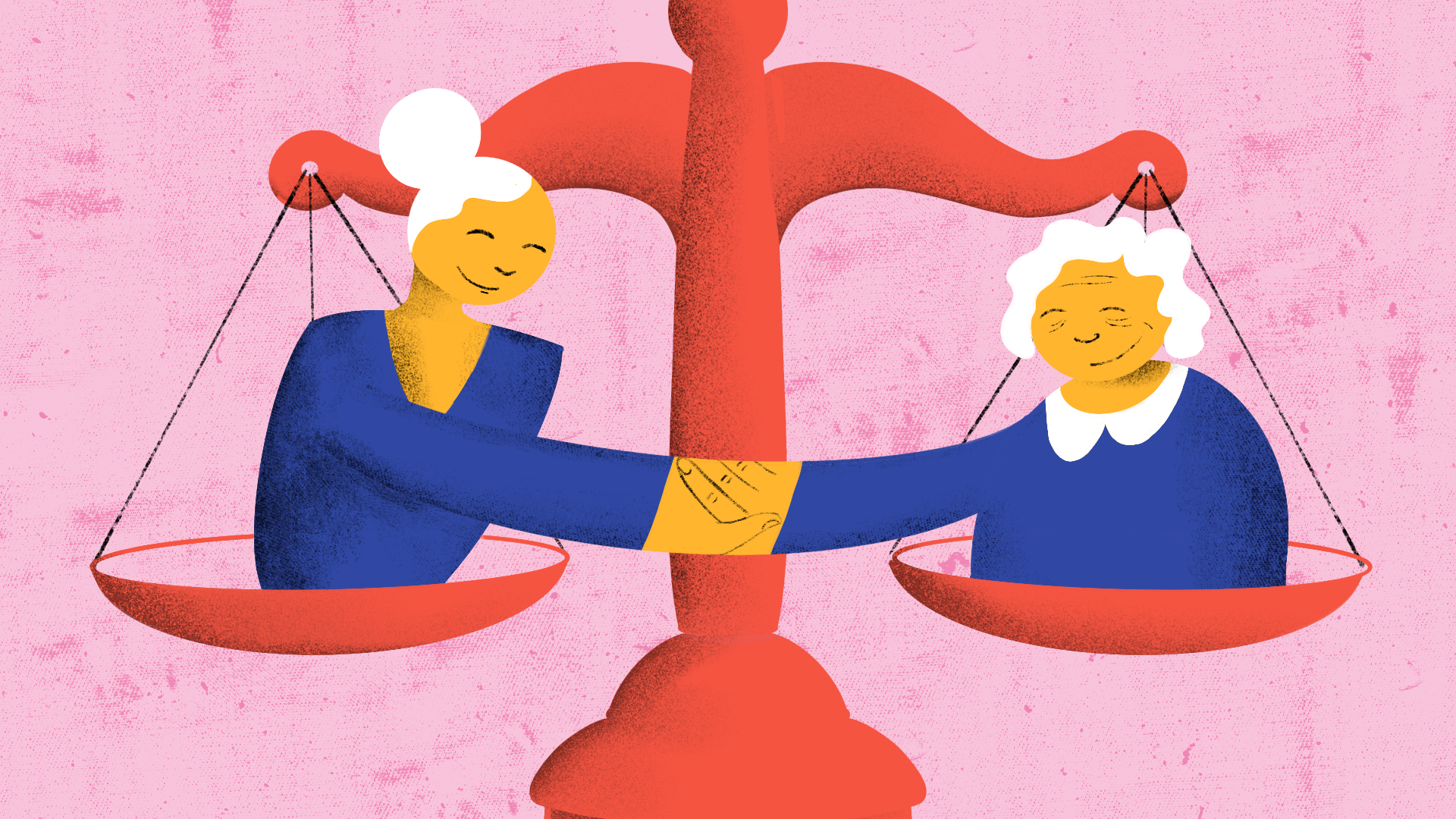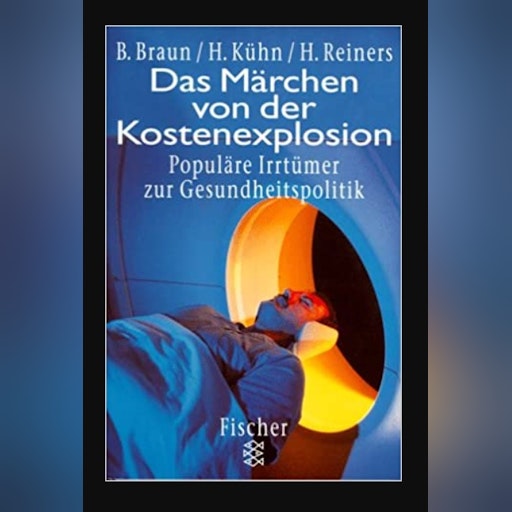Von wegen »Kostenexplosion«: Woran unser Gesundheitssystem wirklich krankt
Keine Brille, keine Pille, kein Zahnersatz: Im ersten Teil unserer Serie zum Gesundheitssystem erfährst du, warum die Leistungen in der Vergangenheit immer weiter gestrichen wurden – während die hohen Kosten geblieben sind.
Warum leidet unsere Gesellschaft seit Jahrzehnten unter chronisch unterbesetzten Krankenhäusern?
Warum kriegen Privatversicherte innerhalb weniger Tage einen Termin beim Arzt und werden im Wartezimmer stets zuerst aufgerufen?
Warum fühlen sich Kranke oft wie Kunden und nicht wie Patient:innen?
Und warum bezahlt die Krankenkasse Homöopathie, aber nicht unverzichtbare Brillen, Hörgeräte und Zahnersatz?
Das sind Fragen, die die Menschen in Deutschland frustrieren und mit Unverständnis zurücklassen.
Bevor wir voll in das Thema einsteigen: Wenn du zuerst wissen möchtest, wie es um dein Grundwissen bestellt ist, mache hier ein kurzes Quiz!
Jahr für Jahr zahlt
Und trotzdem scheint das Geld nie zu reichen. Immer neue Defizite bringen die Krankenkassen ins Wanken, sodass der Bund jedes Jahr weitere Milliarden zuschießen muss, um das System am Laufen zu halten. Die Einnahmeausfälle und drastisch gestiegenen Kosten durch die Coronapandemie sind hier noch nicht einmal mit eingerechnet. Was ist da los?
Sind Gesundheitsleistungen zu teuer? Krankenhäuser zu ineffizient? Werden die Menschen zu alt? Ganze Bücherregale in Unibibliotheken sind inzwischen mit wissenschaftlichen und ökonomischen Abhandlungen gefüllt,
Und doch lassen sich die vielen Entwicklungen in 3 historische Phasen unterteilen, die deutlich machen, woran das große Ganze wirklich krankt. Wir beginnen mit einem Mythos, der die Debatte seit Langem prägt: die »Kostenexplosion« im Gesundheitswesen.
Los geht es mit Teil 1!
Am Anfang war die Kostenexplosion – oder?
Krankheitskosten: Die Bombe tickt!
Diese bedrohliche Schlagzeile könnte aus der jüngeren Vergangenheit stammen. Tut sie aber nicht. Sie ist fast 50 Jahre alt und markiert den Startpunkt einer

Schnell springen die Medien auf die Auflage versprechende Sensation an: Die westdeutsche Medizin sei nicht die beste, aber die teuerste der Welt. Die Kosten von 50 Milliarden Mark seien so hoch wie das halbe Bruttoinlandsprodukt der Schweiz. Ein Bett im Krankenhaus koste pro Tag 3-mal so viel wie eine Nacht im Hilton. Die vermittelte Botschaft ist klar: Alles ist viel zu teuer, die Kosten sind vollkommen außer Kontrolle.
Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
Die GKV finanziert sich in erster Linie durch Beiträge der Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen. Diese zahlen einen bestimmten Prozentsatz des Lohns (zuletzt im Schnitt 15,9%) in die Krankenkasse ein. Aus diesem Topf werden dann alle Leistungen (etwa Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Medikamente) für die Versicherten gezahlt. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, steigt der Beitragssatz für alle Versicherten an.
Tatsächlich sind die in dem Gutachten dargestellten Zahlen dramatisch – zumindest auf den ersten Blick. Suggeriert werden rapide ansteigende Ausgaben, flankiert von Diagrammen mit steil ansteigenden Kurven. Was nur wenige bemerken: Sowohl die Ausführungen als auch die Abbildungen und Diagramme weisen simple, aber wirkmächtige Fehler auf.
Erstens bezieht sich das Gutachten entgegen der Erzählung einer Kostenexplosion gar nicht auf die tatsächlichen Ausgaben im Gesundheitssystem (also auf Medikamente, Arztbesuche usw.). Stattdessen geht es in erster Linie darum, wie stark die Beitragszahlungen zur gesetzlichen Krankenversicherung in dieser Zeit steigen. Hierfür spielen aber nicht nur die Ausgaben eine Rolle, sondern auch andere Faktoren, die die Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherung durch die Beiträge der Versicherten beeinflussen.
Steigen zum Beispiel die Kosten für Arzneien oder die Gehälter der Ärzt:innen, während die Einnahmen gleich bleiben, muss der Beitragssatz zwangsläufig angehoben werden, um die Kosten zu decken. In dem Gutachten wird jedoch ausgespart, wie sich die Einnahmeseite entwickelt, etwa ob Arbeitslosigkeit dazu führt, dass weniger Menschen in das System einzahlen, und der Beitragssatz möglicherweise auch deswegen steigt.
Zweitens wird der Eindruck einer reinen Kostenexplosion durch einen einfachen statistischen Trick verschärft: eine sogenannten »dressierten Kurve«. Statistiker:innen bezeichnen so Diagramme, die wie ein trainierter Seehund auf Kommando einen Satz nach oben machen – im Idealfall natürlich vor einem möglichst großen, beeindrucktem Publikum. Hier ein Beispiel für diesen Effekt.
Fiktives Beispiel einer »dressierten Kurve«
Das dargestellte Diagramm dient als Beispiel für eine »dressierte Kurve«. Es entsteht der Eindruck einer rasant steigenden Entwicklung. Schaue dir das folgende Diagramm weiter unten an, um die nichtdressierte Version zu sehen.
Ein gänzlich anderes Bild ergibt sich, wenn das Diagramm korrekt dargestellt wird.
Gleiche Daten, anderes Bild
Das Diagramm stellt exakt die gleichen Daten dar wie das vorangegangene. In diesem Fall ist die senkrechte y-Achse jedoch korrekt dargestellt und beginnt mit dem Wert 0. Auf diese Weise ergibt sich das tatsächliche, weniger drastische Bild.
In der Diskussion um die Kostenexplosion werden häufig dressierte Kurven wie diejenige aus dem ersten Beispiel herangezogen, um die Dringlichkeit für Reformen zu untermauern. Sitzen die Betrachtenden der Täuschung auf, glauben sie an einen rasant steigenden Trend, der möglichst schnell und entschieden bekämpft werden muss. In diesem Fall lautet die Botschaft: Steigen die Kosten weiter derart drastisch an, fließt schon bald das ganze Volkseinkommen in das Gesundheitssystem.
Witzbolde unter den Hochrechnern haben sogar schon prophezeit, daß im Jahr 2000, wenn alles so weiterginge wie bisher, die Westdeutschen das ganze Jahr hindurch nur noch für den Gesundheitsdienst arbeiten würden. Dann sind wir alle gesund – und verhungern.
Tatsächlich ergibt sich dieses Bild aber nur, weil nicht das gesamte Bild in Augenschein genommen wird – und weil die senkrechte y-Achse im ersten Diagramm irreführend dargestellt wird.
Was wirklich explodiert: die Arbeitslosenquote
Es stellt sich die Frage: Warum fällt die Explosionsmetapher in den 70er-Jahren bei Medien, Politik und Öffentlichkeit auf derart fruchtbaren Boden? Weil die Menschen am Ende des Monats durch steigende Beitragssätze für die gesetzliche Krankenversicherung tatsächlich weniger Geld in der Tasche haben. So klettert der Satz innerhalb von 10 Jahren von durchschnittlich 8,2% (1970) auf 11,3% (1980). Der Grund hierfür liegt vor allem in der Gesundheitsreform von 1972, die für die dringend nötige Sanierung von Krankenhäusern sorgte. Diese waren zuvor
Geschichten von Krankenhausbetten, die vermeintlich teurer sind als Übernachtungen in Luxushotels, erscheinen vor diesem Hintergrund vor allem als populistische Anekdoten, um die Erzählung von der Kostenexplosion zu stützen. Der Mediziner und Autor Hagen Kühn fasst es so zusammen: »Obwohl zwischen 1970 und 1975 die Ausgaben (auch im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt) wirklich stark angestiegen waren, hätte man damals leicht erkennen können, dass die Kurvenfunktion des Trends nicht exponentiell,
Ändern sollte das wenig, denn der Mythos der Kostenexplosion ist geboren. In den Folgejahren wird mit eben dieser Erzählung Politik gemacht – auch um von krisenhafteren Entwicklungen abzulenken, die auf einer wesentlich größeren Bühne spielen. Denn Mitte der 70er-Jahre
Die neue Situation verändert die Stimmung im Land: Wo zuvor noch große Einigkeit über eine Wirtschaftspolitik herrschte, die auf einen starken Staat, hohe Steuern für Reiche und den stetigen Ausbau der sozialen Sicherungsnetze setzte, macht sich nun Verunsicherung breit. Das »Alte« scheint angesichts der stagnierenden Wirtschaft und steigender Arbeitslosigkeit nicht mehr so recht zu funktionieren. Und so werden die Stimmen immer lauter, die kürzen, deregulieren und »wettbewerbsfähig« machen wollen.
Dieser größere historische Kontext markiert den Aufstieg neoliberal geprägter Politik und entfaltet fortan große Auswirkungen auf alle Politikfelder dieser Zeit – auch auf das Gesundheitssystem.
Du willst wissen, wie es zum Aufstieg der neoliberalen Ideologie gekommen ist? Dann lies im Anschluss diesen Text:
Wie Arbeitslosigkeit das Gesundheitswesen erschüttert
In aller Offenheit: Nicht jeder wird in dieser Lage seinen Arbeitsplatz behalten können.
Die Zeit nach der ersten Ölpreiskrise ist geprägt von einem Phänomen, wovon viele Menschen in den 70er-Jahren glaubten, dass es der Vergangenheit angehöre: die Massenarbeitslosigkeit. 15 Jahre lang hatte in Westdeutschland nahezu Vollbeschäftigung geherrscht, doch seit Anfang der 70er-Jahre wächst die Arbeitslosenquote scheinbar unaufhaltsam.
Nicht die Gesundheitsausgaben explodieren, sondern die Arbeitslosenzahl
Die Entwicklung lässt viele Menschen in das soziale Sicherungsnetz der Arbeitslosenhilfe fallen – und wesentlich mehr um ihre wirtschaftliche Zukunft und Existenz bangen. Doch nicht nur das. Die wiederkehrende Massenarbeitslosigkeit ist auch der eigentliche Grund dafür, warum das Gesundheitssystem in dieser Zeit immer weiter unter Druck gerät.
Dabei muss spätestens jetzt jedem klar werden, dass nicht die Kosten des Gesundheitssystems explodieren, sondern dessen Einnahmen implodieren. Denn die gesetzliche Krankenversicherung wird aus den Beiträgen der arbeitenden Versicherten finanziert. Hohe Arbeitslosigkeit sorgt dafür, dass immer weniger Menschen über ihre Sozialabgaben in die Krankenkasse einzahlen können, wodurch das Fundament des Systems ins Wanken gerät. Gleichzeitig steigen die Beitragssätze für die restlichen Versicherten, um den Ist-Zustand aufrechterhalten zu können.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Lohnsteigerungen in den 70er- und 80er-Jahren immer weniger mit dem Wirtschaftswachstum schritthalten. Wachsen die Einkommen der verbleibenden Einzahler:innen langsamer, obwohl die Wirtschaftsleistung stetig wächst, kommt es zu einem Ungleichgewicht. Plakativ gesagt: Die Menschen bekommen kontinuierlich weniger von den Profiten ab, die sie mit ihrer Arbeit erwirtschaften,
Unterm Strich schrumpft so der zu verteilende Kuchen, der durch die Sozialabgaben der Beschäftigten gebacken wird – und zwar nicht nur im Gesundheitsbereich, sondern auch bei der Rente.
Explodiert ist also vor allem die Arbeitslosenrate, mit schwerwiegenden Folgen für alle sozialen Sicherungssysteme der Bundesrepublik. Dem Wachstum der Wirtschaftsleistung tut dies währenddessen keinen Abbruch, auch wenn es langsamer vonstattengeht als zuvor. Das zeigt: Es geht hier nicht um die Frage der Finanzierbarkeit, sondern um die der Verteilung von unbeirrt wachsendem Wohlstand.
Die deutsche Wirschaftsleistung wächst trotz Ölpreiskrise
Die 80er-Jahre: Kürzen statt reformieren
Es sind drastische Sprüche wie diese, womit der Bundesminister für Arbeit Norbert Blüm (CDU) in den 80er-Jahren die Diskussion darüber führt, wie viel Wohlfahrtsstaat man sich leisten könne. Der Slogan lässt keinen Zweifel am Kurs der Politik dieser Zeit: Die fetten Jahre sind vorbei. Die Arbeitslosigkeit ist mit 9% so hoch wie noch nie und soziale »Wohltaten« scheinen nicht mehr bezahlbar. Und so setzt es sich die 1987 frisch wiedergewählte Regierungskoalition aus CDU und FDP unter Führung von Helmut Kohl zum Ziel, die vermeintlich ausufernden Kosten des Sozialstaats einzudämmen. Dabei im Fokus: das Gesundheitswesen.
Alle vorangegangen Reformversuche (von denen es einige gab: 1977, 1981, 1982, 1984 und 1986), die die Sozialausgaben des Systems dämpfen sollten, hatten ihr Ziel verfehlt – die Beitragssätze stiegen immer weiter. Dass die in den Reformen beschlossenen Kürzungen angesichts der gesamtwirtschaftlichen Lage gar nicht zu diesem Ziel führen konnten, blieb indes Nebensache. Stattdessen hielt man an der Geschichte vom nimmersatten Gesundheitssystem fest.
Wie der Wohlfahrtsstaat im Allgemeinen, so wurde das deutsche Gesundheitssystem im Besonderen medial fortgesetzt als ›Pflegefall‹ dargestellt, den man mit Hilfe möglichst tiefgreifender und ›schmerzhafter‹ Reformen kurieren müsse.
In diesem Geiste schreibt sich die Regierung Kohl auf die Agenda, dass man den entschlossenen Versuch unternehmen wolle, »

Gänzlich unrecht haben sie dabei nicht: Auch wenn es heute schwer vorstellbar scheint, hält die gesetzliche Krankenversicherung damals einige Annehmlichkeiten bereit, die je nach Perspektive durchaus Spielraum für Einsparungen bieten. So werden etwa Fahrtkosten zu Arztterminen per Taxi (jährliche Kosten: 1,7 Milliarden Mark) ebenso gezahlt wie regelmäßige Kuren oder Kosten für Beerdigungen (Sterbegeld).
Das streitbare Potenzial dieser Einsparungen spielt in Norbert Blüms öffentlichem Kampf für eine Gesundheitsreform aber eine weniger große Rolle. Stattdessen gibt er den Anwalt der kleinen Leute, deren Löhne durch die steigenden Beitragssätze für die Krankenkassen bedroht seien. Doch dass diese Sorge um die kleinen Versicherten wohl nicht sein Hauptantrieb ist, entgeht aufmerksamen Beobachtern nicht:
Nur nebenbei ließ er auch einmal ein Hauptmotiv seines Reformeifers durchblicken: ›Es sollen nicht allein die Versicherten entlastet werden, sondern auch die Unternehmen von arbeitsplatzverhindernden hohen Lohnnebenkosten.‹
Im November 1988 verabschiedet der Bundestag schließlich das »Gesundheits-Reformgesetz«, das Kohl als »Generalüberholung der sozialen Krankenversicherungen« angepriesen hatte. Was die Beschäftigten auf ihren Lohnzetteln entlasten soll, belastet aber bald ihr eigenes Portemonnaie: Die Krankenkasse übernimmt künftig nur noch die Kosten für die günstigsten Brillen und Hörgeräte, Zahnersatz wird nur noch zur Hälfte gezahlt und Schuheinlagen und bestimmte Medikamente gar nicht mehr.
Trotz der Sparmaßnahmen verfehlt auch diese Reform ihr Ziel. Die Beiträge zur Krankenversicherung werden lediglich kurzzeitig stabilisiert. Sinken wollen sie trotzdem nicht. Das liegt auch daran, dass der von Arbeitsminister Blüm groß angekündigte Solidarbeitrag der Pharmaindustrie ausbleibt,
An dieser Stelle wird ein weiteres Muster sichtbar, das die Gesundheitspolitik der 70er- und 80er-Jahre prägt: Die – vergleichsweise moderat – steigenden Kosten werden nicht etwa dadurch gedämpft, dass echte Einsparungen durchgesetzt werden. Stattdessen werden sie einfach umverteilt – und zwar auf die Versicherten. So stimmen 48% der Befragten einer Umfrage im Januar 1989 der Aussage zu, Blüm lasse »den kleinen Mann bluten«.
»Liegst du erst mal in der Kiste, brauchst du keine Brill’ mehr, siehste!« – Aus einer Büttenrede im Rheinischen Karneval, 1988
Ganz im Gegensatz zu den gut organisierten Lobbyverbänden der Pharmakonzerne, (Zahn-)Ärzt:innen und Apotheker:innen. Als ausgesprochen gut verdienende Profiteur:innen des Systems verstehen sie es nahezu perfekt, Widerstand gegen alle Reformbemühungen zu organisieren, die sie selbst betreffen.
So enden die 80er-Jahre – und mit ihnen fast 20 Jahre voller unbefriedigender Gesundheitsreformen, die das System ganz und gar nicht »kurieren« konnten. Doch Anfang der 90er-Jahre kommt es zu einer großen parteiübergreifenden Veränderung, die für das Gesundheitswesen eine neoliberale Schocktherapie vorsieht.
Wie auf diese Weise die Zweiklassenmedizin geboren wird und was Horst Seehofer damit zu tun hat, erfährst du in Teil 2 der Serie.
Mit Illustrationen von Aelfleda Clackson für Perspective Daily