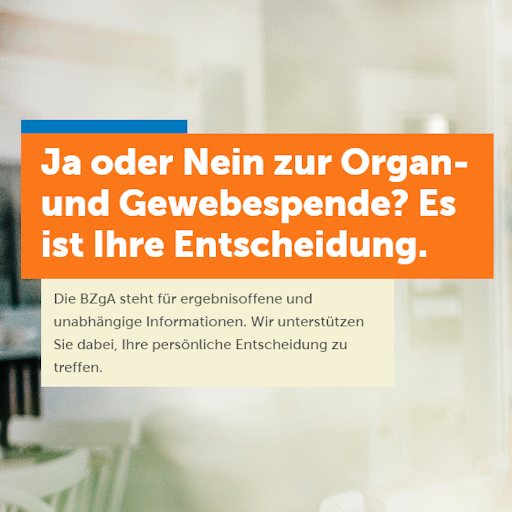»Für mich ist es ein Wunder, dass ich mit diesem gespendeten Organ leben darf«
In kaum einem EU-Land werden so wenige Organe gespendet wie in Deutschland. Ein Organempfänger, eine Bioethikerin und ein Beauftragter für Transplantationen erzählen, wie sich das ändern kann.
Andrés Leben ändert sich grundlegend, als er 18 Jahre alt ist. Bei einer Routineuntersuchung stellen Ärzt:innen eine schwere Nierenerkrankung fest. Jahrelang versuchen Mediziner:innen die entzündete Niere zu heilen, doch nichts hilft. Das Organ, das eigentlich Giftstoffe aus seinem Körper filtern soll, versagt. Eine Maschine muss diesen Job für André übernehmen.
»Die Zeit an der Dialyse, das war die schlimmste meines Lebens«, sagt mir der heute 56-Jährige im Videointerview. Mehrere Stunden pro Woche verbrachte er damals angeschlossen an einem solchen Apparat. Nach 2 Jahren auf der Warteliste für eine Spenderniere erreicht ihn schließlich ein erlösender Anruf: Es gibt ein Spenderorgan. Die Transplantation glückt, sie ist der Beginn von Andrés zweitem Leben.

Von den 2 Jahren Wartezeit, die für André Beiske die Hölle waren, können Menschen, die heute auf eine Transplantation warten, nur träumen. Wer eine neue Niere benötigt, wartet mehr als 8 Jahre. Zeit, in der sich der allgemeine Gesundheitszustand der Wartenden noch weiter verschlechtert. Mehr als 9.100 Menschen stehen insgesamt auf der Warteliste für eine Organtransplantation.
Es ist lange bekannt, dass es heute viel mehr Menschen gibt, die auf ein Spenderorgan warten, als Menschen, die nach ihrem Tod ein Organ spenden. In einer Umfrage, die die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 2020 durchgeführt hat, gaben zwar 82% der Menschen an, grundsätzlich positiv gegenüber der Organspende
Postmortale Organspender:innen in Deutschland
Zahl der Menschen, die nach ihrem Tod eines oder mehrere Organe gespendet haben
Woran liegt es, dass sich so wenig verbessert, obwohl seit Jahren über das Thema diskutiert wird?
Mehr Ressourcen für die Organspende: Was Deutschland von Spanien gelernt hat
Vorab: Eine Organspende hängt nicht nur davon ab, ob Verstorbene oder Familienangehörige zugestimmt haben. Damit eine Spende überhaupt zur Debatte steht, muss zuvor Folgendes passiert sein:
- Diagnose – Hirntod: Grundlage für die Organspende ist der irreversible Ausfall der gesamten Hirnfunktion,
- Identifizierung: Potenzielle Spender:innen müssen auch als solche erkannt werden. Fehlt es im Krankenhaus an Personal und Zeit, steht die Frage nach einem Organspendeausweis eher hinten auf der Prioritätenliste.
- Medizinische Eignung: Vor Ort müssen die Organe geprüft werden: Ist der allgemeine Gesundheitszustand ausreichend? Gibt es Infektionen
- Bestätigung der Diagnose: Im nächsten Schritt müssen 2 intensivmedizinisch erfahrene Fachärzt:innen, von denen einer Neurolog:in oder Neurochirurg:in sein muss, die komplexe Diagnose des irreversiblen Ausfalls der gesamten Hirnfunktion unabhängig voneinander bestätigen.

Erst wenn all diese Punkte eintreffen, wird eine Organspende in Erwägung gezogen. Dann folgen die weiteren Schritte:
- Gespräch mit der Deutschen Stiftung Organspende (DSO): Die DSO ist für die weitere Organisation von Spende und Transplantation zuständig.
- Gespräch mit Angehörigen: Hat der oder die Verstorbene zu Lebzeiten keine eigene Entscheidung getroffen und zum Beispiel in einem Organspendeausweis dokumentiert, so müssen die nächsten Angehörigen in seinem oder ihrem Sinne entscheiden.
- Medizinische Untersuchung: Stimmen die Angehörigen zu, folgt eine noch genauere Untersuchung des oder der Verstorbenen.
- Vermittlung über Eurotransplant: Die Koordinator:innen der DSO senden notwendige medizinischen Informationen an die Vermittlungsstelle Eurotransplant. Ein spezielles Computerprogramm gleicht dort die Daten der Spenderorgane mit denen der Wartelistenpatient:innen ab und ermittelt die Empfänger:innen. Entscheidend bei der Organvergabe sind medizinische Kriterien, wie die Dringlichkeit und die Erfolgsaussicht.
- Entnahme: Die DSO organisiert die Entnahmeteams für die jeweiligen Organe. Bis die Organe entnommen werden können, bleibt der oder die Spender:in an Maschinen angeschlossen, die die Körperfunktionen erhalten.
- Transport und Transplantation: Anschließend werden die Organe transportiert und transplantiert.
Die Organisation des gesamten Prozesses, die Kommunikation mit den Angehörigen – all diese Aufgaben bedeuten einen enormen Aufwand für das Krankenhauspersonal, das ohnehin schon überlastet ist. Krankenhäuser beschwerten sich in der Vergangenheit immer wieder darüber, dass Organtransplantationen von den Krankenkassen so gering vergütet würden, dass sie kaum die Kosten decken, die sie verursachen. Mein Kollege Chris Vielhaus hat 2018 analysiert, wo zu diesem Zeitpunkt die Probleme lagen – und was wir von Spanien lernen können, dem Land mit den meisten Organspenden in der EU.
Postmortale Organspender:innen in Europa
Anzahl der Spender:innen pro Million Einwohner:innen im Jahr 2020
In Spanien werden Mitarbeitende etwa schon seit Jahren im Umgang mit Angehörigen geschult und weitergebildet. Transplantationsbeauftragte direkt in der Klinik unterstützen den gesamten Prozess und stehen als Ansprechpartner:innen zur Verfügung.
Den ganzen Artikel von Chris Vielhaus zur Organspende in Spanien findest du hier:
Die gute Nachricht: Hier hat Deutschland in den letzten Jahren dazugelernt. Durch eine Gesetzesänderung im Jahr 2019 wird die Durchführung von Organspenden
»Gespräche mit Angehörigen brauchen Zeit«
Holger Kraus ist für die Organisation der Organspende an der Uniklinik Essen zuständig. Dort verbringt er seine gesamte Arbeitszeit damit, das Krankenhauspersonal zum Thema weiterzubilden, Organspenden zu koordinieren und mit Angehörigen zu sprechen. Schon seit mehr als 15 Jahren beschäftigt sich Kraus aus nächster Nähe mit dem Thema Organspende. Bevor er seinen Dienst an der Uniklinik Essen antrat, reiste er für die DSO durchs Land, um Organentnahmen zu begleiten und zu dokumentieren.
»Ich war ständig mit dem Tod konfrontiert«
»Ich war ständig mit dem Tod konfrontiert und habe zum Beispiel mit trauernden Angehörigen gesprochen. Das war kein leichter Job«, sagt Kraus. Die positive Seite der Organspende, die Transplantation, die wie im Fall von André Beiske ein Leben retten kann, war nicht Teil seines Jobs. Das ist in Essen nun anders,
Gerade wenn die Entscheidung für oder gegen die Organspende bei den Angehörigen liegt, brauchen sie Raum, um nachzudenken. Denn mit der Entscheidung müssen sie leben können, egal wie sie ausfällt.

Trotz Verbesserungen steigt die Zahl der Organspender:innen nicht. Warum?
Mit der Gesetzesänderung können Krankenhäuser mehr Zeit und Geld für die Organspende aufbringen als noch vor einigen Jahren. Deutschland hat in diesem Punkt, so scheint es, vom Vorreiter Spanien gelernt. Doch warum lässt sich diese positive Entwicklung nicht an der Anzahl der Spender:innen ablesen, die nach wie vor stagniert?
In der Pandemie war es kaum möglich, mit Angehörigen zu sprechen, denn sie hatten nur sehr begrenzt Zutritt zum Krankenhaus. Aus der Ferne eine Entscheidung über die Organspende eines Angehörigen zu treffen und nicht richtig Abschied nehmen zu können – das wird die Entscheidung für viele Menschen erschwert haben.
Hinzu kommt ein häufigerer Ausschluss von Spender:innen

Sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen ist schwer
Während sich die Organisation in den Kliniken und die Kommunikation mit den Angehörigen in den letzten Jahren verbessert hat, bleibt der Erfolg an anderer Stelle aus. Nach wie vor halten wenige Menschen ihren Willen für oder gegen eine Organspende schriftlich fest. Zwar gaben in den Befragungen der BZgA aus dem Jahr 2020 mehr Menschen an, einen Organspendeausweis zu besitzen, als noch 2 Jahre zuvor – die Zahl stieg von 38% auf 44% – doch die Realität sieht anders aus.
»In der Praxis erleben wir, dass deutlich weniger Menschen ihren Willen tatsächlich festgehalten haben, als es die Umfragen widerspiegeln«,
Entscheidung zur Organspende
Das Diagramm zeigt, auf welcher Grundlage sich Angehörige und Ärzt:innen für oder gegen eine Organspende entschieden haben.
Für Angehörige ist die Entscheidung für oder gegen eine Organspende schwer
Eine Entscheidung über die Organspende eines Angehörigen zu treffen, ist alles andere als leicht. Denn Hirntote sehen nicht automatisch tot aus – obwohl sie es medizinischen Richtlinien zufolge sind. Nur Maschinen halten den Körper noch am Leben, würden sie abgeschaltet, würde der Kreislauf zusammenbrechen. Doch das Bild des Hirntoten vermittelt etwas anderes: Er ist warm, rosig, der Stoffwechsel funktioniert noch. Ist der Wille des oder der Verstorbenen nicht bekannt,
Neues Gesetz statt Widerspruchslösung
Schon seit Jahren wird deshalb europaweit über die sogenannte »Widerspruchslösung« als Alternative zur aktuellen Entscheidungslösung diskutiert. Demnach würden alle Bürger:innen, die sich nicht aktiv gegen eine Spende ausgesprochen haben, zum Beispiel in einem Widerspruchsregister, als potenzielle Organspender:innen behandelt werden. In einigen Ländern haben die Angehörigen das Recht, einer Organentnahme bei der verstorbenen Person zu widersprechen, in anderen liegt die Entscheidung nicht mehr bei ihnen. Diese Regelung gilt mittlerweile in 27 Ländern Europas,
Übrigens: Auf Reisen gelten andere Regeln
Verstirbt eine Person im Ausland, gilt die Organspenderegelung des jeweiligen Landes. Vor einem Aufenthalt im Ausland ist es deshalb ratsam, sich darüber zu informieren.
Auch im Deutschen Bundestag wurde die
- Ein Onlineregister: Eingerichtet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sollen alle Bürger:innen ab 16 Jahren dort eintragen können, ob sie Organe spenden möchten oder nicht.
Das Problem: Das Onlineregister sollte mit dem Gesetz am 1. März an den Start gehen, ist aber bis heute nicht online. - Informationen bei Ausweisstellen hinterlegen: Die Ausweisstellen sollen Bürger:innen Informationsmaterial und Organspendeausweise aushändigen. Zudem sollen sie direkt im Online-Register vermerken, ob jemand Organspender:in sein möchte oder nicht.
Das Problem: Die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder hat im Februar die Bundesregierung dazu aufgefordert, diesen Teil des Gesetzes wieder zu ändern und Ausweisstellen von der Pflicht zu entbinden, den Willen zur Organspende ins Onlineregister einzutragen. Die Ausweisstellen könnten laut GMK die erforderliche Beratung und Aufklärung, - Hausärzt:innen einbinden: Sie können Patient:innen nun alle 2 Jahre bei Bedarf über die Organspende ergebnisoffen beraten und diese Beratung auch bei der Krankenkasse abrechnen.
Das Problem: Das Gesetz sieht vor, dass Hausärzt:innen alle 2 Jahre etwa 5 Minuten für die Beratung ihrer Patient:innen zum Thema Organspende mit der Krankenkasse abrechnen dürfen – etwa 7,30 Euro springen dabei heraus. Zu wenig, um ausreichend über das sensible Thema zu informieren, - Bessere Ausbildung und Organspende in Erste-Hilfe-Kursen: Das Gesetz sieht vor, die Organspende stärker in der ärztlichen Ausbildung zu verankern und Grundwissen zur Organ- und Gewebespende in Erste-Hilfe-Kursen zu vermitteln. Zumindest diese beiden Punkte sind noch nicht gescheitert – haben sich aber auch noch nicht bewährt.
Bis das Gesetz zur »Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende« seinem Namen gerecht wird, dauert es wohl noch eine Weile. Deshalb bleibt es wichtig, Menschen auf anderem Wege zu erreichen und darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, eine Entscheidung für oder gegen die Organspende festzuhalten. Wie kann das gelingen?

Ein »Ja« zur Organspende ist keine Pflicht – im Diskurs läuft das manchmal schief
»In der Aufklärung über einen Organspendeausweis sollte es nicht darum gehen, mehr Spender:innen zu gewinnen, sondern um die Entscheidung an sich«, sagt Solveig Lena Hansen. Hansen ist Bioethikerin und erforscht seit über 10 Jahren, was in der Kommunikation rund um die Organspende schiefläuft,
Es wird vermittelt: ›Wer nicht spendet, ist schuld am Tod eines Menschen.‹ Das ist ein problematisches Narrativ, denn die Menschen sterben zum Beispiel an einer chronischen Krankheit, nicht an unterlassener Hilfeleistung.
Durch dieses Narrativ werde der Bevölkerung die Verantwortung zugeschrieben und ignoriert, dass der Organbedarf auch andere Gründe hat. Neben den organisatorischen Problemen in den Krankenhäusern, die sich langsam bessern, spielt beispielsweise auch der medizinische Fortschritt eine Rolle. In den westlichen Industrieländern haben in den vergangenen Jahrzehnten Todesfälle aufgrund von Schlaganfällen deutlich abgenommen, auch die Mortalitätsraten nach Hirnblutungen und
Ein »Nein« müsse dabei laut Hansen aber ebenso gesellschaftlich akzeptiert werden wie ein »Ja«. Die Informationsmaterialien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hätten das
Die Frage, ob ich eine Organspende möchte oder nicht, ist nicht nur eine Informationsfrage, sondern auch eine Wertfrage. Es geht darum, was für den:die Einzelne:n ein gutes Sterben und ein gutes Lebensende ausmacht.
Manche Menschen würden die Konzepte der Transplantationsmedizin teilen. »Für sie ist es völlig okay, wenn man dem Körper Teile entnimmt, die sie nach dem Tod nicht mehr brauchen. Aber es gibt auch Personen, die ein anderes Verhältnis zu ihrem Körper haben. Sie können sich mit dem Austausch von Körperteilen nicht identifizieren, sei es aus kulturellen, anthropologischen oder religiösen Gründen. Auch das gilt es zu akzeptieren«, sagt Hansen. Es sei schöner, Organspende als lebensbejahendes Thema darzustellen, doch es gehe eben auch um den Tod. Trotzdem lohnt es sich, die andere Seite zu betrachten: Denn auch, wenn nicht jeder Mensch mit Organspendeausweis ein Leben rettet, so kann ein gespendetes Organ ein Leben verändern.

»Für mich ist das ein medizinisches Wunder, dass ich mit diesem Organ leben darf«
Ich spreche mit André Beiske per Videoanruf. Der freundlich aussehende Mann Mitte 50 ist PD-Leser und hat sich per E-Mail bei uns gemeldet. Das Thema Organspende ist ihm wichtig, aus eigener Erfahrung, logisch. Er erzählt mir von seiner Nierenkrankheit. Berichtet mir davon, wie der erlösende Anruf alles verändert hat – und wie er bis heute dankbar ist, für das gespendete Organ und seine neue Chance auf Leben.
Ich habe jetzt seit 33 Jahren die gleiche Niere. Das ist für mich ein medizinisches Wunder, dass ich mit diesem Organ leben darf. Mit der Dialyse und ohne diese gespendete Niere hätte ich nicht so lange überlebt.
Über seinen Spender weiß André bis heute nur, dass er männlich und 21 Jahre alt war, damals waren Organspenden noch anonym. Heute können Angehörige der Spender:innen zumindest erfahren, ob die Transplantation geglückt ist, seit 2019 können Organempfänger:innen
André hatte schon 2 Herzinfarkte
André denkt oft an die Familie seines Spenders. »Ich bin den Angehörigen und dem Spender bis heute
»Natürlich bist du, wenn du so ein Organ erhältst, erst mal sehr, sehr ängstlich, dass etwas passiert.« Doch die Mediziner:innen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, haben es geschafft, ihm seine Sorgen zu nehmen: mit Gesprächen auf Augenhöhe und dadurch, dass sie ihm schnell klargemacht haben, dass er ein ganz normales Leben führen kann. In einem Sportverein für Transplantierte hat André erlebt, dass das auch anders laufen kann. »Ich kenne viele Beispiele von transplantierten Menschen, die zitternd durch die Gegend laufen und ständig nur hoffen, dass nichts passiert«, sagt er. Manche Transplantierte haben auch Probleme, das Organ als Teil des eigenen Körpers zu akzeptieren. Das hat André bei sich nicht erlebt:
Ich hatte sofort das Gefühl, das gehört zu mir. Das Witzige dabei ist, dass ich die neue Niere spüren kann. Sie ist im Bauchraum links, wenn ich da drauf drücke, kann ich sie immer ertasten.
Seit André mit der Spenderniere lebt, setzt er sich für das Thema Organspende ein, ihm ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen damit auseinandersetzen. »Wer sich Gedanken darüber macht, ob er Organe spenden möchte oder nicht, muss sich auch Gedanken dazu machen, dass jede:r davon betroffen sein kann. Es klingt zwar sehr hart, aber es ist ja nun mal leider so. Jede:r kann betroffen sein, auch indirekt. Über Verwandte, über Kinder, Mütter«, sagt André. »Trotzdem akzeptiere ich es natürlich, wenn eine:r sagt, er oder sie möchte das nicht.«

So hältst du deine Entscheidung fest
Vielleicht möchtest du nach diesem Artikel deine Entscheidung für oder gegen eine Organspende festhalten? So funktioniert es:
- Gespräche mit Angehörigen: Wenn Angehörige aus erster Hand hören, was du dir im Fall der Fälle wünschst, macht ihnen das die Entscheidung deutlich leichter. Kommuniziere deine Wünsche klar und deutlich, am besten jedem, der am Ende involviert sein könnte.
- Organspendeausweis: Die wohl bekannteste Lösung. Hier lassen sich sowohl Zustimmung als auch Ablehnung festhalten. Auch welche Organe gespendet werden sollen, kannst du hier festhalten. Ein Organspendeausweis, den niemand zu Gesicht bekommt, hilft allerdings wenig. Trage ihn im Portemonnaie und berichte am besten Freund:innen und Familie davon, dass du ihn besitzt. Einen Ausweis bestellen kannst du zum Beispiel hier – entweder direkt zum Ausdrucken oder als Plastikkarte.
- Patientenverfügung: In einer Patientenverfügung hältst du beispielsweise fest, ob du lebensverlängernde Maßnahmen wünschst. Wer Organe spenden möchte, kommt um diese Maßnahmen nicht herum, weshalb es wichtig ist, diese Ausnahme in einer Verfügung festzuhalten. Mehr Informationen zur Patientenverfügung und mögliche Textbausteine findest du beispielsweise hier.
Mit Illustrationen von Aelfleda Clackson für Perspective Daily