Wie deine Psyche Klimagefühle abwehrt und du ihnen gesund begegnen kannst
Viele Menschen haben gerade »Klimagefühle«. Zwei Psychologinnen wollen, dass wir diese Emotionen besser verstehen, damit wir selbstbestimmt darauf reagieren können. Lies bei uns exklusiv ein Kapitel aus dem Buch von Lea Dohm und Mareike Schulze.
Wir alle verdrängen täglich die Klimakrise. Vielleicht stutzt du an dieser Stelle – und vermutlich gehörst du tatsächlich zu den Menschen, die im Vergleich zu anderen bereits ein hohes Problembewusstsein haben. Und dennoch ist es eine mit Gewissheit zutreffende Feststellung: Wir alle verdrängen täglich die Klimakrise. Vor allem: die damit verbundenen Gefühle. Nur sehr selten hat unsere Untätigkeit in Sachen Klima heutzutage etwas damit zu tun, dass wir über zu wenig Wissen verfügen. Die sogenannte Wissens-Defizit-Hypothese, die dies annahm, wurde bereits widerlegt.
Dennoch wird auch heute noch über viele Fakten der Klimakrise überhaupt nicht berichtet. Oder es werden sogar gezielt Falschinformationen verbreitet. Immerhin wird jedoch mittlerweile allen Menschen hierzulande einmal der Begriff »Fridays for Future« begegnet sein. Und jede*r könnte und sollte sich zumindest fragen, warum die dort zusammengeschlossenen Jugendlichen so vehement und beharrlich sind. Dennoch gilt: Wenn wir mit Fakten zur Klimakrise konfrontiert werden, greifen ganz schnell Abwehrmechanismen, um uns emotional zu schützen. Dies trifft natürlich auch für uns beide weiterhin zu. Diese Verdrängung ist ein Stück weit sogar notwendig, denn die Klimafakten sind in ihrer Botschaft absolut erschütternd und stellen (fast) unser ganzes Leben infrage.
Infos zum Buch
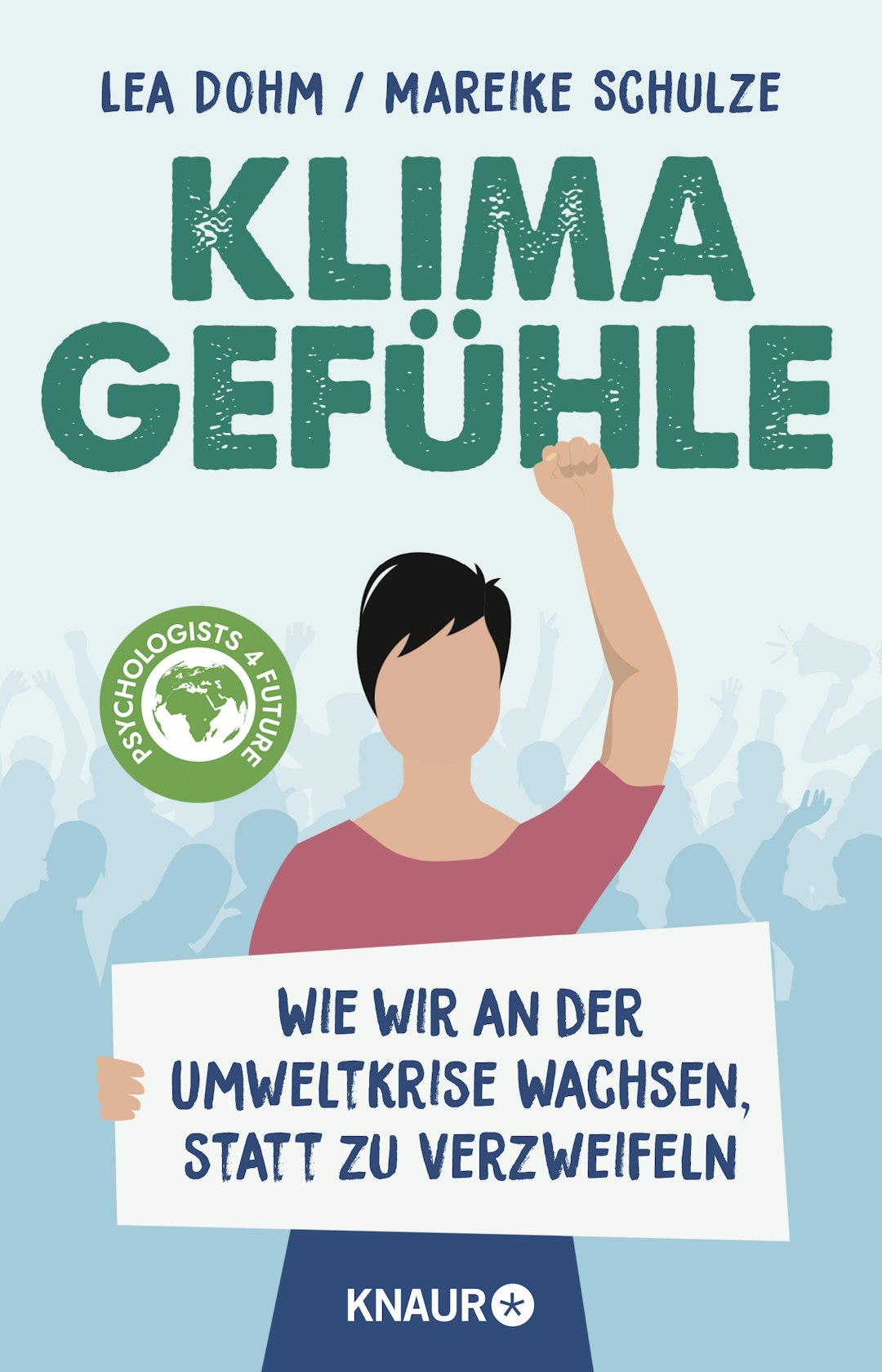
Der vorliegende Text ist ein gekürzter Auszug aus dem Buch »Klimagefühle: Wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln«. Es erschien im August 2022 im Knaur Verlag.
Bildquelle:Wenn wir plötzlich aufwachen aus dem Traum, dass das Leben immer so weitergeht, wie wir es bisher kannten – in Frieden und ohne Mangel –, so kann diese erschreckende Erkenntnis in hohem Maße unser Sicherheitsgefühl tangieren. Die innere Abwehr von Klimafakten und den damit verbundenen Gefühlen ist dabei zunächst einmal eine sinnvolle Schutzreaktion. Und dennoch brauchen wir eine gute Balance zwischen einer gesunden Abwehr und der Auseinandersetzung mit den Klimafakten und ihrer Bedeutung. Mit guter Balance meinen wir, dass ein zu wenig an Reaktion zur Folge hat, dass wir es versäumen, die Krise anzugehen, weil wir zu erschüttert sind, um etwas zu tun.
Ein zu viel an mentaler Abwehr hingegen kann zur Folge haben, dass die Klimakrise unsere Lebensgrundlage zerstört, weil wir uns im inneren Kampf aufreiben. Finden wir nicht dieses innere Gleichgewicht, die gute Balance, werden wir nichts aktiv gegen die Klimakrise und ihre Folgen unternehmen.
Angst, Wut, Trauer, Schuld, Freude: Wie diese Gefühle uns helfen, die Klimakrise wirklich wahrzunehmen und ins Handeln zu kommen, erklärt Katharina Mau in diesem Artikel:
Warum uns unsere Psyche schützt
Auf den zweiten Blick leuchtet ein, dass wir uns nicht permanent mit dieser größten aller je da gewesenen Menschheitskrisen auseinandersetzen können, denn wir müssen unser Erleben und Verhalten immer im Kontext unseres Umfelds und unseres Alltagslebens betrachten: Die meisten bewegen sich in oftmals fordernden und anstrengenden Lebensalltäglichkeiten, die allein schon ein hohes Maß an Ausdauer und Energie von uns einfordern: Wir sind ständig dabei, uns selbst neu zu erfinden, hochgesteckte Ziele zu erreichen und »zu performen« – denn in unserer schnelllebigen Welt ist vermeintlich für jede*n von uns Perfektion wie aus dem Ladenregal zu haben.
Jedenfalls wirkt das bei anderen so, als wären sie perfekter als wir – was wohl bei den meisten in großem Widerspruch zur eigenen alltäglichen Realität und Selbstwahrnehmung steht. Wir sind daher ständig unter Druck und im Grunde überfordert uns, was das
Die Fülle unseres Alltags lässt keinen Platz für Gefühle
Andererseits kann die permanente Konsummöglichkeit zu Omnipotenzgefühlen oder Allmachtsfantasien führen, was oft mit einem Gefühl von Abgetrenntsein von der Umwelt einhergeht: Der Mensch ist getrieben von der Fantasie, der Natur überlegen zu sein, sie beherrschen zu können, alles erreichen, haben und bezwingen zu können. Die meisten Menschen erleben sich kaum noch als Teil der Natur – der wir aber nun mal sind.
Hinzu kommen die alltäglichen, oft nicht zu unterschätzenden Herausforderungen: Wer bereits vierzig Stunden in der Woche gearbeitet hat und sich anschließend noch um Kinder, einen pflegebedürftigen Elternteil oder auch nur die eigene Steuererklärung gekümmert hat, gefühlt Hunderte Nachrichten in fünf verschiedenen Messengern beantwortet und sich durch Tausende Schnäppchen geklickt hat, um am Ende doch nichts zu kaufen, hat oft keine Kapazitäten mehr für Gefühle, erst recht nicht für Klimasorgen oder gar -engagement.
Wir sind viel zu beschäftigt oder gar getrieben, die Fülle unseres Lebensalltags zu bewältigen. So sehr, dass vielen sogar die Zeit oder Energie für soziale Kontakte oder Hobbys fehlt. Vor die Wahl gestellt, ob wir uns heute lieber mit den neuesten Klima-Schreckensmeldungen beschäftigen oder uns stattdessen mit einer lieben Freundin verabreden, müssten die meisten von uns vermutlich nicht lange überlegen.
Die menschliche Psyche ist faszinierend: Unser Unbewusstes findet allerlei kreative Lösungsmöglichkeiten, um unangenehme Spannungszustände und Gefühle von uns fernzuhalten. Einige dieser Abwehrstrategien mit Klimabezug möchten wir dir gerne näher vorstellen, damit du in Zukunft selbstbestimmt entscheiden kannst, wie du auf die Klimakrise reagieren möchtest. Und bestimmt wirst du – wie wir uns auch – dich und andere wiedererkennen.
Mit Illustrationen von Frauke Berger für Perspective Daily


