Wie deine Psyche Klimagefühle abwehrt und du ihnen gesund begegnen kannst
Viele Menschen haben gerade »Klimagefühle«. Zwei Psychologinnen wollen, dass wir diese Emotionen besser verstehen, damit wir selbstbestimmt darauf reagieren können. Lies bei uns exklusiv ein Kapitel aus dem Buch von Lea Dohm und Mareike Schulze.
Wir alle verdrängen täglich die Klimakrise. Vielleicht stutzt du an dieser Stelle – und vermutlich gehörst du tatsächlich zu den Menschen, die im Vergleich zu anderen bereits ein hohes Problembewusstsein haben. Und dennoch ist es eine mit Gewissheit zutreffende Feststellung: Wir alle verdrängen täglich die Klimakrise. Vor allem: die damit verbundenen Gefühle. Nur sehr selten hat unsere Untätigkeit in Sachen Klima heutzutage etwas damit zu tun, dass wir über zu wenig Wissen verfügen. Die sogenannte Wissens-Defizit-Hypothese, die dies annahm, wurde bereits widerlegt.
Dennoch wird auch heute noch über viele Fakten der Klimakrise überhaupt nicht berichtet. Oder es werden sogar gezielt Falschinformationen verbreitet. Immerhin wird jedoch mittlerweile allen Menschen hierzulande einmal der Begriff »Fridays for Future« begegnet sein. Und jede*r könnte und sollte sich zumindest fragen, warum die dort zusammengeschlossenen Jugendlichen so vehement und beharrlich sind. Dennoch gilt: Wenn wir mit Fakten zur Klimakrise konfrontiert werden, greifen ganz schnell Abwehrmechanismen, um uns emotional zu schützen. Dies trifft natürlich auch für uns beide weiterhin zu. Diese Verdrängung ist ein Stück weit sogar notwendig, denn die Klimafakten sind in ihrer Botschaft absolut erschütternd und stellen (fast) unser ganzes Leben infrage.
Infos zum Buch
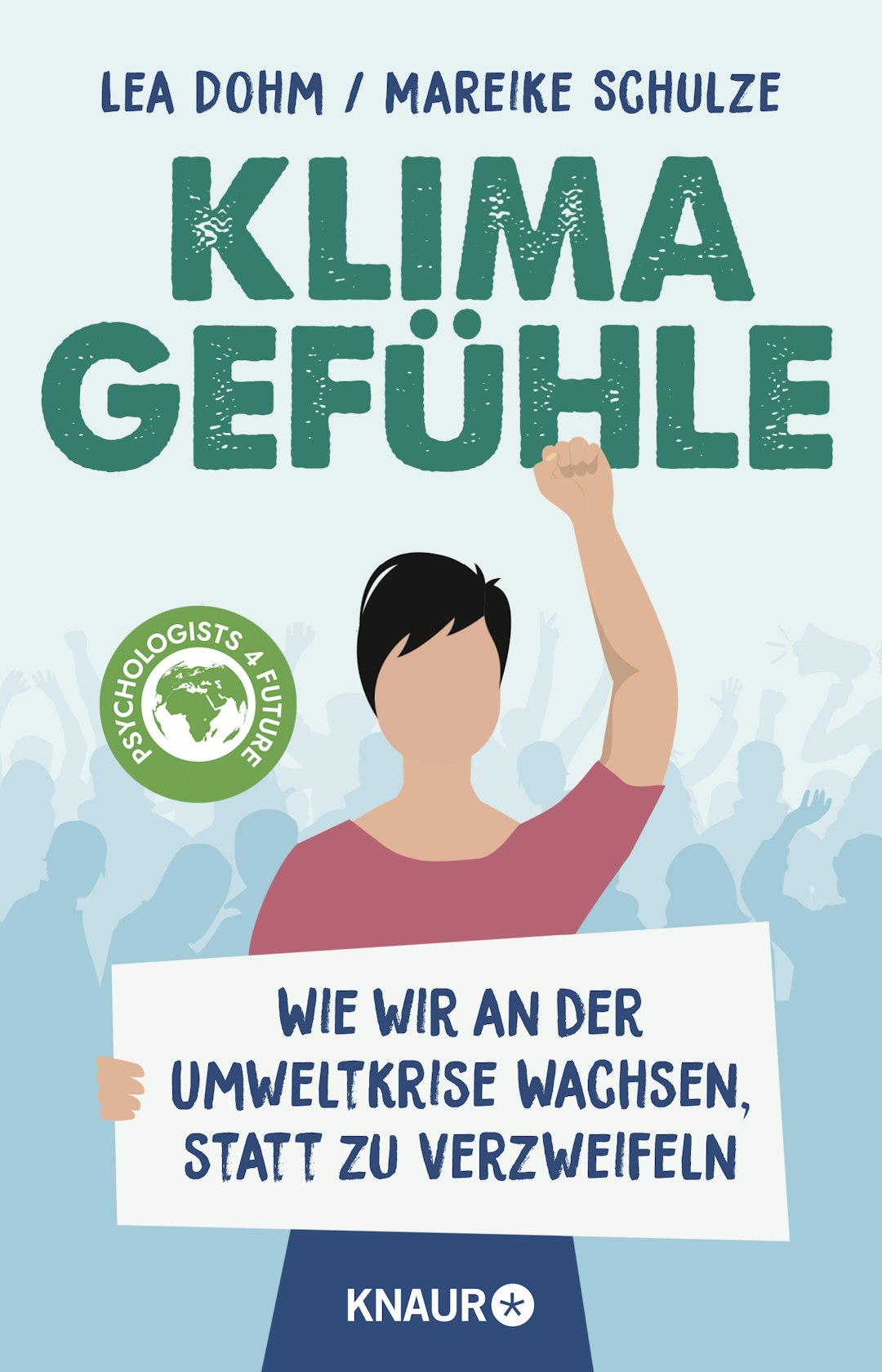
Der vorliegende Text ist ein gekürzter Auszug aus dem Buch »Klimagefühle: Wie wir an der Umweltkrise wachsen, statt zu verzweifeln«. Es erschien im August 2022 im Knaur Verlag.
Bildquelle:Wenn wir plötzlich aufwachen aus dem Traum, dass das Leben immer so weitergeht, wie wir es bisher kannten – in Frieden und ohne Mangel –, so kann diese erschreckende Erkenntnis in hohem Maße unser Sicherheitsgefühl tangieren. Die innere Abwehr von Klimafakten und den damit verbundenen Gefühlen ist dabei zunächst einmal eine sinnvolle Schutzreaktion. Und dennoch brauchen wir eine gute Balance zwischen einer gesunden Abwehr und der Auseinandersetzung mit den Klimafakten und ihrer Bedeutung. Mit guter Balance meinen wir, dass ein zu wenig an Reaktion zur Folge hat, dass wir es versäumen, die Krise anzugehen, weil wir zu erschüttert sind, um etwas zu tun.
Ein zu viel an mentaler Abwehr hingegen kann zur Folge haben, dass die Klimakrise unsere Lebensgrundlage zerstört, weil wir uns im inneren Kampf aufreiben. Finden wir nicht dieses innere Gleichgewicht, die gute Balance, werden wir nichts aktiv gegen die Klimakrise und ihre Folgen unternehmen.
Angst, Wut, Trauer, Schuld, Freude: Wie diese Gefühle uns helfen, die Klimakrise wirklich wahrzunehmen und ins Handeln zu kommen, erklärt Katharina Mau in diesem Artikel:
Warum uns unsere Psyche schützt
Auf den zweiten Blick leuchtet ein, dass wir uns nicht permanent mit dieser größten aller je da gewesenen Menschheitskrisen auseinandersetzen können, denn wir müssen unser Erleben und Verhalten immer im Kontext unseres Umfelds und unseres Alltagslebens betrachten: Die meisten bewegen sich in oftmals fordernden und anstrengenden Lebensalltäglichkeiten, die allein schon ein hohes Maß an Ausdauer und Energie von uns einfordern: Wir sind ständig dabei, uns selbst neu zu erfinden, hochgesteckte Ziele zu erreichen und »zu performen« – denn in unserer schnelllebigen Welt ist vermeintlich für jede*n von uns Perfektion wie aus dem Ladenregal zu haben.
Jedenfalls wirkt das bei anderen so, als wären sie perfekter als wir – was wohl bei den meisten in großem Widerspruch zur eigenen alltäglichen Realität und Selbstwahrnehmung steht. Wir sind daher ständig unter Druck und im Grunde überfordert uns, was das
Die Fülle unseres Alltags lässt keinen Platz für Gefühle
Andererseits kann die permanente Konsummöglichkeit zu Omnipotenzgefühlen oder Allmachtsfantasien führen, was oft mit einem Gefühl von Abgetrenntsein von der Umwelt einhergeht: Der Mensch ist getrieben von der Fantasie, der Natur überlegen zu sein, sie beherrschen zu können, alles erreichen, haben und bezwingen zu können. Die meisten Menschen erleben sich kaum noch als Teil der Natur – der wir aber nun mal sind.
Hinzu kommen die alltäglichen, oft nicht zu unterschätzenden Herausforderungen: Wer bereits vierzig Stunden in der Woche gearbeitet hat und sich anschließend noch um Kinder, einen pflegebedürftigen Elternteil oder auch nur die eigene Steuererklärung gekümmert hat, gefühlt Hunderte Nachrichten in fünf verschiedenen Messengern beantwortet und sich durch Tausende Schnäppchen geklickt hat, um am Ende doch nichts zu kaufen, hat oft keine Kapazitäten mehr für Gefühle, erst recht nicht für Klimasorgen oder gar -engagement.
Wir sind viel zu beschäftigt oder gar getrieben, die Fülle unseres Lebensalltags zu bewältigen. So sehr, dass vielen sogar die Zeit oder Energie für soziale Kontakte oder Hobbys fehlt. Vor die Wahl gestellt, ob wir uns heute lieber mit den neuesten Klima-Schreckensmeldungen beschäftigen oder uns stattdessen mit einer lieben Freundin verabreden, müssten die meisten von uns vermutlich nicht lange überlegen.
Die menschliche Psyche ist faszinierend: Unser Unbewusstes findet allerlei kreative Lösungsmöglichkeiten, um unangenehme Spannungszustände und Gefühle von uns fernzuhalten. Einige dieser Abwehrstrategien mit Klimabezug möchten wir dir gerne näher vorstellen, damit du in Zukunft selbstbestimmt entscheiden kannst, wie du auf die Klimakrise reagieren möchtest. Und bestimmt wirst du – wie wir uns auch – dich und andere wiedererkennen.
Die Pseudoberuhigung: Der Glaube, eine einzelne Handlung könnte das ganze Problem lösen
Lange konnte ich mir mein Mitmachen ›schönreden‹, indem ich vor meinem inneren Auge die sinnvolle und weniger gut bezahlte Arbeit meiner Frau in der Umweltbildung mit meiner hoch bezahlten, sinnlosen Stelle in der Mobilitäts-Forschung verrechnete und so versuchte, den systemimmanenten Schaden zu verringern und in der Gesamtbilanz (auf Familienebene) neutral zu sein. Eine Milchmädchenrechnung, denn außer Acht gelassen war hier unser zugrunde liegender, vielleicht zu hoher oder besser gesagt üblicher Lebensstil.
Dieses Verrechnen von Klimaschäden, das Stefan Kaindl beschreibt, ist letztlich eine Rationalisierung, die vermutlich täglich millionenfach passiert und der wir auch selbst immer wieder aufsitzen.
Sie findet sich in Aussagen wie: »Ich flieg ja schon kaum in den Urlaub, da kann ich wenigstens weiter Fleisch essen«, oder:
Wenn es um das »Verrechnen von klimaschädlichen versus -schützenden Verhaltensweisen« geht, bietet es sich an, eine wichtige menschliche Grundtendenz näher zu betrachten, weil sie gerade für die Klimagefühle wichtig ist, nämlich den sogenannten Single Action Bias. Der Begriff meint unsere menschliche Tendenz (»bias«), uns in unserem Stress mit den ökologischen Krisen bereits nach einer einzelnen umweltfreundlichen Handlung (»single action«) besser und entlasteter zu fühlen.
Unser Verhalten wird der Dimension der Krise nicht gerecht.
Dafür gibt es viele Beispiele: Wer die unangenehme
Versteht uns nicht falsch: Es ist super, wenn wir mal auf Fisch verzichten oder dienstags mit dem Rad fahren. Es wird nur der Dimension der Krise überhaupt nicht gerecht. Die Beruhigung, die nach einer derart singulären Verhaltensänderung auftritt, kann somit nur eine Pseudoberuhigung sein, denn das Grundproblem bleibt unverändert bestehen. Der Single Action Bias ist in uns Menschen fest verankert, wir werden ihn nicht los.
Die einzige Hilfe, die es an dieser Stelle gibt, ist, immer wieder auf ihn aufmerksam zu machen. Ihn zu kennen, sich selbst an dieser Stelle und das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen und anderen Menschen von ihm zu berichten.
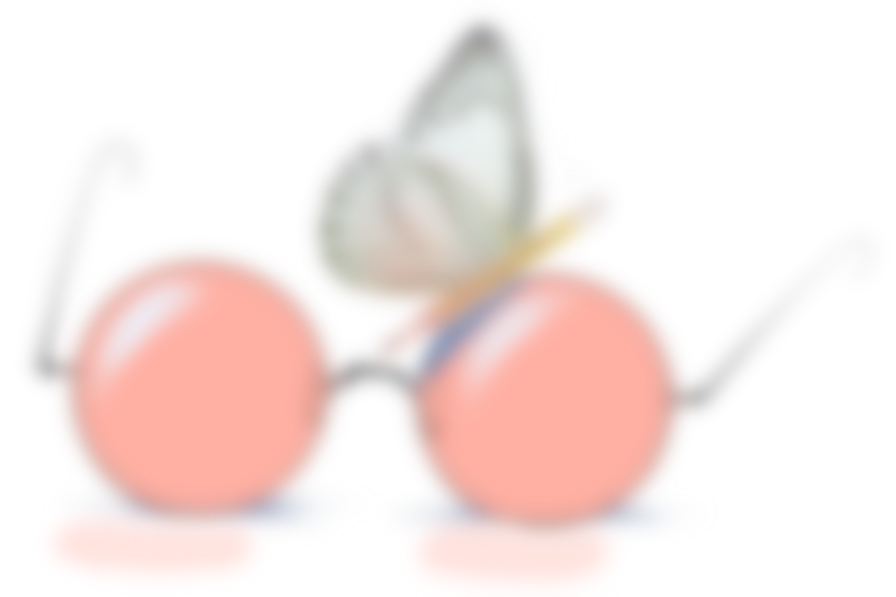
Verdrängung und Verleugnung: Wie wir uns unangenehmer Gefühle entledigen
Wenn unangenehme Fakten einfach weggeschoben werden oder gar regelrecht vergessen werden, spricht man von »Verdrängung«, das Beispiel zeigt dies: »Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn dieser oder jener Kipppunkt überschritten wird.« Prompt denken wir nicht mehr dran. Verdrängung funktioniert. Tatsächlich verdrängen wir alle ständig erfolgreich irgendetwas – und oft sind das entsprechende Wissen und damit auch das unangenehme Gefühl tatsächlich (vorübergehend) wie weg.
Du kennst das bestimmt auch: Wer verdrängt nicht gerne den Gedanken an die Notwendigkeit, sämtliche Buchführungsunterlagen für die nächste Steuererklärung zu sammeln und ordentlich abzulegen? Oder die Tatsache, dass es für die eigene Gesundheit wirklich günstig wäre, weniger Chips und Schokolade zu essen und stattdessen mehr Sport zu treiben? Normalerweise holen uns verdrängte Themen in unserer Psyche irgendwann wieder ein, zum Beispiel wenn das Erinnerungsschreiben des Finanzamtes eintrudelt oder eine ärztliche Kontrolle ergibt, dass die Cholesterinwerte bedenklich in die Höhe geschossen sind. So ist es bei den meisten Menschen auch mit der Klimakrise.
Über die Klimakrise zu sprechen, macht sie uns bewusst.
Wir denken im Alltag nicht viel über sie nach, wenn wir aber zum Beispiel einen Bericht im Fernsehen schauen oder uns mit jemandem über diese Themen unterhalten, ist das Bewusstsein schnell wieder da (und manchmal auch gleich die unangenehmen Gefühle, die es begleiten und die uns dazu gebracht haben, sie erst einmal beiseitezuschieben). Unter anderem deswegen ist es übrigens so wichtig, dass an so vielen Stellen wie möglich über die Klimakrise gesprochen und medial berichtet wird. Dann können wir uns nicht so einfach wegducken.
Anders ist es bei der Verleugnung, einer stärkeren und hartnäckigeren Form der Verdrängung. Bei der Verleugnung wird selbst die Tatsache an sich, beispielsweise die
Eine Ausnahme kann es sein, wenn es sich um uns nahestehende Menschen handelt, bei denen wir grundsätzlich auf eine vorhandene Bindung, gemeinsames Erleben und eine geteilte Gesprächskultur zurückgreifen können. Ist dies nicht der Fall, raten wir in aller Kürze eher dazu, sich die eigene Zeit und Energie zu sparen und sich trotzdem verbal und in der eigenen Haltung klar und konsequent abzugrenzen. Verleugnung tritt im Vergleich zur Verdrängung sehr viel seltener auf. Dies ist schon daran erkennbar, dass inzwischen alle im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien die Existenz der Klimakrise grundsätzlich anerkennen – mit Ausnahme der AfD. (Wirklich ins Handeln kommen sie deswegen noch nicht – die Verdrängung wirkt.)
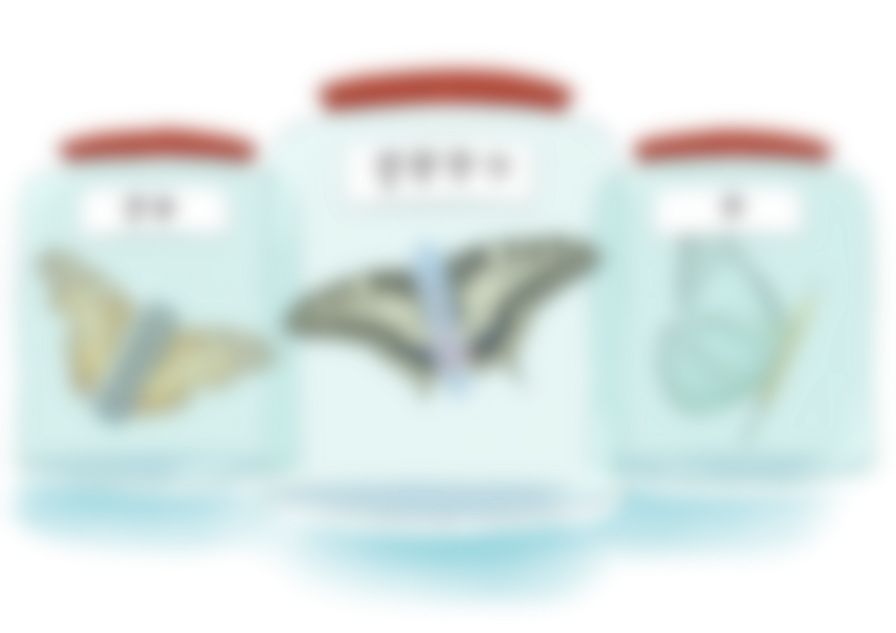
Isolierung und Verantwortung abschieben: Darum machen wir weiter wie zuvor
Wir wenden uns einem weiteren Abwehrmechanismus zu, der sogenannten Isolierung. Klingt erst mal kompliziert, ist es aber gar nicht: Isolierung begegnet uns vor allem in Journalismus und Politik, wo sich die Klimakrise als eine Aneinanderreihung von Problemen wiederfindet, die es anzugehen gilt: Coronakrise, Wirtschaftskrise, »Flüchtlingskrise« (wir bevorzugen hier das Wort: Humanitätskrise) … und irgendwo in dieser Reihe taucht dann auch mal die Klimakrise auf.
Eine solche Auflistung beziehungsweise Aneinanderreihung führt zu dem Eindruck, dass wir es grundsätzlich mit vielen isolierten und scheinbar gleichwertigen Problemen zu tun hätten. Dass die Klima- und Biodiversitätskrise aber ursächlich zu Flucht und Migration, zu Armut und Wirtschaftskrisen, zu Pandemien und vielem mehr führt, wird dabei ausgeblendet. Stattdessen können wir bei Annahme einer solchen Aneinanderreihung dann getrost mit dem »Leichtesten« oder Konkretesten anfangen und schieben so unmerklich die Behebung von Ursachen immer wieder auf – mit verheerenden Folgen.
Hilfreich scheint uns an dieser Stelle die Nutzung der sogenannten Bühnenmetapher aus der Psychoanalyse: Klima- und
Hinzu kommt der erhebliche Zeitdruck. Die Priorisierung in unserem persönlichen Handeln, aber selbstverständlich vor allem auch im Handeln sämtlicher Entscheidungsträger*innen muss klar auf den Schutz unserer Lebensgrundlagen ausgerichtet werden. Bis dies nicht der Fall ist, bleibt uns nichts anderes übrig, als dies konsequent einzufordern. An dieser Stelle landen wir direkt beim nächsten Hemmnis der psychischen Bewusstwerdung und Verantwortungsübernahme: »Die Politik muss das richten, was soll ich als Individuum denn schon machen?« Stimmt – aber nur zum Teil.
Diese Verschiebung von Verantwortlichkeiten von uns auf andere ist auch eine Form von Abwehr, die es uns erlauben soll, einfach weiterzumachen wie zuvor. Aber Vorsicht vor zu schneller Verurteilung: Neben reiner Bequemlichkeit können sich auch Überforderung und Hilflosigkeit dahinter verbergen. Denn wenn die Last einer Aufgabe zu groß wird, muss die damit verbundene Überforderung gegebenenfalls abgewehrt werden, da sie sonst zum Beispiel zu Ohnmachtsgefühlen führen kann oder selbstwertschädigend wirkt. Wer Verantwortung abwehrt, schützt sich vielleicht selbst, damit tut er der Umwelt allerdings keinen Gefallen.
Früher hat Psychologin Renée Lertzman selbst unter Klimaangst gelitten, heute berät sie Unternehmer:innen weltweit. Mit diesen 4 Schritten gelingt es auch dir, deine Ängste zu überwinden:
Wie wir den Abwehrmechanismen gesund begegnen können
Wie kann sie uns dann aber gelingen, die Bewusstwerdung der Klimakrise, trotz all der offenbar bestens funktionierenden psychischen Abwehrmechanismen?
An dieser Stelle bedienen wir das Bild des Eisberges: Wie den meisten Menschen ist ja auch dir sicher bekannt, dass bei einem Eisberg lediglich die Spitze aus dem Wasser ragt, während sich der überwiegende Teil der Eismasse unter der Wasseroberfläche fortsetzt. Anhand dieses Bildes können wir auch die menschliche Verarbeitungstiefe der Klimakrise beschreiben:
Der sichtbare Teil über der Wasseroberfläche steht in diesem Fall symbolisch für das grundsätzliche rationale Verständnis, dass es die Klimakrise gibt und dass sie ein Problem für uns ist. Die allermeisten Menschen hierzulande stimmen dieser Feststellung zu. Doch immer mehr Leute verstehen auch, dass der Eisberg unter der Wasseroberfläche weiter reicht. Oft beginnt es damit, einen eigenen, sehr persönlichen und auch emotionalen Bezug herzustellen.

Für mich, Mareike, sind meine Tochter und ihre Zukunftsperspektive der persönliche Bezug, der mir eine emotionale Verbindung zur Klimakrise ermöglicht hat. Wir ergänzen in solchen Momenten unser Faktenwissen mit ganz individuellem Erfahrungswissen.
Es sind solche persönlichen, ganz individuellen Bezüge, die unsere psychische Verarbeitungstiefe der Klimakrise direkt betreffen, oder, um im Bild des Eisberges zu bleiben, die uns die unter Wasser liegenden – die im zuvor unbewussten Bereich befindlichen – kolossalen Ausmaße des Problems bewusst werden lassen.
Es müssen nicht immer Naturerfahrungen sein, die unsere innere Auseinandersetzung mit der Klimakrise in Gang setzen oder vertiefen. Aus der Psychologie ist bekannt, dass letztlich jede einzelne »mentale Operation« dazu in der Lage ist. Das bedeutet, sobald wir uns über die Klimakrise austauschen, Bücher wie dieses lesen, Prognosen wagen, Wissen verknüpfen oder uns in einem ernsten Gespräch mit unseren Liebsten fragen, wo in 50 Jahren wohl noch sichere Lebensräume für uns Menschen erhalten sind – in all diesen Momenten tauchen wir tiefer in das Wasser hinab, um die Ausmaße des »Eisbergs Klimakrise« weiter zu erkunden.
Genau genommen aber dehnt sich unsere Verarbeitungstiefe aus und kann uns tief und bis in unser Innerstes erschüttern. Diese Tatsache allein lässt übrigens die simple Schlussfolgerung zu, dass es immer, wirklich immer hilfreich ist, wenn wir mit anderen über die Klimakrise sprechen. Das Sprechen erzeugt stetig aufs Neue ein Sich-ins-Bewusstsein-Rufen und erhöht somit nach und nach die Wahrscheinlichkeit, dass mehr und mehr Menschen ins Handeln kommen.
Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor auf unser Problembewusstsein ist die Frage, wie sich die Menschen um uns herum verhalten. Hier kommt wieder die Psychologie ins Spiel, die uns in vielen, vielen Studien zeigte, dass wir sehr soziale Wesen sind und uns in unserem Wahrnehmen und Handeln sehr viel mehr an unserem Umfeld ausrichten, als es uns bewusst ist.
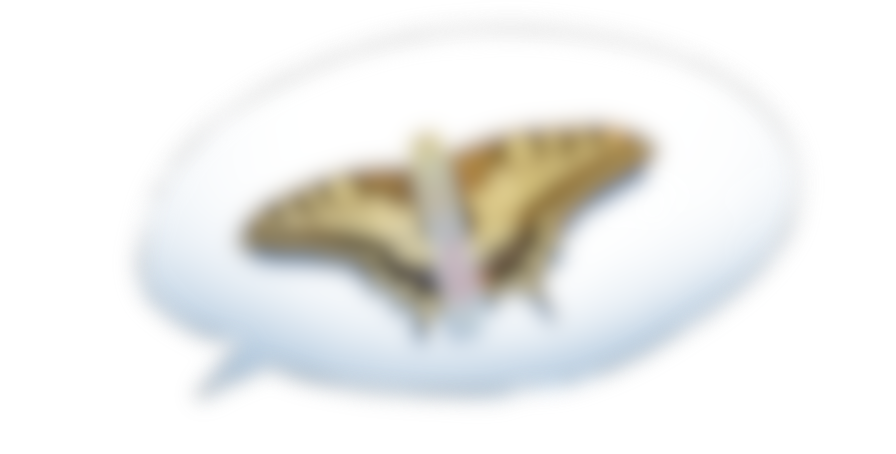
So nutzen wir die Psychologie für unsere Zwecke
Als Menschen passen wir im Alltag ganz unbewusst unser Fühlen, Denken und Verhalten den Leuten in unserer Umgebung an. Psychologisch lässt sich das unter anderem so begründen: Die meisten von uns haben ein feines Gespür für soziale Normen und fallen ungern (negativ) auf. Das führt auch dazu, dass wir uns als ein und dieselbe Person als Fan in einem Fußballstadion anders benehmen als auf einem Klimastreik der
Oder aus einer anderen Perspektive: Sitzen wir selbst mit unserer Familie oder Freund*innen zusammen und tauschen uns über die nächsten zu erwartenden Wetterphänomene aus, kann das sogar erst mal mit einer Faszination oder gar Sensationslust einhergehen. Es kann aber auch die gesamte Stimmung im Raum verändern, wenn nur eine*r der Beteiligten andere Gefühle wie Ernst und Sorge zum Ausdruck bringt.
Unsere Beeinflussbarkeit durch Gruppen und soziale Normen lässt sich also im Sinne des Klimaschutzes nutzen, denn durch unser individuelles Fühlen, Denken und vor allem unsere Emotionen und unser Verhalten prägen wir die Normen schließlich mit. Auf diese Weise kann jedes Gespräch eine große Wirksamkeit entfalten und das Klima-Problembewusstsein in deinem persönlichen Umfeld und Freundeskreis erheblich wachsen, wenn du es wagst, deine eigenen Gefühle zum Ausdruck zu bringen, auch und vor allem wenn andere dabei sind.
Indem wir anderen neue Normen vorleben, können wir sie verändern.
Du kannst gerne ehrlich zugeben, dass dir eine Unwetterwarnung oder ein Schulausfall wegen eines zu erwartenden Unwetters – wie wir es Anfang 2022 beispielsweise durch die drei aufeinanderfolgenden Sturmtiefs »Zeynep«, »Ylenia« und »Antonia« erfahren haben – nicht nur Freude macht, sondern wegen der damit verbundenen Bedrohung auch mit Sorgen oder Ängsten verbunden ist.
Es hält uns auch psychisch gesund, wenn wir für unsere Gefühle einstehen und sie ernst nehmen. Hinzu kommt dein Einfluss auf die Gewohnheiten deines Umfelds durch dein konkretes Verhalten: Du kannst wirksam werden und etwas verändern, indem du neue Normen direkt vorlebst. Um hier jetzt mal ein anderes Beispiel zu nennen und zu verdeutlichen, in wie vielen Lebensbereichen solche Normveränderungen möglich sind:
Du könntest beispielsweise zu deiner nächsten Geburtstagsfeier ein komplett veganes (und natürlich trotzdem leckeres!) Essen servieren. Die Menschen werden feststellen, dass es lecker ist und trotzdem (oder gerade deswegen) eine entspannte, tolle Party mit dir feiern. Diese Veränderungen von sozialen Normen werden in den nächsten Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen. Das Gute ist, dass du selbst direkt damit anfangen kannst. Es ist sogar sehr gut möglich, dass du durch die damit verbundenen Ansteckungseffekte mehr Wirksamkeit entfaltest, als wenn du dich für dich allein Tag für Tag pflanzlich ernährst.
Redaktion: Désiree Schneider
Mit Illustrationen von Frauke Berger für Perspective Daily



