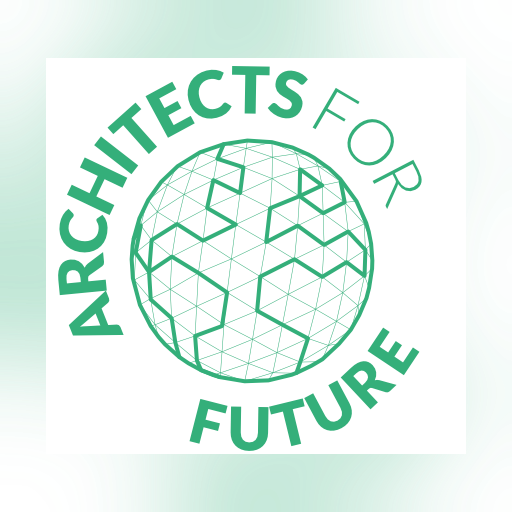Was Lehm zum Baumaterial der Zukunft macht
Jahrhundertelang sind aus Lehm Häuser gebaut worden. Dann kam die Industrialisierung und der natürliche Baustoff geriet in Vergessenheit. Nun wird das Erdmaterial aufgrund seiner vielen vorteilhaften Eigenschaften wiederentdeckt.
An einem heißen Tag im Sommer 2014 steht die Künstlerin Ute Reeh bis zum Bauch in einem Graben. Auf einem Hof im Nordwesten Brandenburgs gräbt sie mit Spaten und bloßen Händen nach einer defekten Wasserleitung.
Der Hof im 180-Seelen-Dorf Nebelin im Landkreis Prignitz ist der Sitz des von ihr gegründeten

So erzählt es Ute Reeh heute, wenn man sie danach fragt, wie sie – die
Von ihrer Nachbarin erfuhr Ute Reeh nämlich, dass die Ruhe, die sie in Nebelin genießt, akut gefährdet ist. Durch die Autobahn 14, deren letztes Teilstück zwischen Magdeburg und der Prignitz bis spätestens 2030 geschlossen sein soll. Dann wird die 2-spurige Straße auf einen Kilometer an Nebelin heranrücken, das
Als Künstlerin ist Reeh an scheinbar unlösbaren Situationen interessiert und nimmt die Herausforderung an. Den Bau der Autobahn wird sie nicht verhindern können, stattdessen macht sie sich auf die Suche nach einem konstruktiven Umgang mit der ungeliebten Schnellstraße.
Ein ökologisches Vorzeigeprojekt
Als die Autobahnmanager im Februar 2019 in das Dorf kommen, um den Bewohner:innen Rede und Antwort zu stehen, kommt Reeh eine Idee: Eine Schallschutzwand aus Lehm könnte Menschen, Natur und Landschaft vor dem
Innerhalb von 2 Jahren wird aus dieser Idee ein ökologisches Vorzeigeprojekt, das die Bundesanstalt für Straßenwesen ebenso interessiert wie die Bundesstiftung Baukultur. Ende 2021 sind dem Vorhaben 880.000 Euro aus dem früheren Parteienvermögen der DDR zugesagt worden.
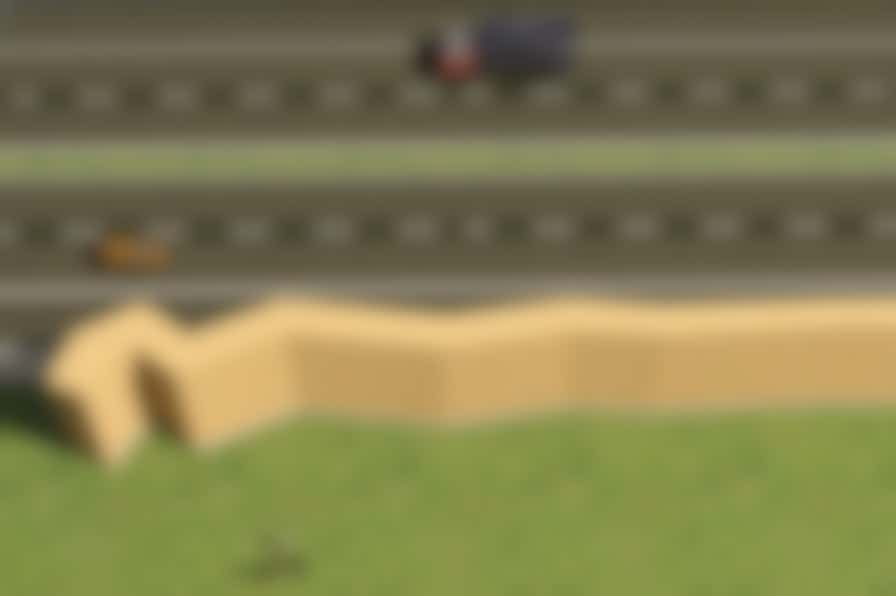
Mittlerweile steht im Dorf eine
Was in dem kleinen Dorf erprobt wird, könnte bundesweit ausstrahlen. Dann nämlich, wenn die Idee des »Naturschutz hochklappen« aufgeht und sich statt aus Aluminium oder Beton Wände aus bloßer Erde in die Landschaft einpassen und Insekten, Fledermäusen und Vögeln Unterschlupf bieten. Wenn also Lebensraum, der durch die Autobahn versiegelt wird, durch die Lehmwand einen vertikalen Ausgleich erhält.
Der Bausektor gehört zu den größten Verbrauchern natürlicher Ressourcen
Dass die Idee des »Lehmlärmschutzes« bei Architekt:innen, Behörden und selbst bei den Autobahnbauern auf solches Interesse stößt, verdeutlicht, wie gut sie in die Zeit passt. Eine Zeit, in der sich der Bausektor wandeln muss, Beton nicht länger als Allzweckbaustoff herhalten kann und natürliche Materialien eine Renaissance erleben.
In einem
Jeden Tag wird in Deutschland eine Fläche von 52 Fußballfeldern versiegelt
Unter diese Ressourcen fallen nicht nur Baumaterialien wie Holz, Sand oder Kies, sondern auch Flächen. So rechnet das Umweltamt vor, dass sich allein in Deutschland die
Mehr als 2/3 aller in Deutschland abgebauten Rohstoffe werden von der Bauindustrie weiterverarbeitet. So wird für die Herstellung von Beton neben Sand und Kies auch Zement benötigt. Die Herstellung von Zement ist besonders energieintensiv. Weltweit könnten 8% der Treibhausgasemissionen auf die Herstellung des Bindemittels zurückgeführt werden,
Man kann stattdessen aber auch auf ein Baumaterial setzen, das sich seit Jahrtausenden in nahezu allen Teilen der Welt bewährt hat; das weder angebaut noch hergestellt werden muss und das darüber hinaus vollständig recycelt werden kann. Gemeint ist der natürliche Baustoff Lehm.
Zement wird überflüssig
Doch was genau ist Lehm? Es ist ein Erdmaterial, das sich aus den anorganischen Sedimenten Sand, Schluff und Ton zusammensetzt. Die 3 Bodenarten werden durch ihre Korngröße voneinander unterschieden. Sand ist mit einer Korngröße von mehr als 63 Mikrometern das gröbste Material, Ton mit einer Korngröße von weniger als 2 Mikrometern das feinste. Der Ton fungiert beim Lehm als natürliches Bindemittel, Zement werde deshalb überflüssig, erklärt Christian Hansel.
Der Lehmbauer aus Großpösna bei Leipzig arbeitet seit 30 Jahren mit dem Material und saniert vor allem historische Gebäude. Ein Lehmputz im Inneren eines Gebäudes sei heute nichts Besonderes mehr, sagt er. Da Lehm in praktisch allen Farben vorkomme, ließen sich die Wände je nach Wunsch seiner Kund:innen verputzen. Aber das ist nicht alles. Mit vorgeformten Lehmsteinen lassen sich problemlos auch meterhohe Wände errichten.

Für den sächsischen, anhaltinischen und thüringischen Raum, in dem Christian Hansel tätig ist, war sogenannter Wellerlehm, ein Gemisch aus Lehm und Stroh, lange ein typisches Baumaterial. »Es gibt hier einen sehr guten Lösslehm, der sich am Ende der Eiszeit gebildet hat«, sagt Hansel. Daher fänden sich gerade im Osten Deutschlands solche historischen Lehmbauten. Nur erkenne das ungeübte Auge sie nicht. »Die Wohnhäuser sind von außen meist verputzt. Aber an Scheunen kann man das Material oft noch direkt sehen.«
Bis um 1900 sei Lehmbau der Standard gewesen, dann sei mit der Industrialisierung der Bau von Ziegeleien eingezogen und habe den Lehmbau verdrängt, so Hansel. Statt der luftgetrockneten Lehmsteine
Paläste und Städte aus Lehm
Die Künstlerin Ute Reeh und mit ihr ein Team aus Architekt:innen, Lehmbauexpert:innen und Wissenschaftler:innen nennt das Vorhaben, die Lärmschutzwand und Raststätte bei Nebelin aus Lehm zu errichten, die »Alhambra Brandenburgs«. Das klingt hoch gegriffen, ist aber auch ein starkes Bild. Denn
- Das vielleicht beeindruckendste Beispiel ist die Altstadt von Shibam im Jemen. Dort sind bereits im 16. Jahrhundert
- Aus dem Material baut auch heute der in Berlin lebende und in Burkina Faso aufgewachsene
- Aber auch in Deutschland wurden in jüngster Vergangenheit mit Lehm Maßstäbe gesetzt. Der

Die Vor- und Nachteile des Baustoffs Lehm
Dass Lehm in jüngster Zeit als Baumaterial wieder mehr Bedeutung zukommt, ist seinen vorteilhaften Eigenschaften geschuldet. Was Lehm so attraktiv macht:
- Lehm ist global verfügbar. Geeignetes Erdmaterial findet sich nahezu überall auf der Welt. Dadurch entfallen lange Transportwege zwischen Abbaugebiet und Baustelle.
- Lehm ist ein Naturmaterial. Wird ein Gebäude wieder abgerissen, kann der
- Lehm lässt sich einfach und energiearm verarbeiten. Das Material erhält seine Festigkeit durch Trocknung. Es muss nicht wie Ziegel im Ofen gebrannt werden und kann durch die Zugabe von Wasser immer wieder neu gestaltet und verarbeitet werden. Zusammen mit Holz und Stroh lassen sich die Eigenschaften der unterschiedlichen Naturmaterialien vorteilhaft kombinieren.
- Lehm schafft ein angenehmes Raumklima. Nicht nur in Deutschland werden die Sommer länger, trockener und heißer. In Gebäuden aus Lehm bleibt es im Sommer angenehm kühl, und im Winter speichern Lehmwände die Wärme. Als Putz im Innenraum nimmt Lehm Luftfeuchte auf und gibt sie nach und nach wieder ab. Das schafft eine optimale Innenraumluftfeuchte um die 50% und vermindert Schimmelbildung.
- Lehm ist bislang nur von geringen Preissteigerungen betroffen, die sich vor allem aus dem Transport ergeben.

Bei all den Vorteilen hat Lehm auch eine Achillesferse. Das Material ist nicht wasserfest und muss deshalb vor Regen und Frost geschützt werden. Im Außenbereich genügt oft schon ein Dachüberstand, der die Wände vor direkter Regeneinwirkung abschirmt.
Daneben ist die Verarbeitung des Materials aufwendiger, als es der Einsatz von Beton und Stahl ist: Die Trocknungszeiten müssen eingehalten werden. Lehm wird feucht verarbeitet, danach muss er trocknen und sich setzen, um seine Festigkeit zu erhalten. Damit das Material austrocknen kann, sind warme Temperaturen Voraussetzung. Deshalb beschränkt sich die Verarbeitungszeit auf die Zeit zwischen April und September.
Da es sich um ein Naturmaterial handelt, kann außerdem die Zusammensetzung variieren, und es gilt, die Verarbeitung den individuellen Anforderungen anzupassen. Einen Neubau aus Lehm zu errichten, ist bislang in Deutschland – auch aufgrund der einzuhaltenden Baunormen – noch immer schwierig.
Dass sich diese Eigenschaften aber in den Griff bekommen lassen, zeigt sich unter anderem an dem Firmengebäude von Alnatura, das 500 Mitarbeiter:innen Arbeitsraum bietet.
Das Material bleibt dasselbe, die Verarbeitung geht mit der Zeit
Ein Pionier des Lehmbaus der Gegenwart ist Martin Rauch aus dem österreichischen Voralberg. Mit seinem Unternehmen

Später wurde ihm klar, dass Lehm auch ein traditionelles europäisches Baumaterial ist, das jedoch einige Zeit in Vergessenheit geraten war. Rauch fragte sich nach den Gründen und fand sie im Fortschrittsnarrativ, das mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert auch den Blick auf die Architektur prägt. »Was neu ist, ist besser«, fasst er diese Erzählung knapp zusammen. Gebäude aus Erdmaterial, wie man sie in Jahrhunderten zuvor gebaut hatte, passten nicht mehr zum Zeitgeist und wirkten rückwärtsgewandt.
Heute sei man dem Baustoff Lehm gegenüber wieder deutlich aufgeschlossener, findet Martin Rauch. Das Material selbst habe sich hingegen in den letzten 300 Jahren nicht verändert, auch heute nutze er »Erde pur«, wie er sagt. Verändert habe sich aber die Logistik und das Werkzeug, mit dem das Material verarbeitet werde. Und die erschließen dem Lehm neue Einsatzmöglichkeiten. Lärmschutz ist eine davon.
Bereits 1984 hatte sich Rauch an einem Wettbewerb für innovativen Schallschutz an Österreichs Autobahnen beteiligt. Der damals 26-Jährige gewann den ersten Preis in der Kategorie »Kunst« und sollte seine Idee an einem 2,5 Kilometer langen Abschnitt nahe Graz verwirklichen. Dann kamen Wahlen und mit Robert Graf ein neuer Bauminister von der konservativen ÖVP. Das Vorhaben wurde eingestampft.
Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt Martin Rauch heute das Vorhaben der Künstlerin Ute Reeh in Nebelin. Er sieht dafür gute Chancen. Es gäbe ein deutlich stärkeres Interesse an ökologischen Alternativen im Bauwesen. »Der größte CO2-Produzent ist die Baustoffindustrie. Wenn man das gravierend ändern will, kommt man zweifellos auf die Idee des Lehmbaus«, zeigt er sich überzeugt. Die Erde, die beim Bau der Autobahn anfällt, könnte direkt für die Lärmschutzwand verwendet werden.
Ein Insektenhotel ungeahnten Ausmaßes
Und sie könnte im besten Fall sogar als »vertikale Ausgleichsmaßnahme« anerkannt werden. Damit wäre sie für den Bauträger, der nach dem Bundesnaturschutzgesetz für den angemessenen Ausgleich seines Eingriffs in die Landschaft sorgen muss, noch mal attraktiver. Denn der mit Asphalt versiegelten und der Natur entzogenen Fläche könnte die Lehmwand in direkter Nähe einen potenziellen Lebensraum für Tiere entgegensetzen.
Gerade für Wildbienen sind sonnenbeschienene Wände aus Naturmaterial ein willkommener Ort für den Nestbau. Bildlich gesprochen könnte ein Insektenhotel ungeahnten Ausmaßes an der Autobahn entstehen.
 In den Kieswerken bei Perleberg unweit von Nebelin ist bereits eine hydraulische Testpresse für Lehmblöcke zum Einsatz gekommen. Quelle: Fabian Lehmann
In den Kieswerken bei Perleberg unweit von Nebelin ist bereits eine hydraulische Testpresse für Lehmblöcke zum Einsatz gekommen. Quelle: Fabian Lehmann  Solche Lehmblöcke sollen zukünftig maschinell hergestellt werden, um den Bau mit Lehm effizienter zu machen. Quelle: Fabian Lehmann
Solche Lehmblöcke sollen zukünftig maschinell hergestellt werden, um den Bau mit Lehm effizienter zu machen. Quelle: Fabian Lehmann »Die größte Herausforderung ist nicht die Technik, sondern es sind die Kosten und das Vertrauen. Noch will niemand Verantwortung für diese Bauweise übernehmen«, sagt Martin Rauch. An beidem arbeiten Lehmbauunternehmen wie das von Rauch derzeit. So soll im brandenburgischen Nebelin im ersten Schritt eine Maschine entwickelt werden, die Lehmblöcke industriell fertigen und so die Arbeitszeit und damit die Kosten für den Bau enorm verkürzen kann.
Sollte dies gelingen, dürfte sich das Vertrauen in das uralte Baumaterial auch für größere Vorhaben langsam wieder einstellen. Auch jetzt schon ist ein Imagewandel deutlich erkennbar. Als der Lehmbauer Christian Hansel vor 30 Jahren anfing, galt er als Exot und wurde noch belächelt. »Das ist heute nicht mehr so«, sagt Hansel. Die Verfügbarkeit des Materials und seine ökologisch wertvollen Eigenschaften sprächen eindeutig für das Bauen mit Lehm – was die Renaissance des Naturbaustoffs angeht, ist er zuversichtlich.
Redaktionelle Bearbeitung: Maria Stich
Mit Illustrationen von Claudia Wieczorek für Perspective Daily