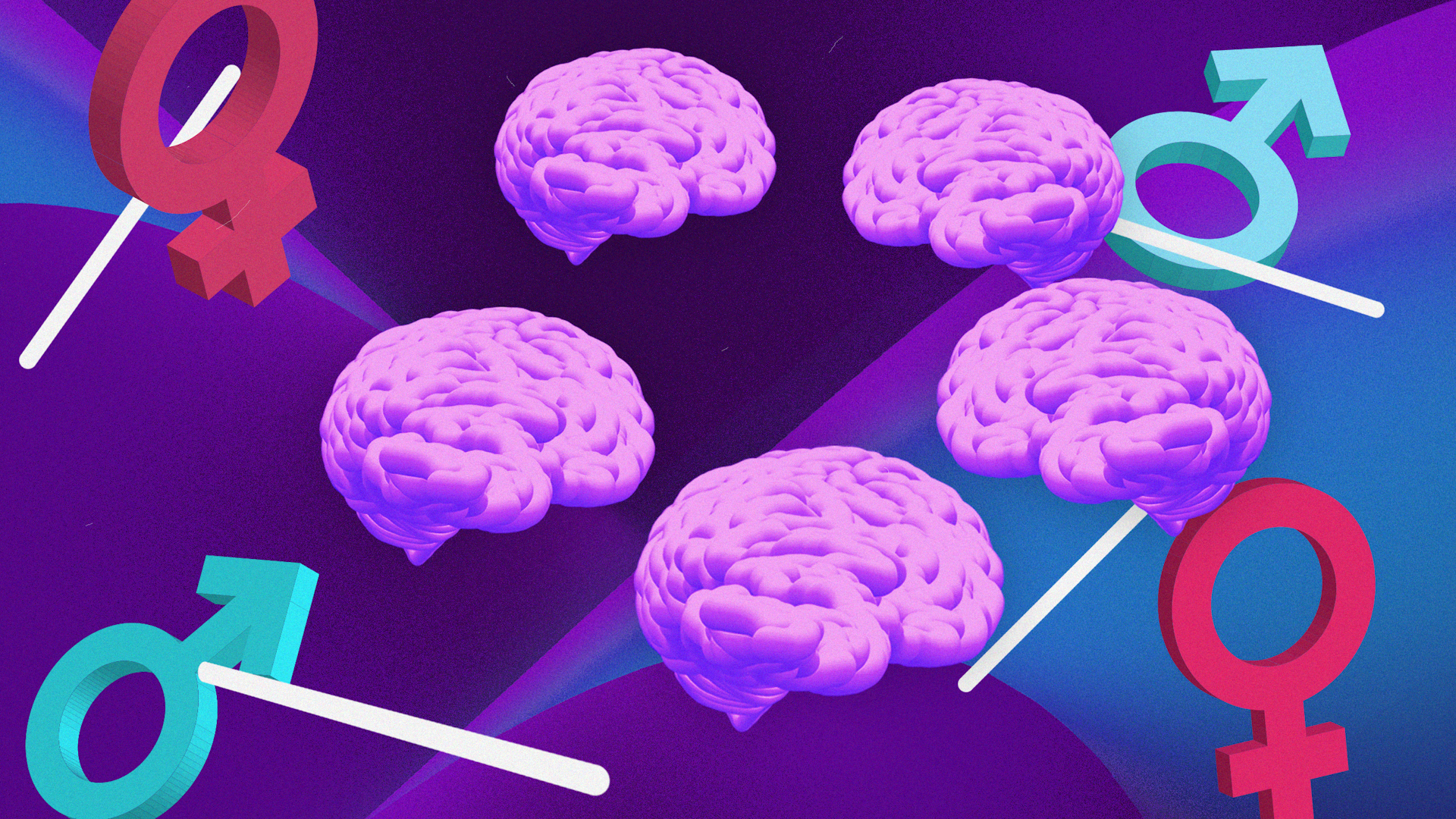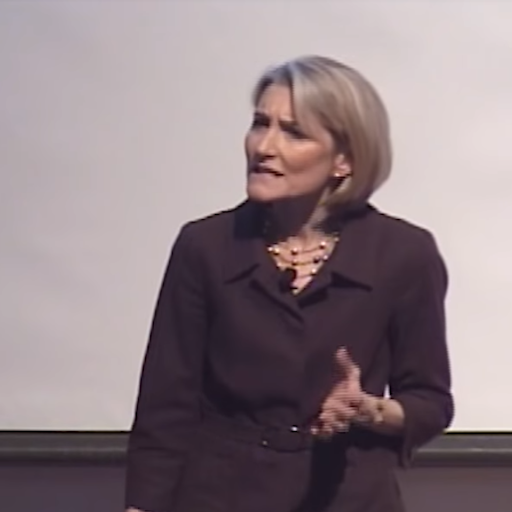Was uns die Wissenschaft über das perfekte Team verrät
Beantworte dir selbst diese 2 Fragen, um herauszufinden, wie dein Team noch besser funktioniert. (Pssst: Mehr Frauen helfen fast immer!)
Die Zielvorgabe des
In der Hoffnung, schnell ein Ergebnis zu finden, analysierte das Google-Team munter drauf los – jedoch ohne Erfolg. Weder die Fähigkeiten noch das Wissen oder die Motivation auf individueller Ebene schienen zu beeinflussen, ob ein Team erfolgreicher war als andere.
Die Ergebnisse widersprachen zunächst dem gesunden Menschenverstand: Sollte das Team aus den cleversten und besten Individuen nicht auch das erfolgreichste sein?
Auf der Suche nach dem »Dream Team«
Eine der klarsten – und irgendwie auch überraschendsten – psychologischen Entdeckungen ist
Parallel zur Operation »Aristoteles« testeten die Verhaltensforscherin Anita Woolley und der Managementprofessor Thomas Malone mit ihren Kollegen ein paar Tausend Kilometer entfernt an der anderen Küste der USA, ob die Intelligenz einer Gruppe aus der Summe der g-Faktoren der Gruppenmitglieder vorhergesagt werden kann. Ähnlich wie das Google-Team waren die Forscher auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage:
Und auch ihre Ergebnisse zeigen: Die beste Gruppe ist weder die mit der höchsten Durchschnittsintelligenz noch die, in der die »schlauste« Person sitzt, also die mit der höchsten individuellen Intelligenz. Die Wissenschaftler waren einem noch unbenannten Phänomen auf der Spur: der kollektiven Intelligenz. In Anlehnung an den g-Faktor eines Individuums nannten sie diese kollektive Intelligenz
Statt der g-Faktoren der Gruppenmitglieder wird dieser vor allem durch 2 Dinge bestimmt, die besser vorhersagen, ob eine Gruppe erfolgreich ist.
1. Schaue mir in die Augen!
Wie gut kannst du Emotionen in den Augen anderer ablesen?
Diese Frage stellten die Wissenschaftler allen Gruppenmitgliedern und ließen sie dafür
Gleichzeitig sorgte ein hoher Frauenanteil in Gruppen für ein besseres Abschneiden.
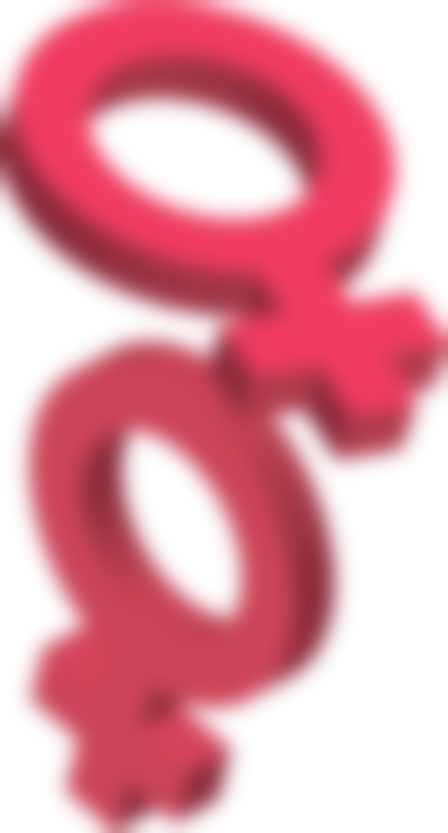
Die Labor-Ergebnisse von Woolley und Malone bestätigen ältere
Je höher die durchschnittlichen emotionalen Fähigkeiten der Team-Mitglieder, desto besser die Leistung des jeweiligen Teams.
Diese Fähigkeit ist Teil des
Die noch wichtigere Eigenschaft erfolgreicher Gruppen hat ebenfalls etwas mit sozialem Austausch zu tun.
2. Rede mit – und hör zu!
Auf Platz 1 der Zutatenliste für die besten Gruppen steht keine Fähigkeit oder Charaktereigenschaft der einzelnen Mitglieder, sondern etwas, das nur in Gruppen untersucht werden kann: die Verteilung der Redezeit. Je ausgeglichener diese zwischen den Mitgliedern verteilt ist und je häufiger Sprecherwechsel stattfinden, desto erfolgreicher die Gruppe.
Dein Vorgesetzter oder deine Chefin hören in Meetings vor allem sich selbst reden? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass deine Abteilung oder dein Unternehmen nicht zu den leistungsstärksten gehört. Das muss nicht sein und hat – wie du sicher schon vermutest – vor allem etwas mit der Organisationskultur zu tun.
In den 1990er-Jahren entdeckte die Organisations-Psychologin Amy C. Edmondson Forschungsergebnisse aus den 1960er-Jahren zur psychologischen Sicherheit wieder und begann, selbst weiter zu forschen. Dabei ging es ihr vor allem um die Frage, ob und wie Teams aus ihren Fehlern lernen.
Sicher fühlen – für mehr Sicherheit!
Die Frage, »ob« Teams dazulernen, ist schnell beantwortet: Ja, Gruppen können aus den eigenen Fehlern lernen. Allerdings nur, wenn die Mitglieder das Gefühl haben, sich kritisch äußern zu können. Ohne dabei ihr Gesicht zu verlieren, ohne Angst haben zu müssen, ausgegrenzt zu werden, weil sie »dumme Fragen« stellen oder Kritik äußern. Amy C. Edmondson und ihre Kollegen zeigten, dass Gruppen schneller lernen, wenn sie Fehler offen diskutierten und
So
Eine Krankenschwester bemerkt während ihrer Nachtschicht in einem geschäftigen städtischen Krankenhaus, dass die Medikamentendosis eines bestimmten Patienten ein wenig hoch erscheint. Kurz denkt sie darüber nach, den Arzt zu Hause anzurufen, um sicherzustellen, dass die Dosis stimmt. Genauso kurz erinnert sie sich an die herablassenden Kommentare über ihre Fähigkeiten beim letzten Mal, als sie ihn dort anrief. […]
Dieses Gefühl von Sicherheit hat also nichts mit Gefühlsduselei zu tun, sondern sorgt dafür, dass Gruppenmitglieder Informationen besser untereinander austauschen.
Ein weiterer Berufsstand, in dem die Fehlerkultur täglich über Leben und Tod entscheidet, ist der der Fluglotsen.
Stattdessen liegt
Noch einen Schritt weiter geht der Ansatz der »Restorative Just Culture« – also der »wiederherstellenden, gerechten Kultur«:
[Eine wiederherstellende, gerechte Kultur] schafft Verantwortung, indem sie nach vorn schaut, um die Bedürfnisse zu erfüllen und beschädigtes Vertrauen und Beziehungen zu reparieren. Sie versucht, zu verstehen, warum es für eine Person sinnvoll erschien, auf eine bestimmte Weise zu handeln.
Ein
Das gilt natürlich auch für Geschäftsführungen, Aufsichtsräte, Universitäten, Ärztestationen, Werkstätten, Lehrerzimmer, Kanzleien, Parlamente, Forschungsgruppen, Redaktionen … – na ja, ihr wisst schon!
Mehr davon? Dieser Text ist Teil unserer Reihe zum Kritischen Denken!
Mit Illustrationen von Robin Schüttert für Perspective Daily