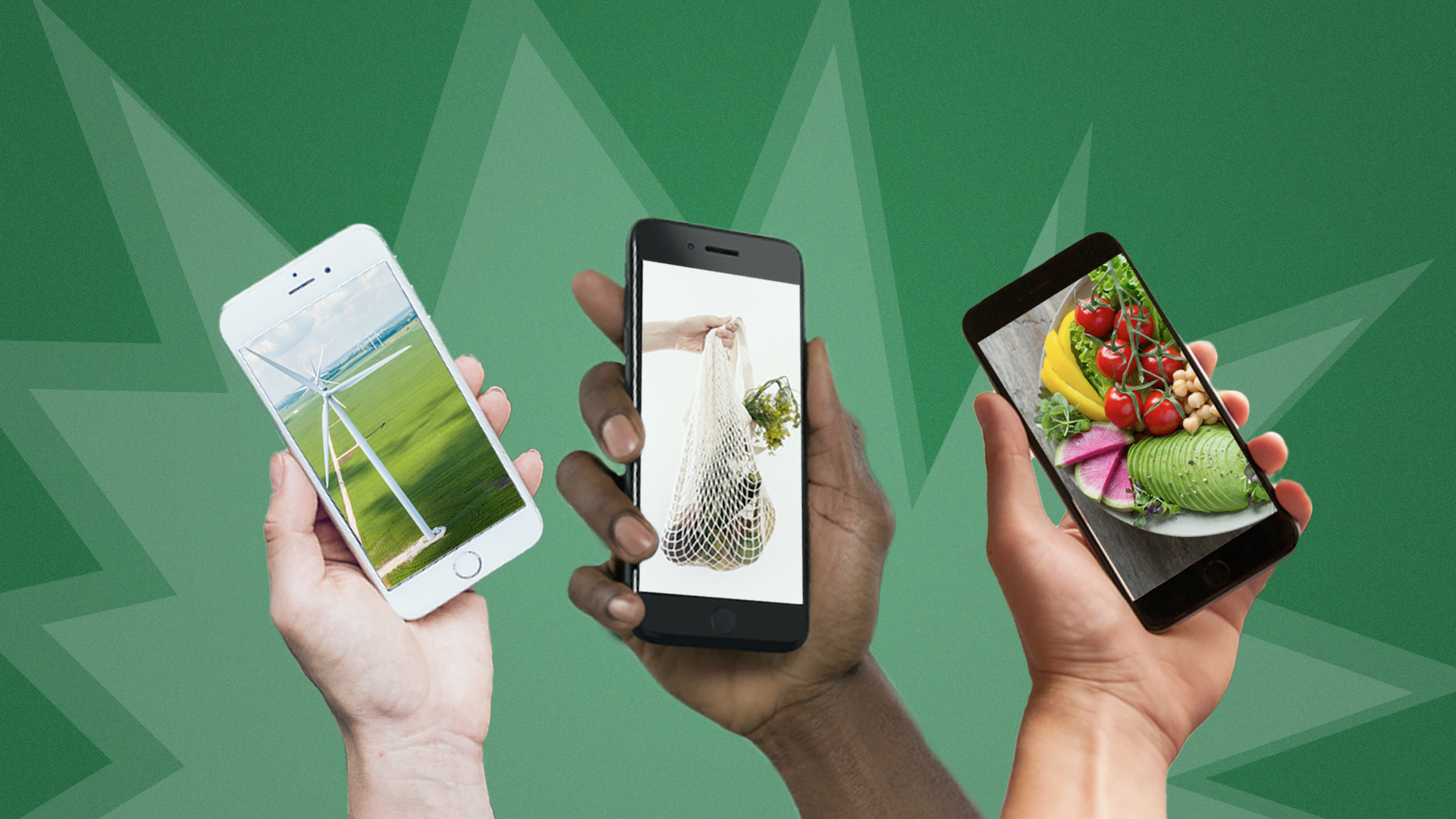Ich gehöre zur »Risikogruppe« – und habe euch etwas zu sagen
Insa leidet an einer chronischen Krankheit. Abstandhalten und strenge Hygiene sind für sie seit Jahren Alltag. In der Coronakrise fallen ihr erstaunliche Dinge auf – weshalb sie unserer Redaktion diesen Brief schreibt.

Ich bin Insa, 45 Jahre alt, und ich nehme Medikamente, die mein Immunsystem drosseln. Seit mehr als 10 Jahren lebe ich mit Multipler Sklerose, einer chronischen Erkrankung des zentralen Nervensystems. Bei dieser schwelenden Entzündung in Gehirn und Rückenmark, die meist schubförmig ausbricht, lernt man zwangsläufig, mit Unsicherheit zu leben. Beispielsweise mit der Ungewissheit darüber, ob das, was gestern ging, morgen auch noch möglich sein wird. Oder mit der Angst, den Verlauf dieser zerstörerischen Krankheit durch zusätzliche psychische und körperliche Belastungen zu verschlimmern. Man lernt zu leben mit der Frage, wo Vorsicht und Selbstschutz anfangen, Lebensqualität zu zerstören, und ob sich das überhaupt gegeneinander aufrechnen lässt.
Ich war im Grunde auf die Coronamaßnahmen perfekt vorbereitet, denn ich lebe seit einigen Jahren in einer selbst gewählten Dauerquarantäne. Ich plane so wenig wie möglich über den Tag hinaus, meide große Menschenansammlungen und behalte die Erkrankung auf diese Weise gut im Griff. Ich bin dankbar, dass ich von einem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem profitiere, also – zumindest pharmazeutisch gesehen – bestmöglich behandelt werden kann.
Aber oft schon habe ich mir gewünscht, dass in meinem sozialen Umfeld – nah und fern – mehr selbstverständliche
Ich bin Profi im Abwägen von Risiken
Aber so ist es nicht. Das Spektrum der Reaktionen reicht von Gleichgültigkeit bis hin zu panischem Mitleid. Das ist bekannt. Jeder, der eine schwere Erkrankung hat oder durchmacht, erlebt das vermutlich.
Um eine eigene Seinsform inmitten dieser Disbalance zu finden, habe ich mich weitgehend zurückgezogen und mir eine Welt gebaut, die nach anderen Maßstäben funktioniert. Ich habe dafür einiges an Unverständnis geerntet, es aber nie bereut.
Und so kommt es, dass ich – im Selbstexperiment – eine Kompetenz entwickelt habe: im Abwägen von Risiken. Im ruhigen Beobachten der Ereignisse. Im besonnenen Handeln in Anerkenntnis der Tatsache, dass es endgültige Sicherheit nicht gibt, für niemanden.
Lebende Organismen sind fragil und endlich. In der Natur entscheidet der Grad der Fragilität über Leben und Tod. Der Organismus, der zu schwach für die ihm gemäße Lebensart oder seinen unveränderbaren Standort ist, stirbt. Bei Pflanzen und Tieren, die der Mensch nicht zu seinem Nutzen oder Vergnügen kultiviert, sehen wir darin kein moralisches oder wirtschaftliches Dilemma. Allerdings hat so manche Tierart ein System, auch kranke oder schwächere Artgenossen zu schützen und zu integrieren. Im Krisenfall müssen sie trotzdem zurückbleiben.
In der Natur entscheidet der Grad der Fragilität über Leben und Tod.
Bisher hat mich noch nichts davon überzeugen können,
Ich selbst bin Teil der geschwächten, schutzbedürftigen
Ich habe in den letzten Jahren oft erlebt, dass geschwächte Menschen wie ich sich als ausrangiert, abgestellt, vergessen oder unnütz erlebt haben. Ich selbst habe mich so erlebt. Es entstand das Gefühl von Schuld, weil ich meinen Teil nicht mehr leisten kann. Weil ich eine Last bin, anstatt belastbar zu sein. Wie oft hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich während einer grassierenden Grippe oder einfach an einem schlechten Tag Freunde auslud, Verabredungen oder Reisen absagte. Meine Nichtbelastbarkeit also offenlegte, mal wieder Sand im Getriebe war. Und so meine Verwundbarkeit auf die Tagesordnung der Belastbaren und Nützlichen brachte.
Gerade trägt dieses uralte Ereignis den Namen Covid-19.
Wir brauchen Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit
Voller Erstaunen sehe ich, wie plötzlich die ganze Welt dieser Unsicherheit Aufmerksamkeit schenkt, mit der ich seit Jahren umgehe.
Voller Erstaunen sehe ich, wie plötzlich die ganze Welt dieser Unsicherheit Aufmerksamkeit schenkt, mit der ich seit Jahren umgehe.
Und ich frage mich: Wenn wir diese Krise überstanden haben, werden wir dann Wege finden, die besonders gefährdeten Menschen zu allen Zeiten besser zu beobachten?
Schenken wir dabei der Frage unsere Aufmerksamkeit, wie es ihnen geht, wie sie behandelt werden? Welche Freiräume ihnen zugestanden werden und wer ihnen zu welchen Bedingungen hilft?
Werden wir uns fragen, wie wir Sicherheit gewährleisten können, ohne sie an
Wenn wir eine Gesellschaft werden wollen, in der jedes Menschenleben zählt, werden wir dann ehrlich genug sein, zuzugeben, dass es in erster Linie um die Lebensqualität dieser einzelnen Menschen gehen muss anstatt um ihren medizinischen Erhalt?
Dazu sollten wir sofort ein Gesundheitssystem aufbauen, das nicht dem Diktat der Wirtschaftlichkeit unterworfen ist, sondern den Prinzipien der Hilfsbereitschaft und Mitmenschlichkeit folgt. Und zwar in Bezug auf die, die dort Hilfe suchen, genauso wie auf die, die sie geben. Ein humanistisches, hochwertiges Gesundheitssystem, das jederzeit souverän auf eine Erkrankungswelle reagieren kann – weil es über geschultes, gut bezahltes und empathisches Personal verfügt.
Das jedenfalls möchte ich unserer Welt gern mitteilen: Meinetwegen müssen nicht die Theater geschlossen und die Gottesdienste abgesagt werden, müssen meine Freunde nicht um ihre wirtschaftliche Existenz bangen, auf dass ich nicht an einer Lungenentzündung sterbe. Meinetwegen sollten mir nur, zu allen Zeiten, der geschützte Freiraum, die unbedingte Partnerschaft, freundliche Rücksicht und Aufmerksamkeit zugestanden werden, die ich brauche, um trotz Schwäche und Unsicherheit ein erfülltes Leben zu führen.
Hier findest du die beiden anderen aktuellen Dailys:
Titelbild: Eric Antunes