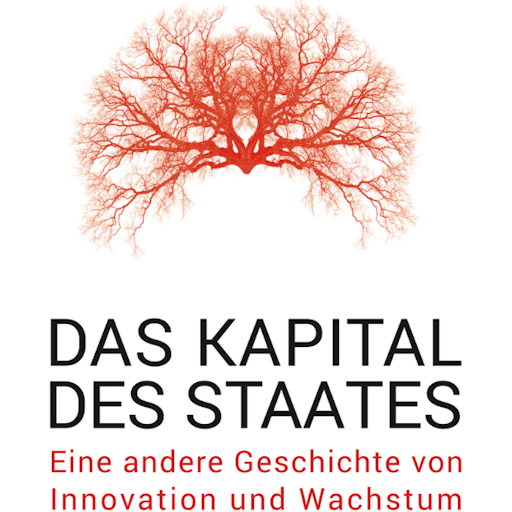Warum Elon Musk verbeamtet werden sollte
Die Wirtschaft steckt voller Ideen, die Zukunft ist zum Greifen nah. Wäre da nicht der träge Staat … Stimmt nicht! Ohne den Staat wäre dein Smartphone ziemlich dumm.

An echten Innovationen wird in Garagen und dunklen Kellerräumen gebastelt. Steve Jobs, Marc Zuckerberg und Elon Musk stehen sinnbildlich für die Innovations-Helden der Moderne. Sie sind die Herrscher des Silicon Valley und erschaffen unsere Zukunft: iPhone, Facebook und selbstfahrende E-Autos. Privat-Unternehmen haben die Ideen, der Fiskus kassiert ab. Zumindest ist das das Bild, das uns gern vermittelt wird.
Diese Heldengeschichte ist jedoch nicht vollständig. Der Held im Hintergrund ist einer, der (im Prinzip) unser aller Interessen vertreten sollte: der Staat.
Manche Wirtschaftswissenschaftler behaupten sogar, der Staat sei der größte Treiber für Innovationen. Die Idee dahinter klingt einfach: Wenn wir ein klares Ziel setzen, kann der Staat mehr als nur »Märkte reparieren« – er kann auch neue Märkte schaffen und gesellschaftliche Probleme lösen. Egal, ob Luftfahrt oder
Zeit, um die Rolle des Staates neu zu denken.
Der Staat hat dein Telefon »smart« gemacht
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Mariana Mazzucato macht genau das.

Das Team von Apple hat diese und andere Technologien optimiert und in einem Gerät kombiniert. Auch das ist innovativ. Innovative Endprodukte wie das iPhone fallen nicht vom Himmel, sie bauen in der Regel auf bereits vorhandener Vorarbeit auf.
Mit ihrer These des Staates als Innovator wurde Mariana Mazzucato zum intellektuellen Star. Die Professorin mit italienischen Wurzeln lehrt eigentlich an der englischen Universität von Sussex, die letzten Jahre wurden für sie aber zu einer Odyssee, um das Heldenbild der Gates, Jobs und Zuckerbergs um eine Facette zu erweitern: die des Staates. Mittlerweile berät sie Regierungen und Parteien auf der ganzen Welt. 2016 war sie auch mehrmals im deutschsprachigen Raum zu Besuch und
Deutschland erntet vor allem Lob für seine Innovations-Arbeit der letzten Jahre: Das Programm zur Energiewende, bei dem die langfristige Vision einer CO2-neutralen Energiegewinnung maßgeblich ist; 
Das sind 2 Aspekte, die auf europäischer Ebene
Klar ist also: Innovationen sind wichtig und werden nicht nur durch ambitionierte Bastler in Vorstadt-Garagen, sondern auch durch Behörden-Tüftler vorangetrieben. Bevor wir über Chancen und Risiken neuer Innovationen sprechen, lohnt es sich, kurz innezuhalten und zu fragen: Was eigentlich ist eine Innovation?
Was »innovieren« wir da eigentlich?
Innovation: (Wirtschaft) Realisierung einer neuartigen, fortschrittlichen Lösung für ein bestimmtes Problem, besonders die Einführung eines neuen Produkts oder die Anwendung eines neuen Verfahrens
Ziemlich vage,
Wie bei solchen Trendwörtern üblich, ist jedoch unklar, was genau »Anwendung« oder »Anwendbarkeit« in diesem Zusammenhang bedeutet. Vielleicht etwas, das verkauft werden kann. Oder Ideen, die der Gesellschaft dienen. Um mich nicht in Begriffserklärungen zu verlieren, nutze ich hier eine weitestgehend neutrale Definition: Eine Innovation ist eine Verbesserung eines Produkts, eines Prozesses oder einer Technologie. Das heißt nicht, dass die Frage nach der Bedeutung des Wortes Innovation abschließend geklärt ist; es ist gut und wichtig, weiter darüber zu sprechen, was genau eine Innovation ausmacht.
Bevölkerungswachstum oder Innovation für wirtschaftliches Wachstum?
Fest steht, dass Innovation neben Bevölkerungswachstum die einzige Möglichkeit für
Diese scheinbar harmlose Aussage offenbart bereits die erste Zwickmühle: Angenommen, Innovationen sorgen nicht für neue Märkte, sondern schrauben nur an der Produktivität. Dann können sie sich auf Dauer stark auf den Arbeitsmarkt auswirken, weil Arbeitsplätze wegfallen. Diese Weltsicht ist jedoch zu einfach. Wir müssen nur an die digitale Revolution denken, die zahlreiche neue Jobs hervorgebracht hat.
Es ist also nicht verwunderlich, dass Innovation in der ökonomischen Forschung eine
Eine weitere Zutat auf der Input-Seite der »Black Box« ist Geduld. Nicht gerade eine Eigenschaft, durch die sich heutige Finanzmärkte und politische Strukturen auszeichnen. Das häufig genannte Gegenargument für langfristige Investitionen lautet: zu hohes Risiko. Genau diese Argumentation bringt uns zurück zur Rolle des Staates. Er ist in der Lage, große, unsichere Investitionen zu realisieren. Ohne zu wissen, was am Ende der »Black Box« herauskommt, spielt er als Risikonehmer eine zentrale Rolle.

Der Staat als Risikoträger
Auch heute sehen viele einflussreiche Politiker und Wirtschaftswissenschaftler den Staat noch immer als einen Spieler, der so wenig wie möglich in den »Markt« eintreten sollte. Vor allem dann, wenn es um Innovationen geht. Die Aufgaben des Staates sollten sein: Menschen ausbilden und ein wenig Grundlagenforschung bezahlen. Das würde reichen. Allerdings lässt sich Grundlagenforschung nur schwer von Innovation trennen. Gibt es eine Grenze, an der das eine aufhört und das andere anfängt?
Fast 90% preisgekrönter Innovationen gehen teilweise oder vollständig auf Staatskosten
Wie das Beispiel des iPhones eindrücklich zeigt, entspricht diese Vorstellung nicht der Realität: Der Staat hat die einzelnen technologischen Innovationen finanziert und vorangetrieben. In Zahlen bedeutet das:
Schauen wir kurz auf die USA, die häufig als Paradebeispiel einer innovativen Wirtschaft dienen. In der die Elons, Steves und
Ein Beispiel: Die USA investieren jährlich ca. 30 Milliarden US-Dollar in medizinische Forschung an den
Wir, die Steuerzahler, tragen die größeren finanziellen Risiken. Der Staat bildet uns aus. Ohne Garantie dafür, dass wir unsere Bildung nutzen werden. Der Staat investiert in Forschung. Ohne sicher sein zu können, dass diese zu neuen Einsichten führt, die sich auszahlen. Der Staat investiert außerdem in anwendbare Technologien und Firmen. Ohne wissen zu können, ob diese irgendwann Marktreife erlangen.
Woher kommt unser Bild vom Staat als »jemandem, der sich besser nicht einmischen sollte«?

»Fauler Beamter« gegen »heldenhaften Unternehmer«?
Das Bild vom passiven Staat hat natürlich viel mit der Idee zu tun, dass »der Markt« fast alle Herausforderungen selbst lösen könne. 2 häufig genannte Einwände gegen den Staat als »Innovator« stehen exemplarisch für diese Idee:
- Der Staat kann keine »Gewinner« auswählen
Es stimmt, nicht alle staatlich geförderten Projekte sind erfolgreich, egal, ob in Form von Subventionen oder durch direkt finanzierte Forschungs- und Entwicklungs-Projekte. Als erfolgloses Beispiel wird gern die Concorde genannt. Für die jüngeren Leser ist vielleicht die gescheiterte Solarfirma Solyndra eher ein Begriff. Dabei gingen 500 Millionen US-Dollar aus Staatskassen verloren. Beide Projekte sind markttechnisch gesehen ein Misserfolg. Allerdings gilt generell: Auf jede erfolgreiche Innovation kommen viele Misserfolge. Neben Solyndra hat der amerikanische Staat auch in erfolgreichere Innovationen im Bereich sauberer Energie investiert: Beispielsweise
Ein globaler Blick offenbart auch, dass zahlreiche Länder bestimmte Industrien nur mit großer Staatsbeteiligung aufbauen konnten; nicht selten werden mit staatlicher Hilfe einzelne Unternehmen zu Marktführern. Vor allem asiatische Länder sind dabei besonders erfolgreich. Toyota verdankt seine Existenz riesigen staatlichen Investitionen.
Zwischen-Fazit: Auch wenn der Staat nicht immer über Erfolg und Misserfolg privatwirtschaftlicher Unternehmen entscheidet, hat er durchaus die Möglichkeit mitzubestimmen, wer gewinnt – und wer verliert. - Zuviel Bürokratie: Geld vom Staat fehlt der »Überlebensdrang«
Wer kennt sie nicht, die Witze über Beamte, die mit Stechuhr auf den Feierabend um 15 Uhr »hinarbeiten«. Das Bild vom trägen Staatsapparat stimmt sicher teilweise. Ein ausgeprägter Hang zum Bürokratischen kann dafür sorgen, dass Entscheidungen im Schneckentempo gefällt werden.
Der Zyniker mag denken: »Es ist genug Geld in den Töpfen. Druck gibt es kaum, also machen wir einfach irgendwas.« Geld ist jedoch nicht alles und nicht der einzige Antrieb menschlichen Handelns. Im Gegenteil: Für die meisten Menschen sind es
Ohne Zweifel helfen klare Ziele und Fristen, so wie wir sie von privatwirtschaftlichen Unternehmen kennen. Vielleicht würde auch eine Werbekampagne für den Staat als »Prestige-Arbeitgeber mit hochmotivierten Arbeitnehmern« helfen. Utopisch? Sagen wir mal so: Ein Bild vom Staat als verstaubtem Arbeitgeber mit über-bürokratischen Abläufen, der »dem Markt« nur ein wenig beisteuert, hilft hier sicher nicht.
Viele Wissenschaftler, die für öffentliche Institutionen und Forschungseinrichtungen arbeiten, sind hochmotiviert. Nicht nur, wenn es um Forschung geht, sondern auch, wenn es darum geht,
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt?
Im Zuge der letzten Finanzkrise und der damit einhergehenden Rettung von Banken und Versicherungen wunderten sich viele Menschen darüber, warum Gewinne im Finanz-Sektor privatisiert, die Risiken jedoch »sozialisiert« wurden. Schließlich wurde die Rettung der angeschlagenen Institute mit Steuergeldern bewerkstelligt. Die bis dato gemachten Gewinne konnten die Banken und Versicherungen verbuchen, weil sie auf volles Risiko gesetzt hatten – ein Risiko, das am Ende der Staat und die Steuerzahler getragen haben.
Steuer-Vermeidung macht aus Investitionen Entwicklungshilfe
Mit Innovationen ist es ähnlich. Der Staat – und damit wir alle – nehmen den Bärenanteil des Risikos bei der Entwicklung von neuen Technologien auf uns. Profitieren wir auch davon? Klar, durch die indirekten Gewinne in Form von Steuereinnahmen? Nicht unbedingt …
Nehmen wir wieder das Beispiel der Firma Apple.
Um Missverständnisse zu vermeiden: Das bedeutet nicht, dass es generell schlecht ist, Technologien zu entwickeln, die später eine globale Anwendung finden. Wenn eine Gesellschaft jedoch Milliarden Euro oder Dollar in Forschungsprojekte investiert, deren Ergebnisse dann von multinationalen Unternehmen in milliardenschwere Gewinne umgewandelt werden, ohne Arbeitsplätze und Steuern im Ursprungsland zu generieren, ist das zumindest bedenklich. Und nicht wirtschaftlich nachhaltig, denn diese Mittel fehlen, um wiederum neue Innovationen anzustoßen.
Doch damit nicht genug …
Innovationen können Gräben zwischen Arm und Reich vertiefen
Reichtum durch Innovationen tendiert dazu, sich anzuhäufen. Das wiederum

Auch dabei spielen Innovationen eine Rolle: Wer viel Geld hat, verfügt über das nötige Budget, um komplexe Innovationen zu finanzieren. Hinzu kommt die Möglichkeit, diese über Patente schützen zu lassen. Die jedoch sind selbst ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite bewegen sie private Investoren dazu, in Unterfangen mit hohen Entwicklungskosten zu investieren. Nur so können sie diese (im Erfolgsfall) zurückverdienen. Auf der anderen Seite helfen sie nicht dabei, den neu generierten Reichtum besser zu verteilen. Investoren erlangen leichter ein Monopol in einem bestimmten Markt. Das Beispiel der Pharmaindustrie bietet sich erneut an:
Wie wird aus einer parasitären Beziehung eine symbiotische?
Natürlich gibt es auch die kleinen Start-ups mit Ideen, die potenziell einen Sprung für die Wirtschaft und die Gesellschaft bedeuten. Häufig werden diese allerdings von größeren Unternehmen aufgekauft. Dort wird dann mit entsprechend größeren finanziellen Mitteln weiterentwickelt. Und wieder kommt es zu einer Anhäufung von Kapital.
Vielleicht ist es an der Zeit darüber nachzudenken, den Staat mehr Patente anmelden zu lassen – gegebenenfalls in Kooperation mit der Privatwirtschaft. Mariana Mazzucato fasst es so zusammen: Es gehe darum, die Beziehung zwischen Staat und Privatwirtschaft von einer parasitären in eine symbiotische zu verwandeln.
So bleibt die Frage: Welche Innovationen wollen wir vorantreiben, als Steuerzahler und als Staat?
Zeit, um größer in die Zukunft zu investieren
Zukunftsprognosen über potenziell erfolgreiche Forschungsprojekte sind müßig. Aktuell wird Erfolg vor allem daran gemessen, wie gut sich eine Innovation verkauft. Hohe Verkaufszahlen geben aber nicht immer Auskunft über die Tauglichkeit oder gar den Nutzen für die Gesellschaft.
»Wir haben beschlossen, in diesem Jahrzehnt zum Mond zu fliegen […]. Nicht weil das einfach ist, sondern weil es herausfordernd ist.« – J.F. Kennedy
Wenn wir als Gesellschaft bestimmte Probleme identifiziert haben, können wir uns gemeinsam mit ihrer Lösung befassen. Dafür bedarf es staatlicher Investitionen, die am Ende vielleicht sogar zur Entwicklung neuer Märkte und dabei auch zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen führen.
Tatsächlich wurde ein solches Programm bereits ins Leben gerufen: Die
Ideen gibt es genug. Wir brauchen nur einen Staat – und Steuerzahler – der es wagt, sich öffentlich dafür einzusetzen. Und so aus der parasitären Beziehung eine symbiotische macht.
Titelbild: Staat und Wirtschaft arbeiten zusammen: Barack Obama zu Besuch bei Elon Musks Raumfahrt-Unternehmen SpaceX
Titelbild: NASA