»Cancel Culture«? Wem der Mund verboten gehört – und wann das Ganze zu weit geht
Die angebliche Meinungsunterdrückung ist eines der liebsten Aufregerthemen der politischen Rechten. Dahinter steckt tatsächlich ein System. Und es gibt ein viel besseres Wort für das eigentliche Problem.
Donald Trump ist freigesprochen. Der US-Senat urteilte im zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen den Ex-Präsidenten, dieser sei der Anstiftung zum Aufruhr
Ein wenig seltsam ist das schon. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist dies sogar die Frage wert: »Donald Trump, ein Opfer der ›Cancel Culture‹?« Auch die Nürnberger Nachrichten titelten dazu in einem Kommentar:
Da ist es also, das trendende politische Schlagwort, das von den USA nach Deutschland geschwappt ist und noch keinen Dudeneintrag hat. Grob lässt es sich mit »Löschkultur« übersetzen. Gemeint ist ein – vor allem digitaler – Boykott gegen Menschen, deren Aussagen unerwünscht sind.
Mit Donald Trumps Twitter-Sperrung ist der Begriff nun so umstritten wie nie zuvor. Auch Journalist:innen – die den Begriff in Texten verwenden und damit dazu beitragen, dass er sich erhält und verbreitet – sind sich nicht einig, worum es sich dabei eigentlich handelt:
Was von beiden ist es nun – oder ist es doch etwas ganz anderes? Eine Spurensuche, die uns auch manches darüber verrät, wie heutzutage Diskussionen geführt werden, wer sie gezielt verzerren will und wie schnell sie aus dem Ruder laufen.
Was wir über »Cancel Culture« wissen
»Cancel Culture« war vor 2020 kaum der Rede wert. Das verrät uns Google Trends in der Übersicht, wann und wie oft weltweit nach dem Begriff gesucht wurde.
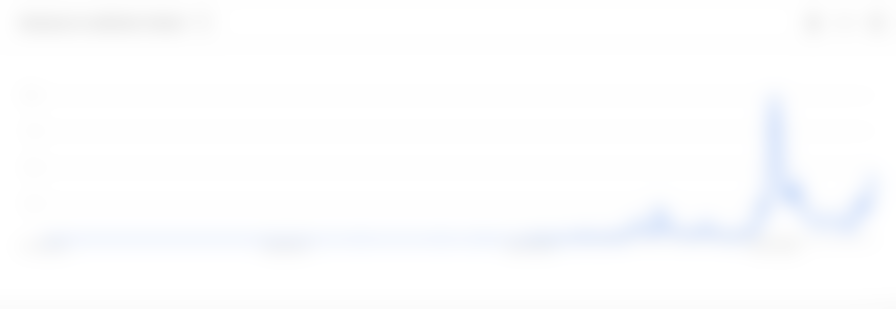
Auffallend häufig und schon vor 2019 findet sich der Begriff im Zusammenhang mit Universitäten, in denen seit Jahren der Streit darum geführt wird, was zur universitären Lehre gehört – und wer seine Perspektiven darlegen sollte.
Sind also ausgerechnet unsere Universitäten, also jene sich selbst regulierenden Institutionen, die sich der Suche nach Wissen und der Vermittlung von umfassender Bildung verschrieben haben, der
Das Ergebnis einer Befragung der renommierten vergleichenden Politikwissenschaftlerin Pippa Norris aus dem Jahr 2020 zeigt, dass viele Akademiker:innen einen zunehmenden politischen Druck verspüren.
Im Jahr 2009 lud die katholische Privatuniversität University of Notre Dame du Lac (in Indiana, USA) den damaligen US-Präsidenten Barack Obama zu einem Vortrag ein, in dessen Rahmen ihm die Ehrendoktorwürde verliehen werden sollte. Daraufhin unterzeichneten 90.000 empörte gläubige US-Bürger:innen, unterstützt von der US-Pro-Life-Bewegung, eine Petition mit der Forderung, Obama auszuladen und die Verleihung abzusagen. Es folgten aufgeregte Meinungsstücke religiös-christlicher Influencer:innen und Blogs, dann Proteste.

Kommt das Szenario bekannt vor?
Es entspricht in der Struktur dem, was viele Menschen heute unter »Cancel Culture« verstehen: Ein öffentliches Forum, eine angeblich kontroverse Person, die kein Rederecht haben sollte, Aufregung, Anfeindung und öffentlicher Druck.
Was wir also festhalten können: Es existiert die Praktik, Personen an Universitäten unter Druck zu setzen, mit dem Ziel, ihre Reichweite einzuschränken (oder als symbolische Handlung gegen ihre politischen Positionen). Nicht nur konservative Positionen, sondern auch (verhältnismäßig) progressive sind das Ziel dieser
Die Grenzen dessen, was ohne Androhung von Repressalien gesagt werden darf, [wurden] immer enger gezogen. Wir zahlen dafür einen hohen Preis, indem Schriftsteller_innen, Künstler_innen und Journalist_innen nichts mehr riskieren, weil sie um ihren Lebensunterhalt fürchten müssen, sobald sie vom Konsens abweichen und nicht mit den Wölfen heulen.
Damit ist der Fall also klar, oder? Nicht so voreilig. Denn das alles sind zwar Indizien für einen zunehmend politisierten und polarisierten Diskurs – aber nicht dafür, was manche gern unter »Cancel Culture« verstehen wollen.
Trumps »Cancel Culture«-Aufschrei liefert Hinweise darauf, was eigentlich dahintersteckt
Bei Donald Trump verhält sich die Sache anders. Der ehemalige US-Präsident wurde nicht auf Twitter von einer Menschenmenge »gecancelt« oder durch Proteste zum Schweigen gebracht. Er wurde von einem privaten Medienunternehmen gesperrt, weil er wiederholt gegen dessen Gemeinschaftsstandards verstieß. So nutzte der Ex-Präsident Twitter schließlich nicht nur als Kommunikationskanal mit seinen Anhänger:innen, sondern auch immer wieder für öffentliche Anfeindungen gegen politische Gegner:innen, unverhohlene Drohungen und am Ende seiner Amtszeit vor allem für haltlose Anschuldigungen rund um die verlorene US-Wahl.
Jede:r andere hätte für dieses Verhalten schon längst Konsequenzen gespürt. Den Beweis trat 2020 ein anonymer Nutzer an und kopierte in einem Experiment in seinen eigenen Twitteraccount den Inhalt der damaligen Tweets von Trump. Das Ergebnis:
Twitters Trumpsperre ist aus anderen Gründen problematisch
Regeln sollten für alle gelten, so weit, so klar. Doch das Problem bei Twitter ist ein anderes: Denn es fehlt an demokratischer Legitimierung für diese Spielregeln. Wie viele soziale Netzwerke stellt Twitter einen Teil der digitalen Infrastruktur, worüber heute kommuniziert wird – handelt aber als Privatunternehmen.
Den Ex-US-Präsidenten trotzdem in den Kontext einer angeblichen »Cancel Culture« zu stellen, ist also mehr als fraglich. Trump muss schlicht nach denselben Spielregeln spielen wie alle anderen auch – es ist eher verwunderlich, dass eine Reaktion so lange gedauert hat. Das hat wenig mit der Debatte an Universitäten, mit Intellektuellen und in sich gefühlt verengenden Diskursräumen zu tun.
Wer dennoch von »Cancel Culture« spricht, verwendet den Begriff hier anders: als strategische Erzählung, die ein bestimmtes Verhalten relativiert, von echten Verfehlungen ablenkt und einen polternden Täter in ein mundtot gemachtes Opfer verwandelt. Und genau das ist für manche der Zweck dahinter.
So profitieren rechte Positionen von »Cancel Culture«-Vorwürfen
Lassen wir Trump hinter uns und sehen uns ein anderes Beispiel genauer an. Im Januar entbrannte ein »Cancel Culture«-Streit um die freie Journalistin und
Das Ergebnis war eine lange und kontroverse Diskussion über Toleranz und Rederechte unter den Anwesenden. Manche empörten sich und trugen ihre Aufregung in die Öffentlichkeit. So gelang es Schunke im Nachgang, die »Cancel Culture« heraufzubeschwören. Dabei half ihr Die Achse des Guten – ein rechter Blog, für den auch Schunke schreibt, mit einem
Den Fall beschäftigte auch Marina Weisband, ehemals Politikerin der Piratenpartei und heute Beteiligungspädagogin und Co-Vorsitzende des SPD-nahen Digitalvereins D64. Sie hat sich intensiv mit den digitalen Strategien der heutigen Rechten beschäftigt und erkennt in Schunkes Fall einiges wieder:
Die Selbsterkenntnis der extremen Rechten ist: Sie hat heute einfach nicht genug Einfluss und gesellschaftlichen Halt, um über demokratische Wege genug Macht zu bekommen.
Dies hätten Vordenker der extremen Rechten, etwa Götz Kubitschek in Deutschland, erkannt und Strategien entwickelt, dennoch ihre Ideen über die Kultur und den Diskurs in die Gesellschaft zu träufeln. »Ihr Ziel ist eine kulturelle Hegemonie«, so Weisband. Der Vorwurf gegenüber einer »Cancel Culture« ist laut Marina Weisband ein Teil dieser Träufelstrategie – und zwar so:
- Personen reklamieren auf diese Weise eine Opferrolle und gewinnen an Glaubwürdigkeit (Menschen finden Opfer sympathischer als Täter:innen).
- Die Behauptung, von einer homogenen Meinungslandschaft ausgeschlossen zu werden, und die damit einhergehende Empörung bescheren Aufmerksamkeit.
- Sie lenken so Aufmerksamkeit auf die generelle Schlagrichtung ihrer Inhalte, aber weg von konkreter Kritik an ihnen.
Einerseits dient diese Verwendung von »Cancel Culture« als Hebel, um unter dem Vorwurf der Unterdrückung ein Gespräch zu erzwingen – wobei die eigenen Positionen verbreitet werden können. Andererseits schützt diese Verwendung von »Cancel Culture« als Verteidigungsstrategie gegen jedwede Kritik und steht damit in direkter Nähe zu populistischen Formulierungen wie »Gesinnungsdiktatur«, »Kulturkampf« oder »Lügenpresse«. Nicht umsonst reit sich »Cancel Culture« längst in die liebsten Begriffe neurechter Parteien ein, die das angebliche Unterdrücktsein als Markenkern entdeckt haben.
»Cancel Culture«-Vorwurf als Verteidigungsstategie
Da der Begriff selbst umstritten ist und nicht klar definiert wird, sind die Anwendungsmöglichkeiten endlos. Hier nur ein besonders schräges Beispiel aus jüngster Vergangenheit: Das Editorial Board des US-amerikanischen Wall Street Journal beantwortete die interne Bitte von 300 Mitarbeiter:innen darum, Meinungsbeiträge externer Kolumnist:innen und Nachrichten stärker voneinander zu trennen, mit einem Antwortschreiben unter der Überschrift »Diese Seiten werden nicht unter dem Druck der Cancel Culture verwelken«.
Darüber beschweren sie sich dann ausgerechnet öffentlich im Netz und generieren so mitunter sehr viel Aufmerksamkeit. Allein das zeigt, dass nicht irgendwelche »linken Meinungswächter:innen« diktieren, was in der Öffentlichkeit gesagt wird, und es nach Belieben ächten, sondern solche Behauptungen nur Rhetorik im Ringen um eine Deutungshoheit und mehr Einfluss sind.
Vor allem im Netz gilt, wie Marina Weisband bekräftigt: »Am Ende bestimmt nur der Diskurs über den Diskurs – also die Gesellschaft und damit wir alle. Und wenn bei uns die Alarmglocken läuten und wir etwas moralisch falsch finden, dann sollte man auch genau hinsehen.«
Und – um das hinzuzufügen: Wir sollten uns eben nicht von tönenden Debatten um die Grenzen des Sagbaren ablenken lassen. Denn dann entdecken wir vielleicht Positionen und Strömungen, die auch in einer offenen Gesellschaft, die vom Austausch der Meinungen lebt, keinen Platz haben dürfen – weil sie im Kern demokratie- oder menschenfeindlich sind. Denn dass diese Feind:innen der offenen Gesellschaft und Toleranz in Deutschland aktiv wirken und dass sie gewaltbereit sind, sollte in der Woche, in der sich der rassistische Terroranschlag von Hanau jährt, nicht extra zu betonen sein.
Genau gegen solche demokratiefeindlichen Strömungen ist das Ausschließen zentraler Accounts, worüber sie zu Hass und Gewalt aufrufen, ein sinnvolles Mittel. Die gute Nachricht: Es wirkt.
Und was macht das mit unserer »Cancel Culture«? Gibt es das jetzt doch nicht, außer in den Fällen des strategischen »Deplatforming« gegen extremistische Hetzer? Nicht so voreilig. Denn es gibt zwar erdrückende Anhaltspunkte dafür, dass vor allem die politische Rechte »Cancel Culture« als Begriff umdeutet und für ihre Zwecke verwendet – das heißt aber nicht, dass im Netz alles fair und flauschig zugeht.
Wo Kritik aufhört und etwas anderes beginnt
Das Internet als digitaler Raum ist vor allem davon geprägt, dass Menschen »heftig und emotional« reagieren. Das schreibt Bernhard Pörksen, Medienprofessor an der Universität Tübingen, in seinem Buch
»Triggern« als Geschäftsmodell?
In Zeiten, in denen im Internet Likes und Klicks bares Geld bedeuten können, kann es sich tatsächlich lohnen, moralische Grenzen zu überschreiten:
Schritt 1: Bewusst provozieren. Vor allem mit Themen linker Politik.
Schritt 2: Die erwartbaren Reaktionen mit uneinsichtigen Kommentaren anheizen.
Schritt 3: Sich entweder entschuldigen (Sympathie des bürgerlichen Lagers) oder »Cancel Culture« reklamieren (Sympathie von rechts).
Auch Marina Weisband spürt diese Gereiztheit: »Sicherlich gibt es das im Netz«, gibt sie im Gespräch mit mir zu, sieht aber auch Ursachen dafür: »Wir sollten uns auch fragen, woher diese Überreiztheit denn kommt. Wenn im deutschen Fernsehen etwa eine blonde Frau über den Zentralrat der Sinti und Roma herzieht – dann ist das ein in Deutschland noch zulässiger Meinungskorridor, in dem Menschen existieren müssen, die Rassismus und Antiziganismus erfahren haben. […] Es gibt eben immer noch tiefe Ungerechtigkeiten, auch in unserer Gesellschaft. Ich kann also absolut verstehen, warum manche Menschen zutiefst wütend
Diese Wut in Kritik, Protest und Petitionen zu verwandeln, ist legitim und gute demokratische Praxis – vor allem für marginalisierte Gruppen und mit gesellschaftlichen Anfeindungen konfrontierte Minderheiten.
Doch manchmal bildet sich entlang der »Erregungsmuster« eine Eigendynamik, deren Auswüchse keine Relation mehr zur kritisierten Handlung erkennen lassen – und Menschen ernsthaft schaden können.
Der wohl bestdokumentierte Fall der vergangenen Jahre traf eine progressive Youtuberin. Natalie Wynn (die auf dem Kanal ContraPoints veröffentlicht) hatte in einem ihrer Videos einen US-amerikanischen Pornodarsteller ein kurzes Zitat einsprechen lassen, dessen Aussage in der Vergangenheit von der Transcommunity als transfeindlich aufgefasst wurde. Daraufhin bildete sich im Internet ein Shitstorm, bei dem manche der empörten Nutzer:innen so weit gingen, Kolleg:innen und Kooperationspartner:innen von Wynn unter Druck zu setzen, sich von ihr loszusagen und sie selbst (inklusive ihrer Angehörigen und Freunde) tagelang mit gezielt verletzenden Nachrichten zu überziehen.
Die Ironie des Ganzen: Natalie Wynn ist selbst transsexuell und gilt als eine der medialen Vorreiter:innen der US-amerikanischen Transsexuellenszene.
Ihre zentrale Erkenntnis: Was ihr widerfahren ist, sei etwas anderes als nur harsche Kritik. Denn diese sollte – und das ist eine wichtige Unterscheidung! – stets gegen Argumente und Handlungen gerichtet sein und weder gezielt verletzen noch die Person und ihr Umfeld fixieren. Was sie erlebt habe, bezeichnet sie als beängstigende »call-out vigilante justice«, frei übersetzt: »digitale Selbstjustiz«.
Und das ist ein viel treffenderer Begriff als die vagen Beschwörungen irgendeiner »Cancel Culture«.
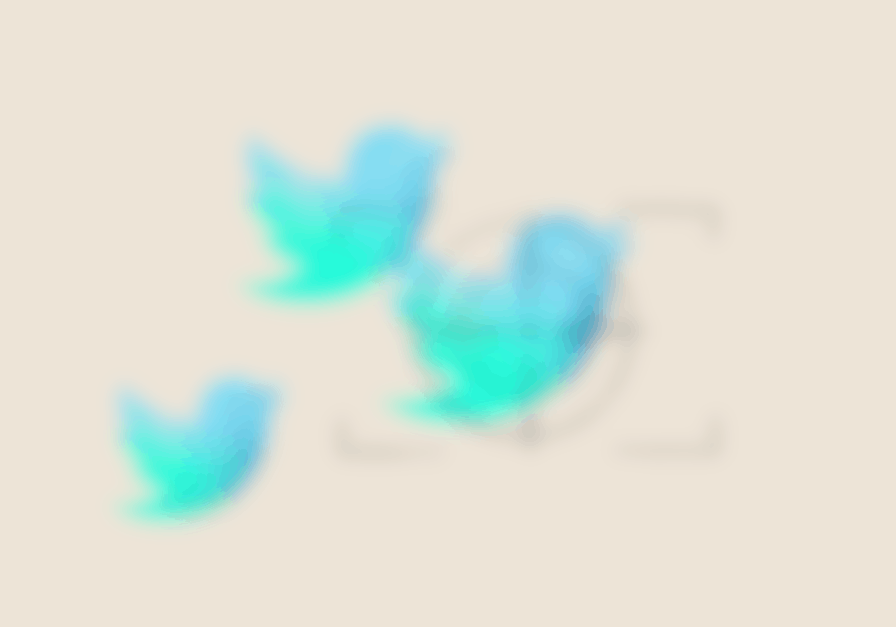
Wynn ist alles andere als allein. Was auffällt: Besonders politisch linke Frauen werden das Ziel solcher Kampagnen. Die österreichische Rechsextremismusexpertin und Politikwissenschaftlerin Natascha Strobl hat ähnliches erlebt. Sie hatte 2020 an einer Recherche zu einem mutmaßlich rechtsextremen Oberstleutnant bei der Bundeswehr für das NDR-Magazin Panorama teilgenommen und wurde dort zitiert.
Es wird spürbar rauer im Netz.
Solche Attacken sind nicht zu entschuldigen. Erregungsmuster sind kein Freibrief für menschliche Niedertracht. Und kein noch so heiß umkämpftes Streitthema gibt Individuen oder einer Gruppe das Recht zur digitalen Selbstjustiz – gegen niemanden. Denn auch das ist nur eine gelebte Form von Intoleranz. Und darüber hinaus liefert sie denjenigen, die »Cancel Culture« als Kampfbegriff führen und damit Politik betreiben wollen, Munition auf dem Silbertablett.
Das Ziel, andere und ihr Umfeld emotional zu verletzen und um ihre Existenz zu bringen, darf kein Trend im Netz werden und kann in einem demokratischen Diskurs nicht toleriert werden.
Doch die behutsamen Ratschläge eines Bernhard Pörksen, »Zuhören lernen«, »Wertschätzungsbrücken bauen«, greifen hier längst nicht mehr. Statt Dialogangeboten sollten wir alle hier eine Grenze ziehen und diese entschieden verteidigen.
Mit Illustrationen von Mirella Kahnert für Perspective Daily





