Deine Krankenversicherung wird bald teurer. Sollten wir jetzt die Private abschaffen?
Das Gesundheitswesen steht vor einer riesigen Finanzierungslücke. Karl Lauterbach hat sie vorerst gestopft – indem er den Großteil der Bürger:innen im kommenden Jahr zur Kasse bittet. Doch das müsste nicht sein, wenn er die Kosten endlich fairer verteilen würde.
Es gibt Momente als Journalist, in denen die eigene Arbeit von der Realität überrollt wird. Ich steckte gerade mitten in der Recherche zur privaten Krankenversicherung, als sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vor die Kameras stellte und schlechte Nachrichten
Die Bundesregierung hat die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen in einem sehr schwierigen Zustand vorgefunden. Wir kämpfen mit einem historischen Defizit von 17 Milliarden Euro.
Lauterbach habe dieses Defizit im Wesentlichen von seinem Vorgänger Jens Spahn geerbt, größer geworden sei es durch seine Politik nicht. Tatsächlich klaffte schon 2021, im zweiten Jahr der Pandemie, eine Lücke von 14 Milliarden Euro. Die wurden damals mit einem Steuerzuschuss aus der Staatskasse gestopft.
Dazu ist der heutige Finanzminister Christian Lindner (FDP) zwar noch einmal übergangsweise bereit. 2023 aber, wenn die selbstverordnete Schuldenbremse wieder greifen soll und der Staat daher kaum noch Kredite aufnehmen kann,
Als Lösung will Gesundheitsminister Lauterbach nach eigener Aussage die Einnahmen für die gesetzliche Krankenversicherung steigern.
Und da komme ich ins Spiel. Und du auch – jedenfalls sofern du zu der großen Mehrheit der Bevölkerung gehörst, die gesetzlich versichert ist und Beiträge zahlt. Das sind
Was in wirtschaftlich »normalen« Zeiten vielleicht noch zu verschmerzen wäre, wirkt in der aktuellen Situation ungleich schwerer. Ist es angesichts der steigenden Preise für Strom, Gas und Lebensmittel wirklich alternativlos, den Beitragssatz für alle gesetzlich Versicherten zu erhöhen und Millionen von Bürger:innen
Nein, ist es nicht. Und das weiß Herr Lauterbach auch.
Er verrät in seinem Pressestatement in einem Nebensatz sogar selbst, wie die Finanzierung des Gesundheitswesens endlich auf eine solide Grundlage gestellt werden könnte. Und zwar ausgerechnet an der Stelle, woran er seine Amtsvorgänger kritisiert. Diese hätten »von Strukturreformen
Er selbst stellt jetzt jedoch auch keine in Aussicht. Dabei wäre es höchste Zeit, unser Gesundheitswesen endlich fair zu finanzieren. Das Beste daran: Die meisten von uns könnten durch entschlossene Reformen sogar weniger für die Krankenversicherung zahlen als zuvor.
Warum das dringend nötig ist, wie das funktionieren kann und warum es nicht unbedingt eine gute Idee wäre, die private Krankenversicherung abzuschaffen, erfährst du in diesem Text.
Warum auch eine kleine Erhöhung für viele eine große Belastung ist
Bereits vor Corona, vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und der hohen Inflation gab es in Deutschland Millionen von Menschen, die auf jeden einzelnen Cent angewiesen waren. Die sogenannte Armutsgefährdungsquote steigt hierzulande seit über 15 Jahren langsam, aber beständig an und erreichte im vergangenen Jahr einen Höchststand von 16,6%. Das sind 13,8 Millionen Menschen.

Was viel zu häufig vergessen wird: Auch knapp oberhalb dieser Grenze ist das Leben kein einfaches. Hier beginnt das, was Expert:innen »Prekariat« nennen. Das Geld reicht hier gerade so dafür, die Grundbedürfnisse zu erfüllen, sprich um die Miete zu zahlen und den Kühlschrank halbwegs füllen zu können. Für die Teilnahme am »normalen« gesellschaftlichen Leben reicht das aber bei Weitem nicht. Einen Kaffee in der Stadt trinken, auswärts essen gehen oder ein Kinobesuch zählen in dieser Einkommensgruppe zum seltenen Luxus.
Zu dieser Gruppe zählen noch mal 14% der Bevölkerung. Das bedeutet: Fast jeder dritte Mensch in Deutschland kann seine grundlegendsten
Es sind nicht alle Mittelschicht
Zu sehen ist der finanzielle Status von Personen anteilig an der Gesamtbevölkerung. Berücksichtigt sind hier Einkommen und Vermögen. Aufgrund der verfügbaren Datenlage ist dies der Stand von 2018, die Folgen von Pandemie und Inflation sind also noch nicht berücksichtigt.
»Im Moment kommt einfach vieles zusammen«, sagt Verena Bentele, Präsidentin vom Sozialverband VdK, dem größten Sozialverband Deutschlands. »Wir haben seit über 2 Jahren Pandemie, die Menschen mit kleinen Einkommen und Renten durch zusätzliche Kosten für Masken und Selbsttests belastet. Diese vergleichsweise geringen Mehrkosten treffen diese Gruppe schon hart. Dazu kommen jetzt noch die sprunghaft steigenden Energiekosten und die allgemeine Inflation«,

Wer über ein hohes Einkommen verfüge, der bemerke die zusätzlich anlaufenden Kosten erst jetzt allmählich. »Diejenigen aber, die monatlich mit einem sehr geringen Einkommen und ohne Ersparnisse zurechtkommen müssen, schmerzt jeder einzelne Euro, der noch zusätzlich obendrauf kommt«, betont Bentele.
Klar sei auf der anderen Seite aber auch, dass der Finanzierungsdruck im Gesundheitswesen zum Handeln zwinge. »Das stellen wir beim VdK gar nicht in Abrede, aber bevor die Beiträge für alle steigen, müssen erst einmal andere Maßnahmen ausgereizt sein.«
Reden wir über faire Lastenteilung: Warum wird die Altenpflegerin stärker belastet als der Manager?
Es gibt Begriffe, die derart technisch klingen, dass es nicht verwunderlich ist, dass sie nicht öffentlich diskutiert werden. »Beitragsbemessungsgrenze« ist so ein Begriff. Doch was trocken klingt, hat einen immensen Einfluss auf die faire Finanzierung unseres Gesundheitswesens.
Was zu wenige wissen: Wer im Monat mehr als 4.837 Euro verdient, muss keine zusätzlichen Beiträge zur Krankenversicherung auf das Geld zahlen, das diese Grenze überschreitet. Jeder Euro darüber hinaus ist beitragsfrei; der maximale Beitrag nach oben hin gedeckelt.
Ein Rechenbeispiel:
Das bedeutet auch, dass auf der anderen
»Die Politik könnte die Beitragsbemessungsgrenze relativ einfach erhöhen, um die höheren Einkommen stärker miteinzubeziehen«, fordert Verena Bentele vom Sozialverband VdK. Für diesen Schritt sprechen sich
Wie sehr der allgemeine Beitragssatz auf diese Weise sogar sinken könnte, hat der Gesundheitsökonom Heinz Rothgang zusammen mit Dominik Domhoff in einem wissenschaftlichen Gutachten im Jahr 2021 errechnet. Rothgang leitet die Abteilung für Gesundheit, Pflege und Alterssicherung am Socium Forschungszentrum
Das Ergebnis ihrer Berechnungen: Würde die Beitragsbemessungsgrenze auf knapp 7.000 Euro im Monat erhöht werden, so könnte sich der Beitragssatz für alle um 0,8 Prozentpunkte verringern. Und 7.000 Euro ist nicht aus der Luft gegriffen, das ist die Grenze, die für Arbeitslosen- und Rentenversicherung bereits jetzt gilt. Wenn die Grenze ganz wegfallen würde, wären es sogar 1,5 Prozentpunkte, um die der Krankenversicherungsbeitrag sinken würde.
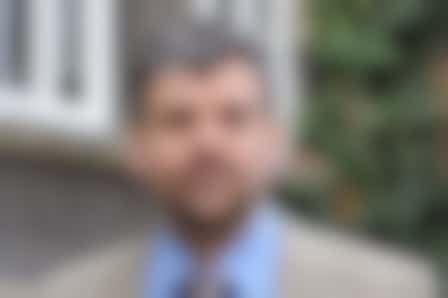
Die Beitragsbemessungsgrenze angesichts der Ergebnisse der Berechnungen ganz abzuschaffen, erscheint vielen angesichts der Zahlen verlockend. Doch ist es kaum wahrscheinlich, dass auf diese Weise das eigentliche Ziel erreicht wird: Besserverdienende stärker in das Solidarsystem einzubinden.
Denn diese können sich jederzeit aus dem Solidarsystem der Krankenkassen herausziehen, indem sie einfach in die private Krankenkasse wechseln. Was also tun?
Die private Krankenversicherung gehört abgeschafft – oder?
»Wenn die Politik die Beitragsbemessungsgrenze an das Niveau der Arbeitslosen- und Rentenversicherung angleicht, würden bereits sehr große Teile der höheren Einkommen berücksichtigt. Schafft man sie aber ganz ab, muss bedacht werden, dass dann sehr wahrscheinlich genau diese Einkommensgruppe aus der gesetzlichen Krankenversicherung austritt und in die private wechselt«, sagt Heinz Rothgang.
Allein die Existenz der privaten Krankenversicherung führe also dazu, dass sich ausgerechnet die finanziell »starken Schultern« dem Solidarsystem der allgemeinen Gesundheitsversorgung entziehen. »Wir haben es hier mit einer doppelten Ungerechtigkeit zu tun: Privatversicherte sind im Schnitt nicht nur einkommensstärker, sondern auch gesünder und jünger als gesetzlich Versicherte. Bei gleicher Behandlung und gleichem Vergütungssystem verursachen sie daher auch noch weniger Kosten«, erklärt Rothgang. So müsse die gesetzliche Krankenkasse die höheren Ausgaben für den weniger gesunden Teil der Bevölkerung allein tragen, während sich die Gutverdienenden dem System entzögen.
Kann die Lösung also nur sein, die private Krankenversicherung ganz abzuschaffen und dem Nebeneinander von gesetzlicher und privater Versicherung (das es so übrigens nur in Deutschland gibt) ein Ende zu setzen?
Diese Idee ist im linken politischen Lager eine populäre Forderung. Heinz Rothgang hat aber so seine Zweifel:
Die private Krankenversicherung in ihrem Bestand anzugreifen bringt große rechtliche Probleme mit sich. Sicher könnte man versuchen, sie politisch auszuzehren, indem man ihr den Nachwuchs wegnimmt und keine Neuverträge mehr zulässt. In diesem Moment wäre sie am Ende, weil die Mitglieder altern und die Kosten der Tarife durch die Decke schießen würden. Das Resultat wäre eine Katastrophe für 12% der Bevölkerung und eine Unmenge persönlicher Dramen von Menschen, die sich ihre Versicherung nicht mehr leisten können. Das geht einfach nicht.
Eine Pauschallösung ist das eben nicht. Und das klaffende Loch in der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung behebt es zumindest kurzfristig auch nicht. Doch wie könnte es dann gelingen, die Besserverdienenden fairer an den Gesundheitsausgaben zu beteiligen, ohne zusätzliche Probleme zu schaffen?
Wie Privatversicherte Teil eines solidarischen Systems werden könnten
Heinz Rothgang schlägt ein Instrument vor, das sich inzwischen in der gesetzlichen Krankenversicherung bewährt hat: Den sogenannten Risikostrukturausgleich – wieder so ein sperriges Wort, das hier eine eigentlich gute Idee bezeichnet. Rothgang erklärt: »Mein konstruktiver Vorschlag lautet: Wir schaffen die private Krankenversicherung nicht ab, sondern wir sorgen dafür, dass die Privatversicherten in den gleichen Topf einzahlen wie alle anderen auch.«
Rothgang meint den staatlichen Gesundheitsfonds, der momentan allein für die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung da ist.
Dieses kurze Video fasst die Funktionsweise des Gesundheitsfonds kurz und knapp zusammen:
Im Gesundheitsfonds werden die Beiträge aller gesetzlich Versicherten gesammelt und dann je nach Bedarf an die jeweiligen gesetzlichen Krankenkassen zurückverteilt. »Die Idee ist nun, dass auch die Beiträge der Privatversicherten mit in diesen Topf fließen.
Diese würden sich dann aber nicht mehr nach den von den Versicherern errechneten Tarifen richten, sondern nach dem Einkommen, so wie in der gesetzlichen Krankenversicherung auch.« Anschließend würden die privaten Versicherungsunternehmen wie auch die gesetzlichen Kassen eine bestimmte Zuweisung aus dem Fonds erhalten, die sich nach dem Gesundheitszustand ihrer Versicherten richtet.
Wer wie viel Geld aus dem Topf bekommt, wird dann mittels des Risikostrukturausgleichs ermittelt. Dieser Mechanismus sorgt in der gesetzlichen Krankversicherung schon heute dafür, dass diejenigen Kassen, die ältere und kränkere Mitglieder haben, einen größeren Anteil bekommen als diejenigen, die fittere und gesündere Menschen versichern. In diesen würden dann auch die privaten Krankenversicherungen einbezogen, sodass sich deren Mitglieder dann auch solidarisch an der Finanzierung der Gesundheitsversorgung aller beteiligen würden.
Wenn du im Detail erfahren willst, wie der Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen Krankenversicherung funktioniert und warum er so wichtig ist, liest du in unserem vorangegangenen Text aus unserer Serie zum Gesundheitswesen:
Privatversicherte sind nicht automatisch besser dran
Dass sich die Beiträge im von Heinz Rothgang vorgeschlagenen Modell auch für Privatversicherte nach dem Einkommen richten, dürfte sogar viele von ihren Mitgliedern selbst helfen. Denn unter ihnen gibt es auch Menschen, die liebend gerne in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln würden – es aber nach den Regeln des jetzigen Systems nicht dürfen.
Verena Bentele vom Sozialverband VdK berichtet, wie so etwas zustande kommt: »Mehr und mehr Privatversicherte wenden sich hilfesuchend an unseren Verband, weil sie die eigenen Beiträge nicht mehr bezahlen können. Das betrifft vor allem Selbstständige, die mit Einkommenseinbußen durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie kämpfen oder durch eine Infektion selbst anhaltende
Auch unabhängig von Corona können die Beiträge zur Privaten durch eine negative Entwicklung des Gesundheitszustandes schnell deutlich steigen. Doch wer die Altersgrenze von 55 Jahren überschreitet, darf von Gesetzes wegen nicht mehr in die
Eine Versicherung, in die auch Beamte endlich einzahlen (dürfen)
Sofort abschaffen will aber auch der Sozialverband VdK die private Krankenversicherung nicht – zumindest nicht in einer politischen Hauruck-Aktion: »Es muss das Ziel sein, dass wir eine einheitliche, solidarische Krankenversicherung schaffen, in die wirklich alle einzahlen. Dass das ein groß und langfristig angelegtes Projekt sein muss, liegt in der Natur der Sache«, betont Verena Bentele.
Klar ist für sie und ihren Verband: So wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. »Es ist ein Widerspruch in sich, dass wir ein Solidarsystem haben, aus dem sich ausgerechnet die Gutverdienenden und Politiker und Beamte als Vertreter des Staates herausziehen können.«

Das machen die meisten übrigens nicht aus individuellem Antrieb, sondern weil das System einfach so gebaut ist, dass eine freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenkasse für sie schlicht unattraktiv ist. Natürlich könnten sich Beamt:innen und auch Selbstständige freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichern, doch das müssten sie sich auch leisten können – und wollen.
In diesem Fall müssten sie nämlich den doppelten prozentualen Beitrag zur gesetzlichen Versicherung tragen, sprich bald die vollen 16,2% statt »nur« 8,1%. Selbstständige haben keinen Arbeitgeber, der die eine Hälfte übernimmt, und der Arbeitgeber von Beamt:innen – der Staat – zahlt die zweite Hälfte schlicht nicht. Dieser historisch gewachsene Fehler im System müsste im Zuge einer echten Reform behoben werden.
Einer Reform, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach sie sich von seinen Vorgänger:innen gewünscht hätte – für die er aber offenbar auch selbst nicht ins Risiko geht. Statt die lange überfällige Strukturreform nun endlich anzugehen, stellt er sich in die Tradition derer, die er selbst kritisiert. Und das, obwohl er all die Jahre vor seiner Zeit als Minister selbst für eine Bürgerversicherung
Dass er dieses Vorhaben nicht ohne Weiteres in einer Regierungskoalition mit der FDP würde umsetzen können, war von vornherein klar. Das ist das Schicksal von Koalitionsregierungen. Dass es aber offenkundig auch an Entschlossenheit dafür fehlt, in Zeiten der Krise politische Mehrheiten für Schritte in Richtung einer gerechteren Krankenversicherung zu organisieren, ist unverständlich.
Zumal die Unterstützung
Ein Argument, mit dem Herr Lauterbach doch eigentlich auch bei Herrn Lindner punkten könnte.
Mit Illustrationen von Frauke Berger für Perspective Daily


