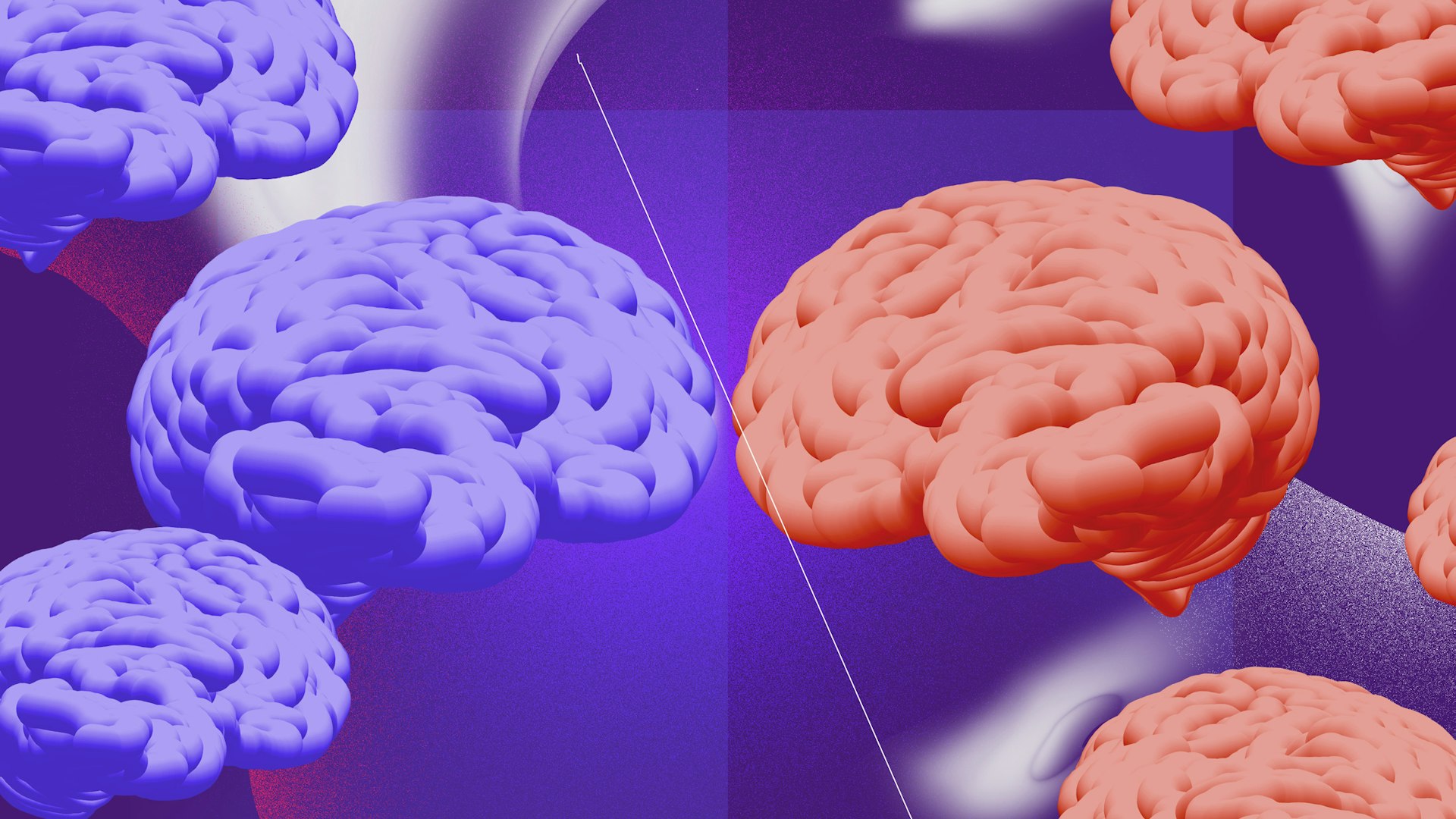So wenig braucht es, damit uns die Anderen egal sind
Ja, auch dir! Wer die Anderen sind, entscheidest du in Sekundenschnelle. Und behältst dein Mitgefühl häufig für dich – oder richtest sogar großen Schaden an.
Zugunglück in Indien, 143 Passagiere sterben. Darunter ein deutsches Ehepaar, das anlässlich seiner Silberhochzeit eine Rundreise durch Asien gemacht hat. Die Story bestimmt die Schlagzeilen. Die trauernden Kinder des Ehepaars erzählen vor laufender Kamera vom Lebenstraum der Eltern, durch Indien zu reisen.
Die übrigen 141 Toten in Indien ohne Namen und Gesicht – und ohne deutschen Pass – sind lediglich eine Statistik. Ihre Geschichte interessiert uns nicht, wir fühlen nicht mit den Hinterbliebenen.
Flugzeugabsturz in Thailand, 98 Tote, darunter kein Deutscher. Das Unglück ist deutschen Medien nur eine kurze Meldung wert, während es in Großbritannien die Titelseiten bestimmt: Zu den Toten gehört eine englische Schulklasse mit 17 Schülern und 2 Lehrern.
»Wenn ich die Masse anschaue, werde ich niemals handeln. Wenn ich den einen anschaue, schon.« – Mutter Teresa
Es ist gut, dass wir
In Sekundenschnelle entscheidet unser Gehirn, wer unser Mitgefühl verdient und wer nicht. Wenn manche Politiker zunehmend in die Kerbe des Nationalismus schlagen und damit definieren,
Nationalismus beginnt beim Fußball
Solche Aussagen machen eines klar: Sie ziehen eine klare Linie, die im konkreten Fall ein paar Tausend Kilometer lang ist und mit einer Betonmauer gezogen wird und im allgemeinen Fall zwischen
Wie stark dieser Effekt ist, lässt sich anschaulich an einem sehr ausgeprägten Gruppenphänomen zeigen: Fußball.
Nein, in den meisten Fällen nicht. Trägt der stolpernde Statist der Wissenschaftler jedoch ein Manchester-Trikot, hilft ihm bald jemand auf.
Klar, Fußballfans – egal ob Liverpool, BVB, Schalke oder Bayern München – definieren sich darüber, zu einer Gruppe zu gehören. Wie schnell wir Gruppen formen, dabei willkürlich Menschen bevorzugen und andere vernachlässigen, hat allerdings nicht zwangsläufig etwas mit deren Trikotfarbe zu tun.
Gruppen funktionieren bereits über scheinbar belanglose Ähnlichkeiten, wie etwa einen farbigen Punkt hinter deinem Namen.
Ist eine Gruppe einmal gebildet,
- Wertigkeit: Die eigene Gruppe wird im Vergleich zu anderen Gruppen als höherwertig angesehen.
- Identifikation:
- Verteidigung: Wenn Gruppenmitglieder das Gefühl haben, dass
- Schadenfreude: Scheitert eine andere Gruppe, kommt es zur Schadenfreude auf Gruppenebene. Die ist besonders stark, wenn es um einen Bereich geht, der relevant für die eigene Gruppe ist, und
Empathie ist der Klebstoff menschlichen Zusammenlebens …
Sobald wir Ähnlichkeiten mit anderen definiert haben, fällt es uns leichter, Empathie für sie zu empfinden: Sie sind nicht mehr »die Anderen«, sondern Teil der »In-Group«. Empathie ist also der Klebstoff menschlichen Zusammenlebens.
Wie schnell die Gruppenbildung vonstatten geht, zeigen die erwähnten Verhaltensexperimente. Wie schnell unser Gehirn uns signalisiert »Du gehörst (nicht) dazu«, haben Neurowissenschaftler ebenfalls bereits erforscht. Zum Beispiel, indem sie schauen, wann und wie unser Gehirn auf Menschen unterschiedlicher Hautfarbe reagiert.
Das Gehirn signalisiert, wer dazugehört und wer nicht

Bist du hellhäutig und schaust Bilder von dunkelhäutigen Menschen an,
Kategorisiert wird auch bei der Frage: Wem reichen wir die Hand und wem nicht? Zurück zu Fußballfans und Empathie.
… und Empathie ist gleichzeitig auch Treibstoff gesellschaftlicher Konflikte.
Hat der Dortmund-Fan die Möglichkeit, das Leid des Gegenübers zu mindern, indem er selbst einen halb so starken Elektroschock verabreicht bekommt, überrascht seine Wahl kaum: Handelt es sich dabei um einen weiteren Dortmund-Fan, willigt er eher ein, als wenn er dem Schalke-Fan mit dem schmerzverzerrten Gesicht
»Im Laufe der Geschichte unserer Spezies wurde der Konflikt zwischen Gruppen durch die Kategorisierung unseres sozialen Umfelds in ›wir‹ vs. ›die anderen‹ bestimmt.« – Robert Kurzban, amerikanischer Psychologe
Unser Verhalten und unser Gehirn bestätigen also, dass unsere Empathie vor allem der eigenen Gruppe gilt – gegenüber der »Out-Group« bringen wir im Durchschnitt weniger Mitgefühl auf.
Empathie ist nicht nur Klebstoff menschlichen Zusammenlebens, sondern gleichzeitig auch Treibstoff gesellschaftlicher Konflikte – nämlich immer, wenn die »Out-Group« ins Spiel kommt. Egal wie gern einige Politiker in lautstarken Reden die eigene Gruppe abgrenzen, in der Realität sind wir niemals nur Mitglied einer Gruppe.
Wie viele Gruppen bist du?
Die Liste ließe sich fast beliebig fortführen und macht deutlich: Wir gehören vielen Gruppen an, je nach Situation ist die eine wichtiger als die andere. Sobald wir das Licht der Welt erblicken, gruppieren wir Menschen und entscheiden, wem wir vertrauen oder nicht.
Was sorgt dafür, dass wir unser soziales Umfeld gruppieren – und die eigenen Gruppen gegenüber den anderen bevorzugen? Das, was wir kennen. So bevorzugen Babys Muttersprachler.
Siehst du dich als Erstes als Deutscher, Schweizer, Österreicher, Europäer oder Weltbürger?
Die eigene Sprache ist stärker als das Aussehen: Im Alter von 5 Jahren bevorzugen Kinder Freunde, die die gleiche Sprache sprechen –
Solche Faktoren werden wichtig, wenn es zum Streit oder zum Konflikt kommt. Das ist evolutionär ein altes Prinzip, das bereits Einzeller zeigen: So zeigen Amöben soziales Verhalten, indem sie mit verwandten Amöben migrieren und ihre
Wenn beispielsweise Politiker und Fußballfans die Welt in »Heimische« und »Fremde«, in »Freunde« und »Gegner« aufteilen, unterschlagen sie einen wichtigen Aspekt von Gruppen: Die Grenzen sind nicht in Stein gemeißelt, sondern flexibel.

Gruppengrenzen verstehen und verschieben
Gruppenzugehörigkeiten – und damit
Das zeigen eindrücklich die Ergebnisse des zweiten Teils der Studie mit den Manchester-Fans. Bekommen sie zu Beginn gesagt, dass in der Studie britische Fußballfans erforscht werden sollen, reichen sie den verletzten Liverpool-Fans viel öfter eine helfende Hand. Die Erklärung hinter dem veränderten Verhalten: Jetzt sehen sich die Manchester-Fans in erster Linie als Fußballfans – eine Gruppe, zu der auch Liverpool-Fans gehören.
»Eine gesunde Demokratie funktioniert nur, wenn die Definition von Identität ständig hinterfragt wird.« – Stephen Reicher, britischer Sozialpsychologe
Das gleiche Prinzip wenden wir auch bei der nationalen Identität an: Wer in der »In-Group« ist, hängt davon ab, ob wir Nationalität über die ethnische oder die bürgerliche Identität bestimmen. Sehen wir ein asiatisch
Wie fließend die Einteilung ethnischer Kategorien ist, wird sich in Zukunft noch stärker zeigen. Ist ein Mädchen mit deutsch-koreanischen Eltern Europäerin oder Asiatin? Und
Wenn westliche Politiker über Migration sprechen, betonen sie häufig, dass zunehmende Migration zu zunehmenden Spannungen führt, weil sich die einheimische Bevölkerung in ihrer Identität bedroht fühle. Ist das wirklich so?
Tatsächlich
Ist die Rede von der einen deutschen, amerikanischen, französischen,
Wie können wir die Klebstoff-Funktion der Empathie nutzen? Indem wir nicht an alteingesessenen Zugehörigkeiten und Identitäten festhalten, sondern
Mehr davon? Dieser Text ist Teil unserer Reihe zum Kritischen Denken!
Mit Illustrationen von Robin Schüttert für Perspective Daily