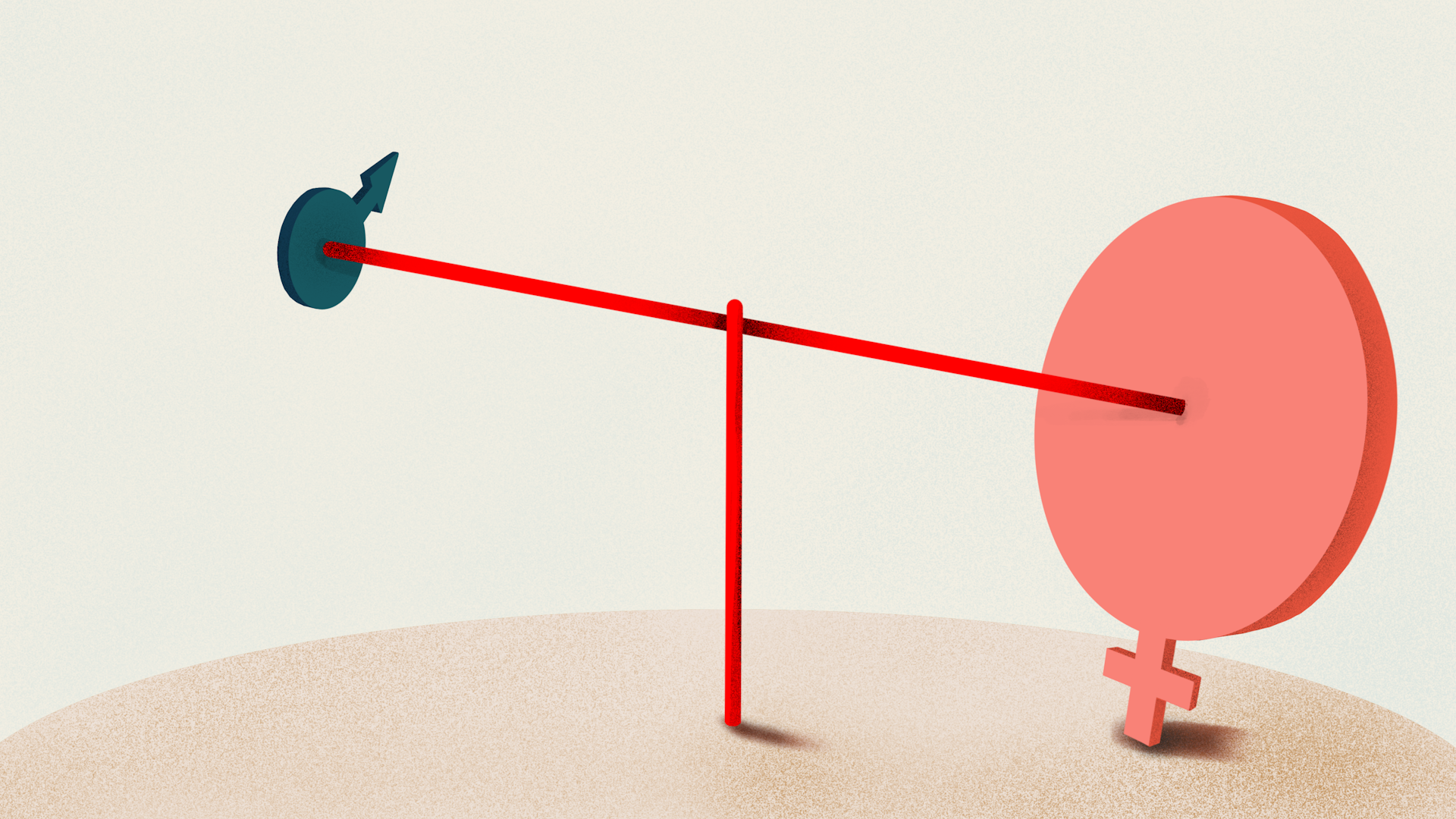Männer »arbeiten«, Frauen »kümmern sich«. Wieso sich das ändern muss
Wir alle brauchen Sorgearbeit. Dass Frauen den Großteil davon übernehmen, ist ungerecht. Höchste Zeit, das Problem anzupacken.
Kommt ein Mensch auf die Welt, ist er allein nicht fähig zu überleben: Er braucht jemanden, der sich kümmert und sorgt. Wird ein Mensch alt oder krank, wiederholt sich das. Diese Sorgearbeit, auch Care-Arbeit genannt, ist ein Grundstein dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert.
Trotzdem sind sogenannte Care-Berufe, etwa in Pflege und Erziehung, nach wie vor schlechter bezahlt als viele andere Jobs. Wer sich im Privaten um Menschen sorgt, erhält dafür oft gar keine Bezahlung. Menschen, die sich kümmern, vorwiegend Frauen, riskieren damit viel: Ihre Unabhängigkeit, ihre Rente, ihre mentale und körperliche Gesundheit.
Was ist Care-Arbeit?
Care-Arbeit beschreibt die unbezahlten und bezahlten (re-)produktiven Tätigkeiten des Sorgens und Sichkümmerns. Sie beginnt mit der Begleitung und Versorgung Neugeborener und Gebärender, reicht über die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Vor- und Grundschulalter, die familiäre und professionelle Pflege und Unterstützung bei Krankheit oder Behinderung, über die Hilfe zur Selbsthilfe unter Freund:innen, Nachbar:innen, im Bekanntenkreis bis zur Altenpflege, Sterbebegleitung und Grabpflege.
Einer Schätzung von Oxfam zufolge übernehmen
Auch in Deutschland leisten Frauen noch immer einen großen Teil der Care-Arbeit, im Schnitt 1,5-mal so viel wie
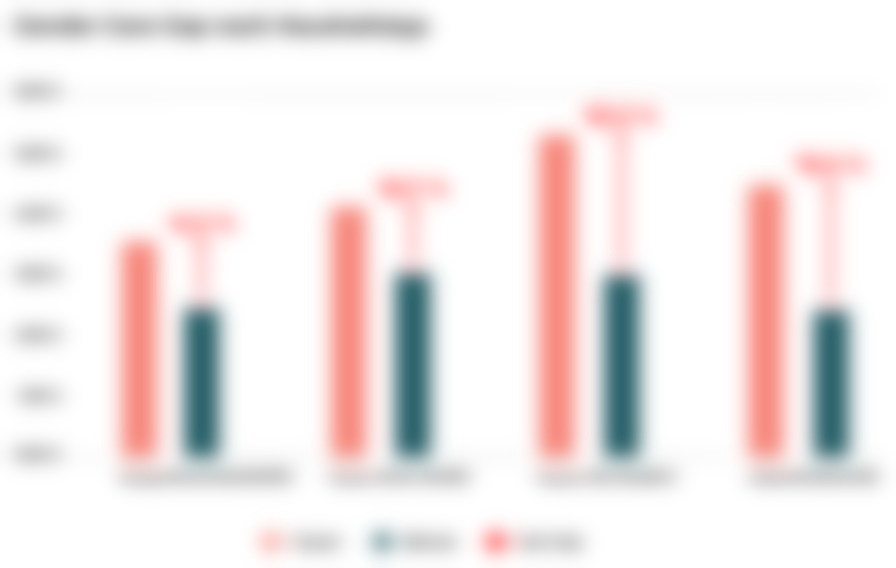
Um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen und die Sichtbarkeit, Wertschätzung und faire Verteilung von Care-Arbeit einzufordern, haben Almut Schnerring und Sascha Verlan den
Ich habe mich mit Initiatorin Almut Schnerring über die Folgen unterhalten, die die unfaire Verteilung von Sorgearbeit hat – und über Wege, den Status quo zu überwinden.
Mit Illustrationen von Claudia Wieczorek für Perspective Daily