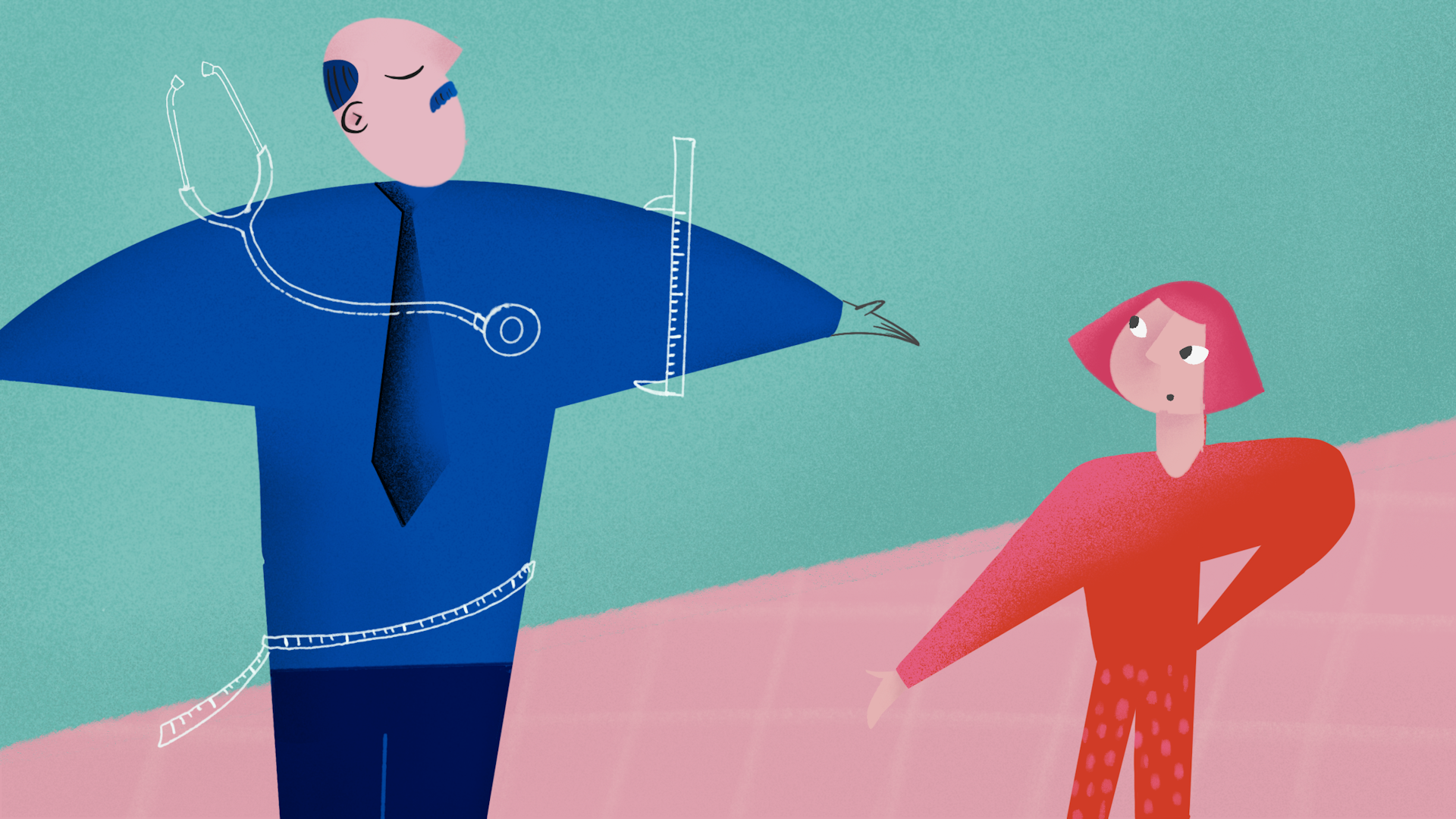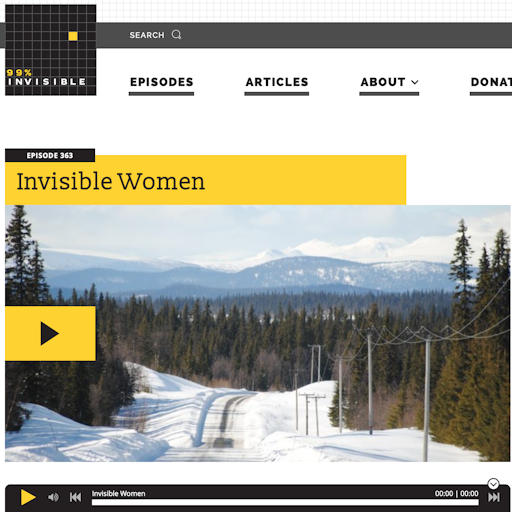Warum Frauen beim Arzt nicht gleichbehandelt werden sollten
Medikamente, Autos, Smartphones und sogar Städte sind meist auf männliche Bedürfnisse zugeschnitten. Für Frauen kann das lebensgefährlich sein. Doch mit den richtigen Daten ist die Lösung ganz einfach.
Es ist wirklich schwer zu verstehen. Wir fliegen zum Mond, tragen Mini-Computer in unseren Taschen, die uns jederzeit über alles Mögliche Auskunft erteilen, und sind sogar schon dabei,
Stell dir eine Welt vor, in der dein Handy zu groß ist für deine Hand, in der dein Arzt dir die falschen Medikamente verschreibt und in der die Wahrscheinlichkeit, dass du bei einem Autounfall schwer verletzt wirst, 47% höher ist als für eine andere Bevölkerungsgruppe; eine Welt, in der du jede Woche unzählige Stunden unbezahlt arbeitest. Wenn dir das alles bekannt vorkommt, dann bist du wahrscheinlich eine Frau.
Die britische Autorin und Aktivistin Caroline Criado-Perez hat in diesem Jahr ein viel beachtetes Buch geschrieben, mit dem sie ein Problem auf die Agenda gesetzt hat, das erst mal wenig aufregend klingt, aber jeden Tag Menschenleben in Gefahr bringt: die Gender Data Gap. »Wie eine von Männern gemachte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert«, lautet der Untertitel der deutschen Ausgabe von »Unsichtbare Frauen«,
Caroline Criado-Perez

Caroline Criado-Perez ist eine britische Autorin und feministische Aktivistin. Unter anderem führte sie eine erfolgreiche Kampagne für mehr Frauen auf britischen Pfundnoten durch – seit 2017 ist die Autorin Jane Austen das Gesicht des 10-Pfund-Scheins. Für ihr Buch »Unsichtbare Frauen« gewann Criado-Perez 2019 den »Royal Society Prize for Science Books«.
Bildquelle: Rachel Louise BrownDer Mann, sein Körper und seine Gewohnheiten werden als menschliche und gesellschaftliche Norm behandelt, die Frau dagegen als Komplikation, die von Forschern, Designern oder Stadtplanern erst mal ignoriert wird,
Wie könnte es besser gehen? In diesem Text stelle ich dir 3 Bereiche unseres Alltags vor, in denen mehr – und vor allem geschlechtsspezifisch erhobene – Daten für mehr Gerechtigkeit sorgen sollten.
1. Medizin. Der Anfall auf dem Tennisplatz oder: Erkennst du die Symptome eines Herzinfarkts auch bei Frauen?
Im Film läuft es oft so: Ein älterer Herr, Typ gestresster Manager, bekommt plötzlich nur noch schwer Luft. Er greift sich an die linke Brust und sackt auf dem Tennisplatz oder im Nobelrestaurant zusammen. Die Symptome sind für die Umgebung eindeutig:
In der Realität läuft es manchmal ähnlich, oft aber ganz anders. Bei Frauen können unspezifischere Symptome wie Kurzatmigkeit, Übelkeit oder Erbrechen und sogar
Warum ist das so? Autorin Caroline Criado-Perez hatte eine Vermutung und machte sich während ihrer Recherche für »Unsichtbare Frauen« auf in einen Londoner Buchladen, der medizinische Fachliteratur verkauft. Sie blätterte in den Lehrbüchern, die angehenden Medizinern die Funktionsweisen des menschlichen Körpers verbildlichen sollen – und fand dort vor allem männliche Körper.
»Frauen sind nicht einfach nur kleinere Männer« – Caroline Criado-Perez, Autorin
Dabei ist es keine Neuigkeit,
Viele Ärzte haben noch nie etwas von Gendermedizin gehört. Die medizinische Lehre in Deutschland müsste komplett umgestellt werden und durch geschlechtsspezifische Aspekte und Therapieformen erweitert werden.
Ein Beispiel: Obwohl Frauen 55% der HIV-Infizierten in Entwicklungsländern ausmachen und auch bekannt ist, dass sie andere Symptome und Komplikationen entwickeln als Männer,
Schwangere Frauen sind von der medizinischen Forschung komplett ausgeschlossen,
Der weibliche Zyklus wird ebenfalls als Komplikation, als Abweichung von der Norm betrachtet. Criado-Perez fand heraus, dass Frauen in klinischen Studien vor allem dann getestet werden, wenn ihr Hormonlevel am niedrigsten ist. Aber die meisten Frauen leben nun mal ständig mit den Hormonschwankungen

Manche Behandlungsmöglichkeiten werden gar nicht erst an Menschen getestet, weil sie es über Versuche an – männlichen – Tieren nicht hinausschaffen. Dabei gibt es auch bei Mäusen oder Ratten substanzielle Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Das sei seit fast 50 Jahren bekannt, schreibt Criado-Perez und zitiert ein Paper aus dem Jahr 2007, dem zufolge 90% der pharmakologischen Veröffentlichungen Studien beschreiben, die
Frauen entgehen also potenzielle Therapiemöglichkeiten, weil nur an männlichen Tieren, Probanden, Zellen getestet wird. Wie kann Medizin jetzt endlich gerechter werden?
Die Lösung liegt auf der Hand: geschlechtsspezifische Datenerhebung. Und dafür können Regierungen einiges tun. Schon seit dem Jahr 1993 müssen bei staatlich finanzierten klinischen Tests in den USA Frauen unter den Probanden sein, seit 3 Jahren müssen die Daten nun auch geschlechtsspezifisch analysiert werden. In Deutschland und der EU ist die »Ermittlung eventueller Unterschiede zwischen Frauen und Männern im Rahmen klinischer Prüfungen« schon seit Jahren gesetzlich gefordert, voraussichtlich
In der Öffentlichkeit dringt das Thema langsam durch. Unter
Im Jahr 2018 hat das deutsche Gesundheitsministerium immerhin erstmals Geld für die Erforschung und Förderung geschlechtsspezifischer Medizin bereitgestellt – rund 3,5 Millionen Euro. Ein bescheidener Betrag, wenn man ihn beispielsweise mit den 20 Millionen vergleicht, die gesetzliche Krankenkassen in Deutschland jährlich für
2. Stadtplanung. Wann Schneeräumen im Winter sexistisch ist und wie in Wien eine Stadt der kurzen Wege entstanden ist
Dieser Teil beginnt ausgerechnet in dem Land, das manchmal fast schon
Was dann passierte, erzählt Autorin Criado-Perez so: Ein Beamter habe gewitzelt, dass es mit dem Schneeräumen wenigstens einen Bereich gebe, in dem die »Gender-Leute« nicht herumschnüffeln würden. Der Kommentar machte eben diese Leute nachdenklich. Gab es vielleicht doch einen Aspekt daran, der sich diskriminierend auswirken könne? Sie wurden fündig.
Bislang war es im Winter in Karlskoga so gelaufen wie an vielen anderen Orten auch: Zuerst wurden die großen Hauptstraßen geräumt, danach die Bürgersteige und Fahrradwege. Und darin liegt tatsächlich eine Ungerechtigkeit – denn Frauen sind wesentlich öfter zu Fuß oder mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs als Männer.
»Mit dem Auto kommt man leichter durch 10 Zentimeter Schnee als zu Fuß oder mit dem Fahrrad«
Dafür gibt es einen Grund. Bei Männern ist es wahrscheinlich, dass sie 2-mal am Tag die großen Hauptstraßen befahren, nämlich morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends auf dem Weg nach Hause. Die Wege von Frauen dagegen sind eher komplexer. Ein typisches Bewegungsmuster von Frauen sieht so aus: Sie bringen die Kinder vor der Arbeit zur Schule, danach vielleicht ältere Verwandte zum Arzt und erledigen auf dem Weg nach Hause noch schnell die Einkäufe. Das sogenannte trip chaining, also die Aneinanderreihung vieler kleiner Wege, sei bei Frauen auf der ganzen Welt beobachtet worden, schreibt Criado-Perez. Wem das alles reichlich altmodisch vorkommt, dem sei gesagt:
Karlskoga änderte schließlich seine Winterroutine. Fußgängerinnen und der öffentliche Nahverkehr wurden priorisiert. Eine Anpassung, die nicht viel Aufwand erforderte und nichts kostete. Womit niemand gerechnet hatte: Karlskoga spart seitdem sogar Geld. In Nordschweden werden seit dem Jahr 1985 Daten zu Unfällen erhoben, die im Krankenhaus enden. Sie zeigten, dass auf vereisten Straßen 3-mal so viele Fußgänger wie Autofahrer verletzt werden. Diese Unfälle kosten das Gesundheitssystem Geld – und mit dem neuen Schneeräumsystem nahm ihre Häufigkeit tatsächlich ab.
Die alte Winterroutine in Karlskoga und anderswo ist kein Teil eines bewusst ausgearbeiteten sexistischen Masterplans, der Frauen das Leben schwermachen soll. Er resultiert ganz einfach aus der Gender Data Gap.
Die Männer, die den alten Plan zur Schneeräumung entwickelt hatten, wussten, wie sie sich durch die Stadt bewegen, und so entwickelten sie ihn nach ihren Bedürfnissen. Sie schlossen Frauen nicht vorsätzlich aus. Sie dachten nur nicht an sie.
Es mangelte vor allem an einer weiblichen Perspektive im Team der lokalen Beamten. Die braucht es nicht nur beim Schneeräumen, sondern auch bei der Planung des öffentlichen Nahverkehrs oder von Grünflächen, Bebauungsplänen, Architektur und sozialem Wohnungsbau.

Eva Kail brachte genau diese Perspektive bei der Stadt Wien ein, die seit den 90er-Jahren als Vorreiterin gendersensibler Stadtplanung gilt. Wie kam es dazu? Als junge Stadtplanerin organisierte Kail eine Ausstellung zu »Frauenalltag in der Stadt« und nahm dafür Kontakt zu einem Professor auf, der an der Technischen Universität zum Mobilitätsverhalten forschte und Daten für die Stadt Wien hatte. »Im Kontakt mit uns hat er diese geschlechtsspezifisch ausgewertet«, erzählt Kail, »und ihm ist es dann selbst wie Schuppen von den Augen gefallen, als wir uns die Ergebnisse zusammen angeschaut haben. Es waren natürlich die Frauen, die Einkäufe machten und viele Wege zu Fuß erledigten. Verkehrsplaner waren damals aber autofahrende weiße Männer der Mittelschicht – und so sahen unsere Städte auch aus.«
Fußgängerinnen seien ein blinder Fleck in der Verkehrsplanung gewesen, dabei konnte Kail nun anhand von Daten nachweisen, dass in Wien damals rund 2/3 aller Autofahrten von Männern und 2/3 aller Fußwege von Frauen zurückgelegt wurden. »Das war für die Politik gut fassbar.« Unter ihrer Leitung war das Frauenbüro der Stadt von nun an in die Erstellung der Verkehrskonzepte involviert.
Der nächste Streich des Frauenbüros war die Planung der »Frauen-Werk-Stadt«, eine Siedlung mit 360 Wohnungen, in der heute ungefähr 900 Menschen leben, wie Eva Kail erzählt. Wien erlebte in den 90er-Jahren eine Phase des Wachstums mit vielen Bauprojekten »auf der grünen Wiese«. Auch hier waren die Planer meist Männer. Kail und ihre Mitstreiterinnen setzten einen Wettbewerb mit ausschließlich weiblichen Architektinnen durch – um diese zu fördern, aber auch um Wohnraum zu schaffen, der den Bedürfnissen von Frauen Rechnung trägt.
Für den Standort wählten sie ein Grundstück, dass städtebaulich »schwierig« war, aber direkt neben einem großen Supermarkt und einer Straßenbahnhaltestelle lag. In der Siedlung sind inzwischen ein Kindergarten und eine Apotheke. Die Waschküche befindet sich auf einer Dachterrasse und nicht im dunklen Kellergeschoss neben der Tiefgarage, wie es sonst oft der Fall ist. Bei einem Wohnungsgrundriss sind alle Räume gleich groß, um sich verschiedenen Lebensphasen mit denselben Möbeln gut anpassen zu können – und damit jede und jeder einen Raum für sich hat.
In Wien können Projekte dieser Art leichter umgesetzt werden als anderswo, weil der
Eva Kail erzählt, dass viele der Aspekte, mit denen das Frauenbüro in den 90er-Jahren gearbeitet habe, inzwischen im Mainstream aufgegangen seien. »Die Stadt der kurzen Wege« zum Beispiel, für die auch die »Frauen-Werk-Stadt« ein gutes Beispiel sei, gewinne heute mit dem Klimathema an neuer Bedeutung. Hier sieht Eva Kail auch die nächsten wichtigen Diskussionen für gendersensible Stadtplanung:
Bei den Themen ›Smart Cities‹ und Klimaschutz stehen wir mit der Berücksichtigung der Genderperspektive noch am Anfang. Der Großteil der neuen Apps wird von jungen Männern programmiert. Dabei geht es aber um vielfältige Alltagszugänge und Alltagserleben, deshalb ist es wichtig, Frauen stärker zu involvieren.
3. Design. Warum Crash-Test-Dummys dringend ein Update brauchen
Hast du manchmal Probleme, dein Smartphone mit einer Hand zu bedienen? Hat sich jemand schon mal über dich lustig gemacht, weil du im Auto so »hinter dem Lenkrad klebst«? Können Alexa, Siri oder andere Systeme mit Sprachsteuerung dich manchmal nicht verstehen?
Falls ja: Es liegt nicht an dir. Es liegt am Design. Und während das Smartphoneproblem erst mal nur unbequem ist, kann die Gender Data Gap andernorts sogar tödliche Konsequenzen haben. Zum Beispiel im Auto. Dort haben Frauen ein sehr viel höheres Verletzungsrisiko als Männer –
Woran liegt das? Ganz einfach: Bei Sicherheitstests werden Frauen kaum berücksichtigt. Der am häufigsten verwendete Crash-Test-Dummy ist 1,77 Meter groß und wiegt 76 Kilogramm. Damit ist er größer und schwerer als die durchschnittliche Frau. Außerdem simuliert er die männliche Verteilung von Muskelmasse und eine männliche Wirbelsäule. Wenn nicht bekannt ist, wie Kräfte bei einem Unfall auf den Körper einwirken, ist es auch nicht verwunderlich, dass all jene ein höheres Verletzungsrisiko tragen, die nicht dem männlichen Standard entsprechen. Das gilt nicht nur für Frauen, sondern auch für viele andere Gruppen wie zum Beispiel ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder Übergewicht.
Auch dieses Problem wäre relativ einfach zu lösen:
Mit Illustrationen von Mirella Kahnert für Perspective Daily